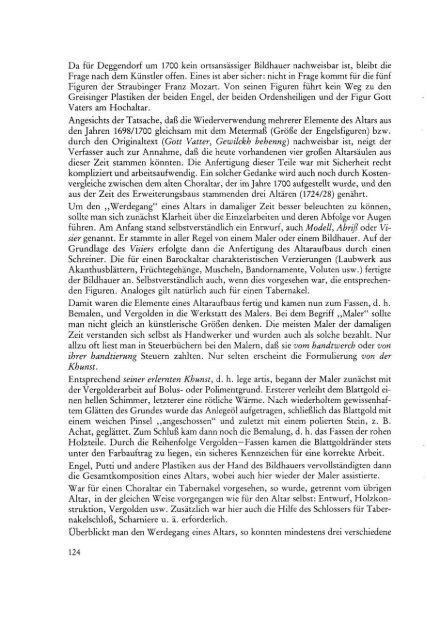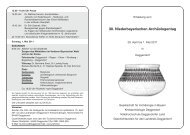r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Da <strong>für</strong> <strong>Deggendorf</strong> um 1700 kein ortsansässiger Bildhauer nachweisbar ist, bleibt die<br />
Frage nach dem Künstler offen. Eines ist aber sicher: nicht in Frage kommt <strong>für</strong> die fünf<br />
Figuren der Straubinger Franz Mozart. Von seinen Figuren führt kein Weg zu <strong>den</strong><br />
Greisinger Plastiken der bei<strong>den</strong> Engel, der bei<strong>den</strong> Or<strong>den</strong>sheiligen und der Figur Gott<br />
Vaters am Hochaltar.<br />
Angesichts der Tatsache, daß die Wiederverwendung mehrerer Elemente des Altars aus<br />
<strong>den</strong> Jahren 1698/1700 gleichsam mit dem Metermaß (Größe der Engelsfiguren) bzw.<br />
durch <strong>den</strong> Originaltext (Gott Vatter, Gewilckh behenng) nachweisbar ist, neigt der<br />
Verfasser auch zur Annahme, daß die heute vorhan<strong>den</strong>en vier großen Altarsäulen aus<br />
dieser Zeit stammen könnten. Die Anfertigung dieser Teile war mit Sicherheit recht<br />
kompliziert und arbeitsaufwendig. Ein solcher Gedanke wird auch noch durch Kostenvergleiche<br />
zwischen dem alten Choraltar, der im Jahre 1700 aufgestellt wurde, und <strong>den</strong><br />
aus der Zeit des Erweiterungsbaus stammen<strong>den</strong> drei Altären (1724/28) genährt.<br />
Um <strong>den</strong> „Werdegang" eines Altars in damaliger Zeit besser beleuchten zu können,<br />
sollte man sich zunächst Klarheit über die Einzelarbeiten und deren Abfolge vor Augen<br />
führen. Am Anfang stand selbstverständlich ein Entwurf, auch Modell, Abriß oder Visier<br />
genannt. Er stammte in aller Regel von einem Maler oder einem Bildhauer. Auf der<br />
Grundlage des Visiers erfolgte dann die Anfertigung des Altaraufbaus durch einen<br />
Schreiner. Die <strong>für</strong> einen Barockaltar charakteristischen Verzierungen (Laubwerk aus<br />
Akanthusblättern, Früchtegehänge, Muscheln, Bandornamente, Voluten usw.) fertigte<br />
der Bildhauer an. Selbstverständlich auch, wenn dies vorgesehen war, die entsprechen<strong>den</strong><br />
Figuren. Analoges gilt natürlich auch <strong>für</strong> einen Tabernakel.<br />
Damit waren die Elemente eines Altaraufbaus fertig und kamen nun zum Fassen, d. h.<br />
Bemalen, und Vergol<strong>den</strong> in die Werkstatt des Malers. Bei dem Begriff „Maler" sollte<br />
man nicht gleich an künstlerische Größen <strong>den</strong>ken. Die meisten Maler der damaligen<br />
Zeit verstan<strong>den</strong> sich selbst als Handwerker und wur<strong>den</strong> auch als solche bezahlt. Nur<br />
allzu oft liest man in Steuerbüchern bei <strong>den</strong> Malern, daß sie vom handtwerch oder von<br />
ihrer handtierung Steuern zahlten. Nur selten erscheint die Formulierung von der<br />
Khunst.<br />
Entsprechend seiner erlernten Khunst, d. h. lege artis, begann der Maler zunächst mit<br />
der Vergolderarbeit auf Bolus- oder Polimentgrund. Ersterer verleiht dem Blattgold einen<br />
hellen Schimmer, letzterer eine rötliche Wärme. Nach wiederholtem gewissenhaftem<br />
Glätten des Grundes wurde das Anlegeöl aufgetragen, schließlich das Blattgold mit<br />
einem weichen Pinsel „angeschossen" und zuletzt mit einem polierten Stein, z. B.<br />
Achat, geglättet. Zum Schluß kam dann noch die Bemalung, d. h. das Fassen der rohen<br />
Holzteile. Durch die Reihenfolge Vergol<strong>den</strong>—Fassen kamen die Blattgoldränder stets<br />
unter <strong>den</strong> Farbauftrag zu liegen, ein sicheres Kennzeichen <strong>für</strong> eine korrekte Arbeit.<br />
Engel, Putti und andere Plastiken aus der Hand des Bildhauers vervollständigten dann<br />
die Gesamtkomposition eines Altars, wobei auch hier wieder der Maler assistierte.<br />
War <strong>für</strong> einen Choraltar ein Tabernakel vorgesehen, so wurde, getrennt vom übrigen<br />
Altar, in der gleichen Weise vorgegangen wie <strong>für</strong> <strong>den</strong> Altar selbst: Entwurf, Holzkonstruktion,<br />
Vergol<strong>den</strong> usw. Zusätzlich war hier auch die Hilfe des Schlossers <strong>für</strong> Tabernakelschloß,<br />
Scharniere u. ä. erforderlich.<br />
Überblickt man <strong>den</strong> Werdegang eines Altars, so konnten mindestens drei verschie<strong>den</strong>e<br />
124