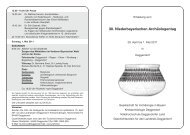r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Und <strong>den</strong>noch: trotz aller teuerungsbedingten Preisschwankungen nach oben hin blieben<br />
die Arbeitslöhne über viele Jahrzehnte hinweg weitgehend konstant. So verdiente<br />
ein Maurer- oder Zimmergeselle zu Beginn des 18. Jahrhunderts pro Tag 18 bis 20<br />
Kreuzer bei insgesamt 10 Stun<strong>den</strong> Arbeitszeit (5-7 Uhr, 8-11 Uhr, 12-15 Uhr und<br />
16—18 Uhr). Ein Lehrjunge in diesen Berufszweigen verdiente immerhin 14 Kreuzer<br />
pro Tag. Diese Löhne und Arbeitszeiten galten <strong>für</strong> die Zeit zwischen Georgi und Michaeli;<br />
im Winterhalbjahr wurde die Arbeitszeit pro Tag um zwei Stun<strong>den</strong> verkürzt und<br />
an Lohn um eine Stunde weniger ausbezahlt.<br />
Bei vielen Arbeitsleistungen wurde ein z. T. sehr erheblicher Unterschied in der Bezahlung<br />
zwischen Stadt und Land gemacht. So verdiente ein Drescher in der Stadt <strong>Deggendorf</strong><br />
ohne Kost 15 Kreuzer, mit Kost 8 Kreuzer pro Tag. Auf dem umliegen<strong>den</strong> Land<br />
wurde die gleiche Arbeitsleistung hingegen nur mit 12 bzw. 6 Kreuzern entlohnt.<br />
Um diesen finanziellen Aspekt noch ein wenig abrun<strong>den</strong> zu können, seien noch weitere<br />
Beispiele angeführt. Für eine Milchkuh waren zu Beginn des 18. Jahrhunderts 10 Gul<strong>den</strong><br />
zu bezahlen, <strong>für</strong> ein schlechtes Kölbl (kleines mageres Kalb) konnte 1698 in Greising<br />
der beschei<strong>den</strong>e Betrag von nur 50 Kreuzer erlöst wer<strong>den</strong>. Für neun kleine und große<br />
Hühner, die im selben Jahr in Greising geopfert wur<strong>den</strong>, erhielt man <strong>den</strong> gleichen Betrag.<br />
Ein Pfund gelbes, d. h. ungebleichtes, Bienenwachs konnte damals <strong>für</strong> 34 Kreuzer<br />
verkauft wer<strong>den</strong>. An unseren heutigen Verhältnissen gemessen, ein geradezu horrender<br />
Preis.<br />
Es ist demnach mehr als müßig, ja geradezu sinnlos, nach der Kaufkraft eines Gul<strong>den</strong>s<br />
der damaligen Zeit im Vergleich zur heutigen Währung zu fragen. Die Feststellung, ein<br />
Gul<strong>den</strong> z.B. des Jahres 1720 entspräche in seiner Kaufkraft genau 48,— DM, ist blanker<br />
Unsinn. Zwei kleine Rechenbeispiele hierzu. Eine gute Milchkuh stellt heute einen<br />
Wert von rund 2500,— DM dar. Damals kostete sie 10 Gul<strong>den</strong>. Also: 1 Gul<strong>den</strong> = rund<br />
250,— DM. Ein Pfund Bienenwachs war damals 34 Kreuzer wert, heute erhält der Imker<br />
da<strong>für</strong> rund 4,— DM. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Pfundgewichte,<br />
0,56 bzw. 0,50 kg, ließe sich <strong>für</strong> <strong>den</strong> Kreuzer ein Betrag von rund 13 Pfennigen errechnen,<br />
d. h. der Gul<strong>den</strong> wäre dann nicht ganz 8,— DM wert gewesen. Mehr sollte<br />
man dazu nicht sagen.<br />
An dieser Stelle sei noch eine kritische Schlußbemerkung zu diesem Kapitel gestattet.<br />
Für viele von uns ist Barock im wesentlichen nur ein Synonym <strong>für</strong> prachtvolle Kirchenbauten,<br />
<strong>für</strong> elegante Schlösser, Bachsche Musik. Wir sind von unseren umfassen<strong>den</strong><br />
Kenntnissen über diese Zeit überzeugt, wir glauben alles zu wissen. Die brutalen<br />
Nachwirkungen des Dreißigjährigen Kriegs, der Spanische und der österreichische<br />
Erbfolgekrieg mit ihren katastrophalen Auswirkungen passen einfach dann nicht mehr<br />
in das Ansichtskarten- und Urlaubsfoto-Klischee über die Barockzeit. Auch die schon<br />
erwähnten Hungersnöte, Mißernten und Teuerungen sind, auch wenn sie oft nur regionale<br />
Auswirkungen hatten, nicht in unseren liebgewonnenen Barockzeitraster einzuordnen.<br />
Wer weiß schon um <strong>den</strong> hohen Tribut, <strong>den</strong> die Krankheiten, von Soldaten eingeschleppt,<br />
im Winter 1742/43 von der <strong>Deggendorf</strong>er Bevölkerung forderten: im Januar<br />
wur<strong>den</strong> 80, im Februar sogar 124 Tote in <strong>Deggendorf</strong> zur letzten Ruhe gebettet. Vielleicht<br />
können uns diese traurigen Tatsachen <strong>den</strong> Weg zum Verständnis der geradezu<br />
eschatologischen Vorstellungen der damaligen Menschen ebnen, die durch Buße, Op-<br />
84