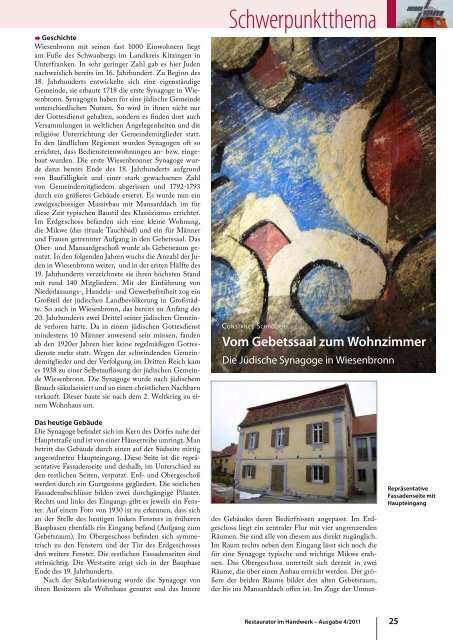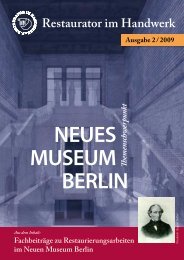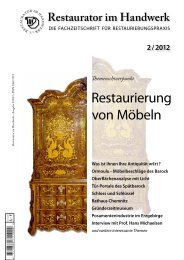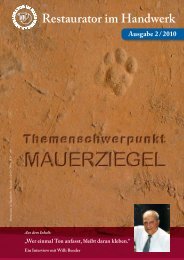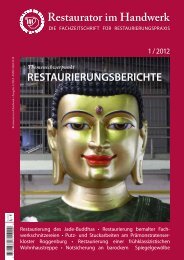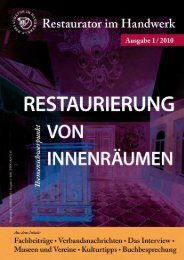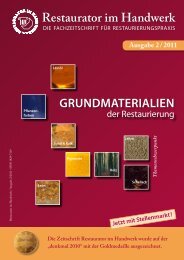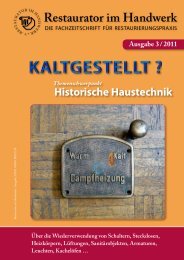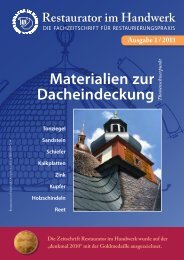UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV
UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV
UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� Geschichte<br />
Wiesenbronn mit seinen fast 1000 Einwohnern liegt<br />
am Fuße des Schwanbergs <strong>im</strong> Landkreis Kitzingen in<br />
Unterfranken. In sehr geringer Zahl gab es hier Juden<br />
nachweislich bereits <strong>im</strong> 16. Jahrhundert. Zu Beginn des<br />
18. Jahrhunderts entwickelte sich eine eigenständige<br />
Gemeinde, sie erbaute 1718 die erste Synagoge in Wiesenbronn.<br />
Synagogen haben für eine jüdische Gemeinde<br />
unterschiedlichen Nutzen. So wird in ihnen nicht nur<br />
der Gottesdienst gehalten, sondern es finden dort auch<br />
Versammlungen in weltlichen Angelegenheiten und die<br />
religiöse Unterrichtung der Gemeindemitglieder statt.<br />
In den ländlichen Regionen wurden Synagogen oft so<br />
errichtet, dass Bedienstetenwohnungen an- bzw. eingebaut<br />
wurden. Die erste Wiesenbronner Synagoge wurde<br />
dann bereits Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund<br />
von Baufälligkeit und einer stark gewachsenen Zahl<br />
von Gemeindemitgliedern abgerissen und 1792-1793<br />
durch ein größeres Gebäude ersetzt. Es wurde nun ein<br />
zweigeschossiger Massivbau mit Mansarddach <strong>im</strong> für<br />
diese Zeit typischen Baustil des Klassizismus errichtet.<br />
Im Erdgeschoss befanden sich eine kleine Wohnung,<br />
die Mikwe (das rituale Tauchbad) und ein für Männer<br />
und Frauen getrennter Aufgang in den Gebetssaal. Das<br />
Ober- und Mansardgeschoß wurde als Gebetsraum genutzt.<br />
In den folgenden Jahren wuchs die Anzahl der Juden<br />
in Wiesenbronn weiter, und in der ersten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts verzeichnete sie ihren höchsten Stand<br />
mit rund 140 Mitgliedern. Mit der Einführung von<br />
Niederlassungs-, Handels- und Gewerbefreiheit zog ein<br />
Großteil der jüdischen Landbevölkerung in Großstädte.<br />
So auch in Wiesenbronn, das bereits zu Anfang des<br />
20. Jahrhunderts zwei Drittel seiner jüdischen Gemeinde<br />
verloren hatte. Da in einem jüdischen Gottesdienst<br />
mindestens 10 Männer anwesend sein müssen, fanden<br />
ab den 1920er Jahren hier keine regelmäßigen Gottesdienste<br />
mehr statt. Wegen der schwindenden Gemeindemitglieder<br />
und der Verfolgung <strong>im</strong> Dritten Reich kam<br />
es 1938 zu einer Selbstauflösung der jüdischen Gemeinde<br />
Wiesenbronn. Die Synagoge wurde nach jüdischem<br />
Brauch säkularisiert und an einen christlichen Nachbarn<br />
verkauft. Dieser baute sie nach dem 2. Weltkrieg zu einem<br />
Wohnhaus um.<br />
Das heutige Gebäude<br />
Die Synagoge befindet sich <strong>im</strong> Kern des Dorfes nahe der<br />
Hauptstraße und ist von einer Häuserreihe umringt. Man<br />
betritt das Gebäude durch einen auf der Südseite mittig<br />
angeordneten Haupteingang. Diese Seite ist die repräsentative<br />
Fassadenseite und deshalb, <strong>im</strong> Unterschied zu<br />
den restlichen Seiten, verputzt. Erd- und Obergeschoß<br />
werden durch ein Gurtges<strong>im</strong>s gegliedert. Die seitlichen<br />
Fassadenabschlüsse bilden zwei durchgängige Pilaster.<br />
Rechts und links des Eingangs gibt es jeweils ein Fenster.<br />
Auf einem Foto von 1930 ist zu erkennen, dass sich<br />
an der Stelle des heutigen linken Fensters in früheren<br />
Bauphasen ebenfalls ein Eingang befand (Aufgang zum<br />
Gebetsraum). Im Obergeschoss befinden sich symmetrisch<br />
zu den Fenstern und der Tür des Erdgeschosses<br />
drei weitere Fenster. Die restlichen Fassadenseiten sind<br />
steinsichtig. Die Westseite zeigt sich in der Bauphase<br />
Ende des 19. Jahrhunderts.<br />
Nach der Säkularisierung wurde die Synagoge von<br />
ihren Besitzern als Wohnhaus genutzt und das Innere<br />
Schwerpunktthema<br />
COnStanCe SCHröder<br />
Vom Gebetssaal zum Wohnz<strong>im</strong>mer<br />
Die Jüdische Synagoge in Wiesenbronn<br />
des Gebäudes deren Bedürfnissen angepasst. Im Erdgeschoss<br />
liegt ein zentraler Flur mit vier angrenzenden<br />
Räumen. Sie sind alle von diesem aus direkt zugänglich.<br />
Im Raum rechts neben dem Eingang lässt sich noch die<br />
für eine Synagoge typische und wichtige Mikwe erahnen.<br />
Das Obergeschoss unterteilt sich derzeit in zwei<br />
Räume, die über einen Anbau erreicht werden. Der größere<br />
der beiden Räume bildet den alten Gebetsraum,<br />
der bis ins Mansarddach offen ist. Im Zuge der Umnut-<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – Ausgabe 4/2011 25<br />
Repräsentative<br />
Fassadenseite mit<br />
Haupteingang