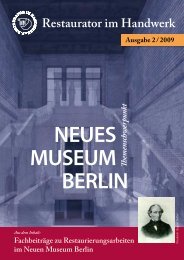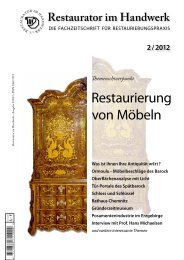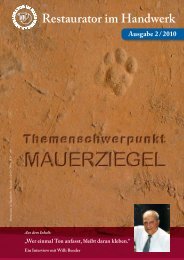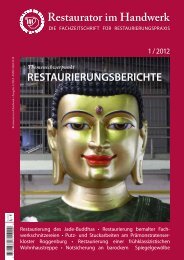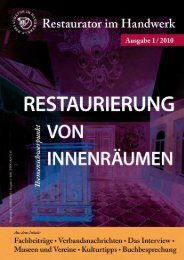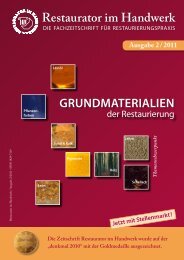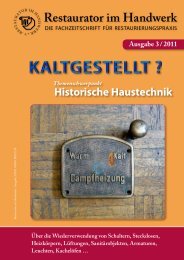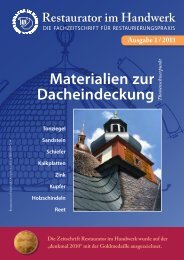UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV
UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV
UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nen Kanne unter Zugabe von Bleiglätte (PbO) erzeugt,<br />
welche <strong>im</strong> Warmen stehend regelmäßig geschüttelt und<br />
gewendet wurde. Unzählige derartige Rezepturen alter<br />
Maler sind verschollen, die hier und da noch schriftlich<br />
überlieferten aber sehr selten vollständig und verständlich.<br />
Eine Ausnahme ist die aus dem Werkstattbuch des<br />
Johan Arendt Müller zu Quakenbrück aus der Zeit des<br />
18. Jahrhunderts (siehe gesonderte Spalte). Dieses gut<br />
vorbereitete Standöl, zur Heißbehandlung der Teile erneut<br />
erhitzt, erreicht nun <strong>im</strong>mer noch fast die gleiche<br />
Viskosität wie neues Leinöl, aber es führt dennoch mehr<br />
Linoxyn-Substanz in die Holzsubstanz ein, die be<strong>im</strong><br />
Erkalten wesentlich besser füllende Eigenschaften hat.<br />
Schließlich wollen wir ja dem Holz etwas von seiner<br />
verlorenen Substanz wiedergeben. Das ist das Hauptziel<br />
auch bei der hier beschriebenen Arbeit.<br />
Die unzähligen Risse und kleinen stehenden Spalten<br />
<strong>im</strong> Holz waren in der letzten Zeit, als die Teile der Witterung<br />
ausgesetzt waren, ein regelrechtes Reservoir für<br />
Wasser. So konnten sich auch in dem Eichenholz Mikroorganismen<br />
ansiedeln, die trotz des säurehaltigen Milieus<br />
zum Verzehr der Lignin-Substanz führten und so zur<br />
Beschleunigung des weiteren Verfalls Schritt für Schritt<br />
beitrugen. Die vor der Behandlung vorliegende Struktur<br />
des Verzehrs lässt erkennen, wie die morbiden Reste aus<br />
Zellulosefasern, als Überbleibsel des früheren Holzes,<br />
die veränderte Oberfläche bilden. Wenn die strukturellen<br />
Verluste ersetzt werden, kann das Holz noch einmal<br />
290 Jahre als Original erhalten bleiben. Vorausgesetzt, es<br />
wird zukünftig wieder eine mit Sachverstand vorgenommene<br />
Anstrichpflege in regelmäßigen Abständen vorgenommen.<br />
Daran hege ich allerdings echte Zweifel, weil<br />
die heutige Finanzpolitik der öffentlichen Haushalte<br />
viel zu stark auf langfristige Grunderneuerungen als auf<br />
laufende Unterhaltung von Bauwerken ausgerichtet und<br />
systematisiert ist. Auch ist es sehr schwer, Verwaltungsleuten<br />
und Parlamentariern klar zu machen, dass es bei<br />
diesen Dingen der Anstrichpflege auf Kontinuität, auch<br />
<strong>im</strong> Hinblick auf das grundsätzliche Farbverständnis des<br />
Malers, ankommt. Das zwingt zum Beispiel oft dazu,<br />
eine Vorauswahl bei der Auftragsvergabe zu praktizieren<br />
oder sogar eine kontinuierliche feste Beziehung zu einem<br />
<strong>Handwerk</strong>er zu pflegen, der den Wissensstand aus<br />
dem Auftrag <strong>im</strong>mer weiter bewahrt und darum durch<br />
Kontinuität den systematischen Verfall zumindest stark<br />
verzögert.<br />
In der Gegenüberstellung des unbehandelten Holzes<br />
mit dem durch mehrmaliges Tauchen für den eigentlichen<br />
Anstrich vorbehandelten Holz wird die Wirkung<br />
der Methode sehr gut sichtbar. Allerdings erfordert sie<br />
Zeit, denn wenn der vorausgehende Firniseintrag noch<br />
nicht einen best<strong>im</strong>mten Trocknungsgrad erreicht hat,<br />
bringt der darauffolgende eine geringere Wirkung. Zwischen<br />
jedem Tauchgang sollten mindestens eine Woche,<br />
möglichst sogar zwei Wochen liegen. Auf die so erfolgte<br />
Grundierung folgt dann der aus mindestens nochmals<br />
drei Anstrichen bestehende pigmentierte Farbauftrag.<br />
Bei diesem handelt es sich logischerweise ebenfalls um<br />
ein System auf Leinölbasis. Hier können die ausgezeichneten<br />
Leinölfarben aus der darauf spezialisierten nordeuropäischen<br />
Fabrikation angewandt werden. Ein Maler<br />
mit Erfahrung in der Selbstherstellung derartiger Farben<br />
und ausgerüstet mit der unbedingt dazu erforderlichen<br />
Farbmühle kann dies auch in eigener Werkstatt<br />
selbst vollziehen. Aber bitte beachten: nur mit Standöl<br />
ansetzen.<br />
Die Bilder des fertigen Erkers ergeben einen guten<br />
Eindruck von der Besonderheit der Gestaltung und<br />
Erhaltung dieser Fassade. Die Farbgebung ist dabei<br />
durchaus ein Aspekt, der Anlaß zur Disputation liefern<br />
kann. Das heutige durchgehende Verständnis von barocker<br />
Farbigkeit erscheint mit persönlich als zu kraftlos.<br />
Ein mutigerer Einsatz, zum Beispiel des vorgefundenen<br />
kräftigen Grün, hätte eine noch größere Ausdrucksstärke<br />
der Formensprache erzeugt und wäre in dem Fall ja<br />
eindeutig zu belegen gewesen. Hier erschreckt vielleicht<br />
mancher Entscheider unserer Tage vor der mutigen<br />
Komposition der alten Malermeister, die diese Farbigkeit<br />
ja in aller Regel nach einem kleinen auf Karton erstellten<br />
Muster an die Fassade angelegt haben. Hier schärft<br />
natürlich die Übung den Blick. Und wie oft werden heute<br />
Fassaden in barocker Farbgebung in unsren Städten<br />
praktiziert? Darum sei hier mit Nachsicht geurteilt. �<br />
Christian Metzeroth<br />
ist Tischlermeister und <strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong>.<br />
E-Mail: info@metzeroth.de<br />
Auszüge aus dem Werkstattbuch des Fassmalers Johann<br />
Arendt Müller zu Quakenbrück.<br />
Die Originalschrift lässt sich auf 1798 datieren, aus den<br />
Inhalten wird aber erkenntlich das die Erkenntnisse auf<br />
frühere Zeit zurückgreifen, somit also als auf das gesamte<br />
18. Jahrhundert sicher einzuordnen sind. Der Text<br />
wurde zum besseren Verständnis von Helmut Ottenjann<br />
<strong>im</strong> Jahre 1979 in eine dem heutigen Sprachverständnis<br />
nähere Form der deutschen Sprache übertragen und<br />
letztlich wurde er von Frau Prof Jirina Lehmann Hildeshe<strong>im</strong><br />
<strong>im</strong> Jahre 2001 nochmals fachlich durchgearbeitet.<br />
Aber auch der Originaltext liegt in einer entsprechenden<br />
Schrift vor.<br />
„Dieser Firnis wird deswegen Malerfirnis genannt, weil<br />
ihn die Maler am gemeinlichsten (am meisten) gebrauchen.<br />
Er wird gekocht von gutem holländischen Leinöl,<br />
auf 1 Pfund holländisches Leinöl 3 Lot Silberglätte, 1<br />
Lot rotes Mennige, 1 Lot Umbra. Dieser Einsatz (Ansatz)<br />
ist zu viel, auch ein eiserner Topf wohl gut.<br />
NB: Es macht nichts, wenn man ein wenig mehr oder<br />
weniger von den Species (Zutaten) hinein tut. Tue solches<br />
mit dem Leinöl in einem gut glasiertem Pott uns<br />
setze es auf Kohlen und lasse es solange kochen, bis der<br />
gelbe Schaum vergangen ist und der Schaum nunmehr<br />
graubraun geworden ist und das Öl nicht mehr so geil<br />
grösig riecht, sondern bernhaftig, dann ist er gar (fertig).<br />
Man setzt ihn ab und lässt ihn kalt werden und verwahrt<br />
ihn zum Gebrauch. ………………….. Dieser Fürnis<br />
wird gebraucht in allen Ölmalerein. Er wird auch gebraucht<br />
zu dem in Punkt 1 beschriebenen Bernsteinlack,<br />
man kann ihn auf unterschiedliche Art machen und es<br />
kommt auf die Dosis nicht so genau an. Zum Beispiel,<br />
wenn man es nicht anders haben kann, so n<strong>im</strong>mt man<br />
nur 1 Pfund Leinöl 3,4 oder 5 Lot Silberglätte und kocht<br />
es damit, wie vorher beschrieben.“<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – Ausgabe 4/2011 41