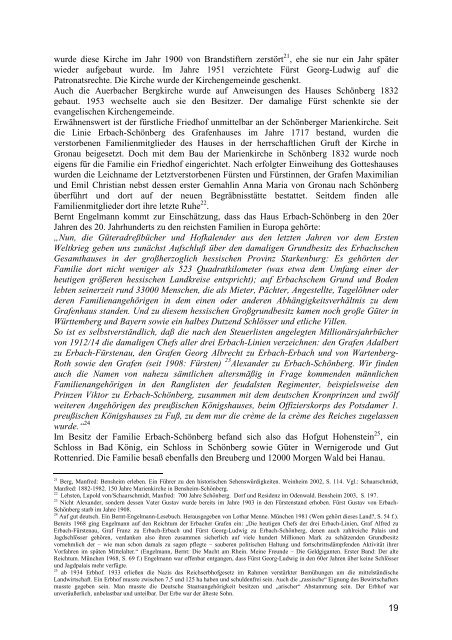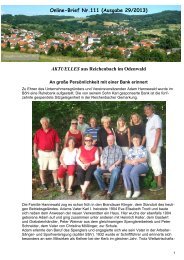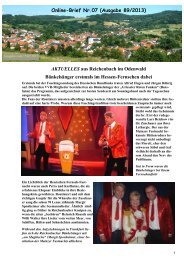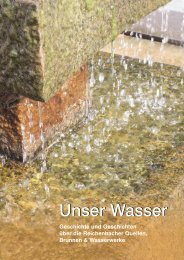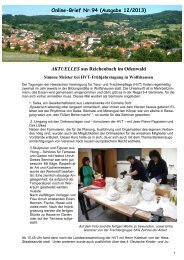Für Sie als download: Das Orginal-Manuskript der
Für Sie als download: Das Orginal-Manuskript der
Für Sie als download: Das Orginal-Manuskript der
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wurde diese Kirche im Jahr 1900 von Brandstiftern zerstört 21 , ehe sie nur ein Jahr später<br />
wie<strong>der</strong> aufgebaut wurde. Im Jahre 1951 verzichtete <strong>Für</strong>st Georg-Ludwig auf die<br />
Patronatsrechte. Die Kirche wurde <strong>der</strong> Kirchengemeinde geschenkt.<br />
Auch die Auerbacher Bergkirche wurde auf Anweisungen des Hauses Schönberg 1832<br />
gebaut. 1953 wechselte auch sie den Besitzer. Der damalige <strong>Für</strong>st schenkte sie <strong>der</strong><br />
evangelischen Kirchengemeinde.<br />
Erwähnenswert ist <strong>der</strong> fürstliche Friedhof unmittelbar an <strong>der</strong> Schönberger Marienkirche. Seit<br />
die Linie Erbach-Schönberg des Grafenhauses im Jahre 1717 bestand, wurden die<br />
verstorbenen Familienmitglie<strong>der</strong> des Hauses in <strong>der</strong> herrschaftlichen Gruft <strong>der</strong> Kirche in<br />
Gronau beigesetzt. Doch mit dem Bau <strong>der</strong> Marienkirche in Schönberg 1832 wurde noch<br />
eigens für die Familie ein Friedhof eingerichtet. Nach erfolgter Einweihung des Gotteshauses<br />
wurden die Leichname <strong>der</strong> Letztverstorbenen <strong>Für</strong>sten und <strong>Für</strong>stinnen, <strong>der</strong> Grafen Maximilian<br />
und Emil Christian nebst dessen erster Gemahlin Anna Maria von Gronau nach Schönberg<br />
überführt und dort auf <strong>der</strong> neuen Begräbnisstätte bestattet. Seitdem finden alle<br />
Familienmitglie<strong>der</strong> dort ihre letzte Ruhe 22 .<br />
Bernt Engelmann kommt zur Einschätzung, dass das Haus Erbach-Schönberg in den 20er<br />
Jahren des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts zu den reichsten Familien in Europa gehörte:<br />
„Nun, die Güteradreßbücher und Hofkalen<strong>der</strong> aus den letzten Jahren vor dem Ersten<br />
Weltkrieg geben uns zunächst Aufschluß über den damaligen Grundbesitz des Erbachschen<br />
Gesamthauses in <strong>der</strong> großherzoglich hessischen Provinz Starkenburg: Es gehörten <strong>der</strong><br />
Familie dort nicht weniger <strong>als</strong> 523 Quadratkilometer (was etwa dem Umfang einer <strong>der</strong><br />
heutigen größeren hessischen Landkreise entspricht); auf Erbachschem Grund und Boden<br />
lebten seinerzeit rund 33000 Menschen, die <strong>als</strong> Mieter, Pächter, Angestellte, Tagelöhner o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong>en Familienangehörigen in dem einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Abhängigkeitsverhältnis zu dem<br />
Grafenhaus standen. Und zu diesem hessischen Großgrundbesitz kamen noch große Güter in<br />
Württemberg und Bayern sowie ein halbes Dutzend Schlösser und etliche Villen.<br />
So ist es selbstverständlich, daß die nach den Steuerlisten angelegten Millionärsjahrbücher<br />
von 1912/14 die damaligen Chefs aller drei Erbach-Linien verzeichnen: den Grafen Adalbert<br />
zu Erbach-<strong>Für</strong>stenau, den Grafen Georg Albrecht zu Erbach-Erbach und von Wartenberg-<br />
Roth sowie den Grafen (seit 1908: <strong>Für</strong>sten) 23 Alexan<strong>der</strong> zu Erbach-Schönberg. Wir finden<br />
auch die Namen von nahezu sämtlichen altersmäßig in Frage kommenden männlichen<br />
Familienangehörigen in den Ranglisten <strong>der</strong> feud<strong>als</strong>ten Regimenter, beispielsweise den<br />
Prinzen Viktor zu Erbach-Schönberg, zusammen mit dem deutschen Kronprinzen und zwölf<br />
weiteren Angehörigen des preußischen Königshauses, beim Offizierskorps des Potsdamer 1.<br />
preußischen Königshauses zu Fuß, zu dem nur die crème de la crème des Reiches zugelassen<br />
wurde.“ 24<br />
Im Besitz <strong>der</strong> Familie Erbach-Schönberg befand sich <strong>als</strong>o das Hofgut Hohenstein 25 , ein<br />
Schloss in Bad König, ein Schloss in Schönberg sowie Güter in Wernigerode und Gut<br />
Rottenried. Die Familie besaß ebenfalls den Breuberg und 12000 Morgen Wald bei Hanau.<br />
21<br />
Berg, Manfred: Bensheim erleben. Ein Führer zu den historischen Sehenswürdigkeiten. Weinheim 2002, S. 114. Vgl.: Schaarschmidt,<br />
Manfred: 1882-1982. 150 Jahre Marienkirche in Bensheim-Schönberg.<br />
22<br />
Lehsten, Lupold von/Schaarschmidt, Manfred: 700 Jahre Schönberg. Dorf und Residenz im Odenwald. Bensheim 2003, S. 197.<br />
23<br />
Nicht Alexan<strong>der</strong>, son<strong>der</strong>n dessen Vater Gustav wurde bereits im Jahre 1903 in den <strong>Für</strong>stenstand erhoben. <strong>Für</strong>st Gustav von Erbach-<br />
Schönberg starb im Jahre 1908.<br />
24<br />
Auf gut deutsch. Ein Bernt-Engelmann-Lesebuch. Herausgegeben von Lothar Menne. München 1981 (Wem gehört dieses Land?, S. 54 f.).<br />
Bereits 1968 ging Engelmann auf den Reichtum <strong>der</strong> Erbacher Grafen ein: „Die heutigen Chefs <strong>der</strong> drei Erbach-Linien, Graf Alfred zu<br />
Erbach-<strong>Für</strong>stenau, Graf Franz zu Erbach-Erbach und <strong>Für</strong>st Georg-Ludwig zu Erbach-Schönberg, denen auch zahlreiche Palais und<br />
Jagdschlösser gehören, verdanken <strong>als</strong>o ihren zusammen sicherlich auf viele hun<strong>der</strong>t Millionen Mark zu schätzenden Grundbesitz<br />
vornehmlich <strong>der</strong> – wie man schon dam<strong>als</strong> zu sagen pflegte – sauberen politischen Haltung und fortschrittsdämpfenden Aktivität ihrer<br />
Vorfahren im späten Mittelalter.“ (Engelmann, Bernt: Die Macht am Rhein. Meine Freunde – Die Geldgiganten. Erster Band: Der alte<br />
Reichtum. München 1968, S. 69 f.) Engelmann war offenbar entgangen, dass <strong>Für</strong>st Georg-Ludwig in den 60er Jahren über keine Schlösser<br />
und Jagdpalais mehr verfügte.<br />
25<br />
ab 1934 Erbhof. 1933 erließen die Nazis das Reichserbhofgesetz im Rahmen verstärkter Bemühungen um die mittelständische<br />
Landwirtschaft. Ein Erbhof musste zwischen 7,5 und 125 ha haben und schuldenfrei sein. Auch die „rassische“ Eignung des Bewirtschafters<br />
musste gegeben sein. Man musste die Deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und „arischer“ Abstammung sein. Der Erbhof war<br />
unveräußerlich, unbelastbar und unteilbar. Der Erbe war <strong>der</strong> älteste Sohn.<br />
19