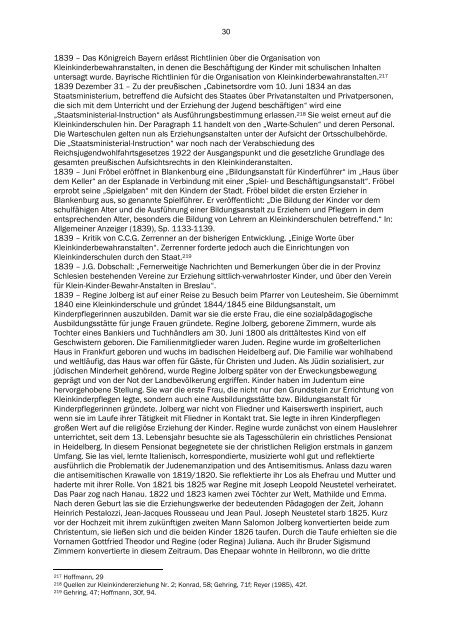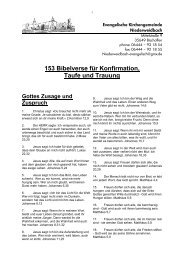Zeittafel zur Kindergartengeschichte - F-rudolph
Zeittafel zur Kindergartengeschichte - F-rudolph
Zeittafel zur Kindergartengeschichte - F-rudolph
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
30<br />
1839 – Das Königreich Bayern erlässt Richtlinien über die Organisation von<br />
Kleinkinderbewahranstalten, in denen die Beschäftigung der Kinder mit schulischen Inhalten<br />
untersagt wurde. Bayrische Richtlinien für die Organisation von Kleinkinderbewahranstalten. 217<br />
1839 Dezember 31 – Zu der preußischen „Cabinetsordre vom 10. Juni 1834 an das<br />
Staatsministerium, betreffend die Aufsicht des Staates über Privatanstalten und Privatpersonen,<br />
die sich mit dem Unterricht und der Erziehung der Jugend beschäftigen“ wird eine<br />
„Staatsministerial-Instruction“ als Ausführungsbestimmung erlassen. 218 Sie weist erneut auf die<br />
Kleinkinderschulen hin. Der Paragraph 11 handelt von den „Warte-Schulen“ und deren Personal.<br />
Die Warteschulen gelten nun als Erziehungsanstalten unter der Aufsicht der Ortsschulbehörde.<br />
Die „Staatsministerial-Instruction“ war noch nach der Verabschiedung des<br />
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes 1922 der Ausgangspunkt und die gesetzliche Grundlage des<br />
gesamten preußischen Aufsichtsrechts in den Kleinkinderanstalten.<br />
1839 – Juni Fröbel eröffnet in Blankenburg eine „Bildungsanstalt für Kinderführer“ im „Haus über<br />
dem Keller“ an der Esplanade in Verbindung mit einer „Spiel- und Beschäftigungsanstalt“. Fröbel<br />
erprobt seine „Spielgaben“ mit den Kindern der Stadt. Fröbel bildet die ersten Erzieher in<br />
Blankenburg aus, so genannte Spielführer. Er veröffentlicht: „Die Bildung der Kinder vor dem<br />
schulfähigen Alter und die Ausführung einer Bildungsanstalt zu Erziehern und Pflegern in dem<br />
entsprechenden Alter, besonders die Bildung von Lehrern an Kleinkinderschulen betreffend.“ In:<br />
Allgemeiner Anzeiger (1839), Sp. 1133-1139.<br />
1839 – Kritik von C.C.G. Zerrenner an der bisherigen Entwicklung. „Einige Worte über<br />
Kleinkinderbewahranstalten“. Zerrenner forderte jedoch auch die Einrichtungen von<br />
Kleinkinderschulen durch den Staat. 219<br />
1839 – J.G. Dobschall: „Fernerweitige Nachrichten und Bemerkungen über die in der Provinz<br />
Schlesien bestehenden Vereine <strong>zur</strong> Erziehung sittlich-verwahrloster Kinder, und über den Verein<br />
für Klein-Kinder-Bewahr-Anstalten in Breslau“.<br />
1839 – Regine Jolberg ist auf einer Reise zu Besuch beim Pfarrer von Leutesheim. Sie übernimmt<br />
1840 eine Kleinkinderschule und gründet 1844/1845 eine Bildungsanstalt, um<br />
Kinderpflegerinnen auszubilden. Damit war sie die erste Frau, die eine sozialpädagogische<br />
Ausbildungsstätte für junge Frauen gründete. Regine Jolberg, geborene Zimmern, wurde als<br />
Tochter eines Bankiers und Tuchhändlers am 30. Juni 1800 als drittältestes Kind von elf<br />
Geschwistern geboren. Die Familienmitglieder waren Juden. Regine wurde im großelterlichen<br />
Haus in Frankfurt geboren und wuchs im badischen Heidelberg auf. Die Familie war wohlhabend<br />
und weltläufig, das Haus war offen für Gäste, für Christen und Juden. Als Jüdin sozialisiert, <strong>zur</strong><br />
jüdischen Minderheit gehörend, wurde Regine Jolberg später von der Erweckungsbewegung<br />
geprägt und von der Not der Landbevölkerung ergriffen. Kinder haben im Judentum eine<br />
hervorgehobene Stellung. Sie war die erste Frau, die nicht nur den Grundstein <strong>zur</strong> Errichtung von<br />
Kleinkinderpflegen legte, sondern auch eine Ausbildungsstätte bzw. Bildungsanstalt für<br />
Kinderpflegerinnen gründete. Jolberg war nicht von Fliedner und Kaiserswerth inspiriert, auch<br />
wenn sie im Laufe ihrer Tätigkeit mit Fliedner in Kontakt trat. Sie legte in ihren Kinderpflegen<br />
großen Wert auf die religiöse Erziehung der Kinder. Regine wurde zunächst von einem Hauslehrer<br />
unterrichtet, seit dem 13. Lebensjahr besuchte sie als Tagesschülerin ein christliches Pensionat<br />
in Heidelberg. In diesem Pensionat begegnetete sie der christlichen Religion erstmals in ganzem<br />
Umfang. Sie las viel, lernte Italienisch, korrespondierte, musizierte wohl gut und reflektierte<br />
ausführlich die Problematik der Judenemanzipation und des Antisemitismus. Anlass dazu waren<br />
die antisemitischen Krawalle von 1819/1820. Sie reflektierte ihr Los als Ehefrau und Mutter und<br />
haderte mit ihrer Rolle. Von 1821 bis 1825 war Regine mit Joseph Leopold Neustetel verheiratet.<br />
Das Paar zog nach Hanau. 1822 und 1823 kamen zwei Töchter <strong>zur</strong> Welt, Mathilde und Emma.<br />
Nach deren Geburt las sie die Erziehungswerke der bedeutenden Pädagogen der Zeit, Johann<br />
Heinrich Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau und Jean Paul. Joseph Neustetel starb 1825. Kurz<br />
vor der Hochzeit mit ihrem zukünftigen zweiten Mann Salomon Jolberg konvertierten beide zum<br />
Christentum, sie ließen sich und die beiden Kinder 1826 taufen. Durch die Taufe erhielten sie die<br />
Vornamen Gottfried Theodor und Regine (oder Regina) Juliana. Auch ihr Bruder Sigismund<br />
Zimmern konvertierte in diesem Zeitraum. Das Ehepaar wohnte in Heilbronn, wo die dritte<br />
217 Hoffmann, 29<br />
218 Quellen <strong>zur</strong> Kleinkindererziehung Nr. 2; Konrad, 58; Gehring, 71f; Reyer (1985), 42f.<br />
219 Gehring, 47; Hoffmann, 30f, 94.