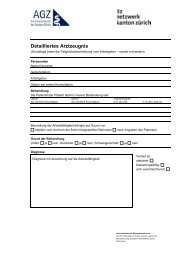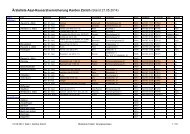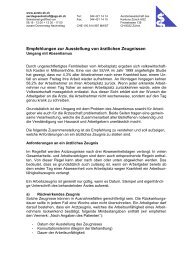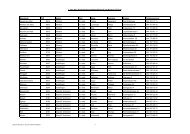Jahresbericht 2004 - Ärztegesellschaft Zürich
Jahresbericht 2004 - Ärztegesellschaft Zürich
Jahresbericht 2004 - Ärztegesellschaft Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ressort Spitalwesen<br />
Bericht von Prof. Dr. med. Peter Jaeger<br />
Gesundheitsökonomie<br />
An der Zürcher Hochschule Winterthur wird das Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) geführt,<br />
welches ursprünglich durch einen Förderverein lanciert und von diesem unterstützt wird.<br />
Nutzenforschung und evidence based medicine (EBM) stellen ein zentrales Anliegen dar. Auch<br />
die ÄrzteGesellschaft des Kantons <strong>Zürich</strong> ist Mitglied dieses Vereins und unterstützt diesen als<br />
Sponsor mit einem jährlichen Beitrag von CHF 5000.--. Im August hat der Präsident des Fördervereins,<br />
Luzi Dubs, für den Vorstand der AGZ ein EBM-Seminar durchgeführt, welches auf<br />
grosses Interesse gestossen ist und im Vorstand zur Überzeugung geführt hat, dass das EBM-<br />
Projekt vermehrt zu unterstützen sei. Ebenso das WIG in seinen Bemühungen zur Verbesserung<br />
seines Bekanntheitsgrades mit dem Ziel, eine noch breitere Verankerung in der Ärzteschaft zu<br />
erreichen.<br />
Spitalärzteorganisationen (VLSS/VSAO)<br />
Den Spitalärzten kommt eine immer grössere Bedeutung im Gesundheitswesen zu. Aus diesem<br />
Grunde streben der Verein der Leitenden Spitalärzte und -ärztinnen der Schweiz (VLSS) und der<br />
Verein der Assistenz- und Oberärzte und -ärztinnen) VSAO eine engere Kooperation, allenfalls<br />
ein künftiges Zusammengehen, an. Schon heute wird nicht mehr ausgeschlossen, dass man in<br />
gewissen Sachfragen gemeinsam mit den Assistenten agieren wird. Eine Mehrheit des VLSS<br />
spricht sich für eine Annäherung mit dem VSAO aus. Von der Sache her braucht die Annäherung<br />
Zeit. Konkrete Beschlüsse sind noch keine gefasst worden.<br />
Sanierungsprogramm 04 der Gesundheitsdirektion<br />
Angesichts der angespannten Finanzlage des Kantons <strong>Zürich</strong> hat der Regierungsrat im Jahre<br />
2003 ein Sanierungsprogramm beschlossen, dass den Staatshaushalt um CHF 2,8 Milliarden<br />
entlasten soll. Der Entlastungsbeitrag der Gesundheitsdirektion beläuft sich bis Ende 2007 im<br />
Aufwand auf insgesamt CHF 286 Millionen. Von den Massnahmen sind die Gesundheitsdirektion<br />
selbst, Ämter, Spitäler und die Psychiatrie betroffen. Der Anteil der Psychiatrie beläuft<br />
sich auf 170 Mio. Franken. Die Massnahmen umfassen in diesem Bereich den Entzug des Leistungsauftrages<br />
der Klinik Hohenegg, geplant auf 01.01.2005 sowie den Verzicht auf den vollen<br />
Ausbau des gerontopsychiatrischen Angebots bei der Integrierten Psychiatrie Winterthur (IPW).<br />
Im Bereich der somatischen Medizin soll nebst den Kapazitätsanpassungen in allen Kliniken<br />
die Effizienz gesteigert, geplante Ausbauvorhaben nicht realisiert und die Qualitätsstandards<br />
angepasst werden. Die Massnahmen bedingen einen Abbau von insgesamt bis zu 345 Stellen.<br />
Dem Beschluss gingen eine Vernehmlassung und eine Würdigung der unterschiedlichen Standpunkte<br />
voraus. Die zur Schliessung der Hohenegg verfasste Vernehmlassungsantwort der AGZ<br />
umfasste einen Pro- sowie einen Kontra-Anteil, da die eingegangenen Stellungnahmen keine<br />
einhellige Meinung zur Thematik ergeben hatten.<br />
Taxordnung für den Kanton <strong>Zürich</strong><br />
Im Juni ist von der Gesundheitsdirektion die neue Taxordnung (TO) für den Kanton <strong>Zürich</strong><br />
vorgestellt worden. Diese beinhaltet im Wesentlichen die gleiche Regelung wie die für das<br />
Kantonsspital Winterthur seit längerer Zeit gültige Taxordnung. Neu hinzugekommen ist die<br />
Regelung für die Psychiatrischen Kliniken. Zudem wurden die in der Taxordnung vorgesehenen<br />
und den Versicherern verrechneten Vollkosten präzisiert. Die Kosten für Lehre und Forschung<br />
werden in den Vollkosten neu mit berücksichtigt (sofern sie nicht von Dritten übernommen<br />
werden). Diese Regelung wird allerdings von den Versicherern bekämpft. Die neue Taxordnung<br />
enthält im Wesentlichen die folgenden Punkte: Bei den ambulanten Leistungskategorien sollen<br />
neben den Basisleistungen auch Zusatzleistungen eingeführt werden können (Kategorie ambulant<br />
privat). Im Hinblick auf die Abteilungen wird definiert, dass der Patient in der Allgemeinen<br />
Abteilung keine Wahlmöglichkeit hat. In der HP-Abteilung hat er Anspruch auf ein 2er Zimmer<br />
und die Behandlung durch einen Leitenden Arzt oder Facharzt. In der P-Abteilung besteht ein<br />
Anspruch auf ein 1er Zimmer und die Behandlung durch den Chefarzt. Im Bereich der Taxen sind<br />
Zuschläge für Patientinnen und Patienten ohne Tarifschutz sowie für HP- und P-versicherte Patientinnen<br />
und Patienten vorgesehen. Auch Sonderleistungen und das ärztliche Zusatzhonorar<br />
sind in der Taxordnung verankert.<br />
Gesetz über die ärztlichen Zusatzhonorare<br />
Nach Abschluss der Vernehmlassung hat die Regierung Ende August einen revidierten Gesetzesentwurf<br />
über die ärztlichen Zusatzhonorare zur Beratung in die kantonsrätliche Kommission<br />
für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) überwiesen. Im Rahmen der Beratungen der kantonsrätlichen<br />
Kommissionen wurden verschiedene Interessengruppen angehört. Das Ergebnis<br />
ist offen, Beratungen im Kantonsrat zu diesem Gesetz haben bisher nicht stattgefunden. Die<br />
AGZ und die Chefärzte-Gesellschaft des Kantons <strong>Zürich</strong> hatten sich vorsichtig positiv zu der<br />
Vorlage geäussert. Im Anschluss an diese Reaktionen hatte sich eine IG-Spitalärzte gemeldet<br />
und den Widerstand gegen die aktuelle Vorlage formiert. Aus der Sicht der AGZ ist die<br />
Kommunikation zu diesem Thema innerhalb der Ärzteschaft nicht optimal gelaufen. Die AGZ<br />
möchte die Interessen aller ihrer Mitglieder vertreten. Dafür muss sie die Interessen aber auch<br />
kennen.<br />
Tarifwesen<br />
Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 31.08.<strong>2004</strong> (Krankenversicherung Helsana gegen den<br />
Kanton Baselstadt) entschieden, dass in staatlichen Spitälern höhere Tarife für den Aufenthalt<br />
und die medizinische Behandlung von Privatpatienten zulässig sind. Damit ist die Frage der Zulässigkeit<br />
einer Erhebung von Privattarifen auf bundesgerichtlicher Ebene entschieden worden.<br />
Die freie Arztwahl im stationären Bereich stellt nach Ansicht des Bundesgerichts eine ganz<br />
erhebliche Mehrleistung dar, die weit über die obligatorische Krankenversicherung hinausgeht.<br />
Der Tarifschutz gemäss Artikel 44 KVG beschränkt sich hier darauf, dass die Versicherung nach<br />
KVG jene Positionen übernehmen muss, welche sich ergeben würden, wenn der Versicherte<br />
in der allgemeinen Abteilung behandelt worden wäre. Ein Honorarzuschlag bei stationären<br />
Privatpatienten ist somit gerechtfertigt, zumal die Privatpatienten-Tarife im stationären Bereich<br />
die Rechte und Behandlungsmöglichkeiten der allgemeinversicherten Personen nicht beeinträchtigen.<br />
Das Bundesgericht führte in seiner Begründung aus, dass das KVG innerhalb örtlicher<br />
Grenzen jedem Versicherten die freie Arztwahl garantiere. Hingegen statuiere es ausser<br />
in Notfällen keine Behandlungspflicht für Ärzte, weshalb im stationären Bereich faktisch nur<br />
Patienten mit einer Zusatzversicherung die freie Arztwahl hätten. Diese freie Arztwahl führe<br />
dazu, dass Chefärzte insbesondere bei Privatpatienten Leistungen erbringen, für welche sie<br />
eigentlich überqualifiziert sind. Zudem sei es allgemein bekannt, dass Privatpatienten andere<br />
Erwartungen an den behandelnden Arzt stellen. Die freie Arztwahl wird vom Bundesgericht<br />
52 53