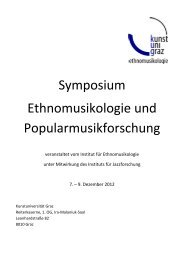die schwegelpfeife - Institut 13: Ethnomusikologie - Universität für ...
die schwegelpfeife - Institut 13: Ethnomusikologie - Universität für ...
die schwegelpfeife - Institut 13: Ethnomusikologie - Universität für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Andrea Wolfsteiner Historie 14<br />
Abb.9: Schwegelpfeifen nach<br />
Martin Agricolas Instrumentenkunde von 1528<br />
Beide Autoren unterscheiden noch nicht zwischen Querflöte und Querpfeife. Dies passiert<br />
erst 1619, als Michael Praetorius mit seinem Werk Syntagma musicum, als erster ganz<br />
klar <strong>die</strong> „Querpfeiffen“ (=Querflöten) von den „Schweitzer- oder Feldpfeiffen“ abgrenzt:<br />
„Hieher gehöret auch <strong>die</strong> Schweizerpfeiff/sonste Feldpfeiff genand/ (in Sciagr.col.XXIII.)<br />
<strong>die</strong>selbige hat ihre absonderliche Griffe/ welche mit der Querflötten ganz nicht übereinkommet<br />
...“ 30 Die Familie der Schweitzerpfeife (Schweitzer-Pfeiff) teilt er ein in: 31<br />
Diskant d’’ (c’’),Tenor g’ und Baß d’, deren Längenmaße er mit 20, 26 und 30 Zoll angibt.<br />
Auf zahlreichen Gemälden jener Zeit (um 1500) sind somit Diskantinstrumente abgebildet,<br />
jedoch finden sich auch Kunstwerke auf italienischem Boden, wo eindeutig Tenorschwegeln<br />
abgebildet sind, zum Beispiel auf der Anbetung der Engel Piero di Cosimo von 1497.<br />
Das einzige Exemplar eines Basses (Brüsseler Konservatorium Nr. 1022) stammt aus<br />
dem Besitz des Grafen Pietro Correr in Venedig, was <strong>die</strong> Vermutung zulässt, dass <strong>die</strong> tiefen<br />
Schwegelarten besonders in Italien heimisch waren.<br />
Im Gegensatz zur Querflöte, <strong>die</strong> sich in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts rasch weiterentwickelt<br />
(das Flötenrohr wird in drei oder vier Teile zerlegbar, konische Bohrung statt<br />
zylindrische, Einführung der Dis-Klappe), bleibt <strong>die</strong> Schwegelpfeife in ihrer Bauweise<br />
gleich (einteiliges Rohr mit zylindrischer Bohrung, sechs Grifflöcher und kreisrundem<br />
Mundloch). Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde <strong>die</strong> Schwegelpfeife oftmals konisch gebaut<br />
und erhielt zusätzlich ein Kleinfingerloch <strong>für</strong> den Ton Es, das offen in einen Block<br />
gebohrt oder mit einer Deckklappe versehen wurde. 32<br />
30 Praetorius 1619, 35.<br />
31 Benedikt, Erich, Über Querflöten, Querpfeifen und Seitlpfeifen, in: Musikerziehung 26/1972, 154.<br />
32 Sachs 1990, 312.