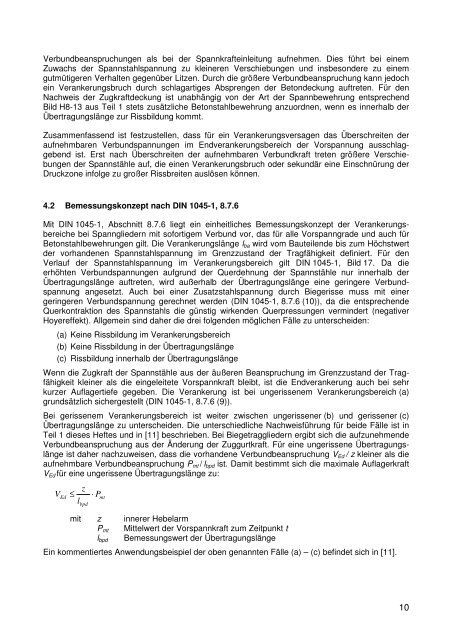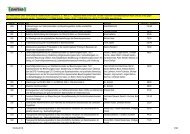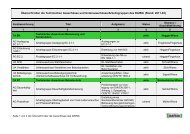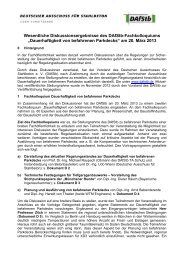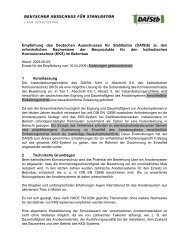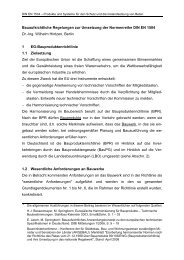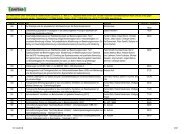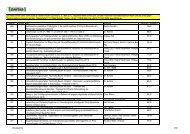cd - DAfStB
cd - DAfStB
cd - DAfStB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Verbundbeanspruchungen als bei der Spannkrafteinleitung aufnehmen. Dies führt bei einem<br />
Zuwachs der Spannstahlspannung zu kleineren Verschiebungen und insbesondere zu einem<br />
gutmütigeren Verhalten gegenüber Litzen. Durch die größere Verbundbeanspruchung kann jedoch<br />
ein Verankerungsbruch durch schlagartiges Absprengen der Betondeckung auftreten. Für den<br />
Nachweis der Zugkraftdeckung ist unabhängig von der Art der Spannbewehrung entsprechend<br />
Bild H8-13 aus Teil 1 stets zusätzliche Betonstahlbewehrung anzuordnen, wenn es innerhalb der<br />
Übertragungslänge zur Rissbildung kommt.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass für ein Verankerungsversagen das Überschreiten der<br />
aufnehmbaren Verbundspannungen im Endverankerungsbereich der Vorspannung ausschlaggebend<br />
ist. Erst nach Überschreiten der aufnehmbaren Verbundkraft treten größere Verschiebungen<br />
der Spannstähle auf, die einen Verankerungsbruch oder sekundär eine Einschnürung der<br />
Druckzone infolge zu großer Rissbreiten auslösen können.<br />
4.2 Bemessungskonzept nach DIN 1045-1, 8.7.6<br />
Mit DIN 1045-1, Abschnitt 8.7.6 liegt ein einheitliches Bemessungskonzept der Verankerungsbereiche<br />
bei Spanngliedern mit sofortigem Verbund vor, das für alle Vorspanngrade und auch für<br />
Betonstahlbewehrungen gilt. Die Verankerungslänge lba wird vom Bauteilende bis zum Höchstwert<br />
der vorhandenen Spannstahlspannung im Grenzzustand der Tragfähigkeit definiert. Für den<br />
Verlauf der Spannstahlspannung im Verankerungsbereich gilt DIN 1045-1, Bild 17. Da die<br />
erhöhten Verbundspannungen aufgrund der Querdehnung der Spannstähle nur innerhalb der<br />
Übertragungslänge auftreten, wird außerhalb der Übertragungslänge eine geringere Verbundspannung<br />
angesetzt. Auch bei einer Zusatzstahlspannung durch Biegerisse muss mit einer<br />
geringeren Verbundspannung gerechnet werden (DIN 1045-1, 8.7.6 (10)), da die entsprechende<br />
Querkontraktion des Spannstahls die günstig wirkenden Querpressungen vermindert (negativer<br />
Hoyereffekt). Allgemein sind daher die drei folgenden möglichen Fälle zu unterscheiden:<br />
(a) Keine Rissbildung im Verankerungsbereich<br />
(b) Keine Rissbildung in der Übertragungslänge<br />
(c) Rissbildung innerhalb der Übertragungslänge<br />
Wenn die Zugkraft der Spannstähle aus der äußeren Beanspruchung im Grenzzustand der Tragfähigkeit<br />
kleiner als die eingeleitete Vorspannkraft bleibt, ist die Endverankerung auch bei sehr<br />
kurzer Auflagertiefe gegeben. Die Verankerung ist bei ungerissenem Verankerungsbereich (a)<br />
grundsätzlich sichergestellt (DIN 1045-1, 8.7.6 (9)).<br />
Bei gerissenem Verankerungsbereich ist weiter zwischen ungerissener (b) und gerissener (c)<br />
Übertragungslänge zu unterscheiden. Die unterschiedliche Nachweisführung für beide Fälle ist in<br />
Teil 1 dieses Heftes und in [11] beschrieben. Bei Biegetraggliedern ergibt sich die aufzunehmende<br />
Verbundbeanspruchung aus der Änderung der Zuggurtkraft. Für eine ungerissene Übertragungslänge<br />
ist daher nachzuweisen, dass die vorhandene Verbundbeanspruchung VEd / z kleiner als die<br />
aufnehmbare Verbundbeanspruchung Pmt / lbpd ist. Damit bestimmt sich die maximale Auflagerkraft<br />
VEd für eine ungerissene Übertragungslänge zu:<br />
z<br />
VEd ≤ ⋅ P<br />
l<br />
bpd<br />
mt<br />
mit z innerer Hebelarm<br />
Pmt Mittelwert der Vorspannkraft zum Zeitpunkt t<br />
lbpd Bemessungswert der Übertragungslänge<br />
Ein kommentiertes Anwendungsbeispiel der oben genannten Fälle (a) – (c) befindet sich in [11].<br />
10