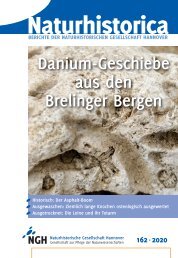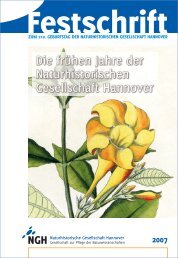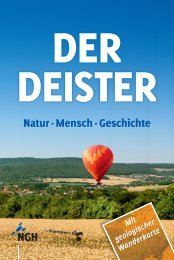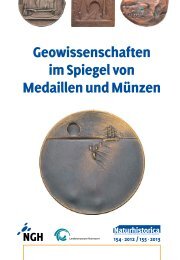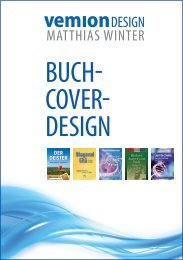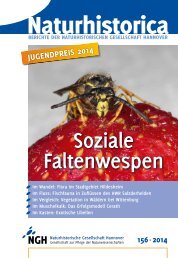Naturhistorica 151
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Ameisenfauna der Hannoverschen Moorgeest<br />
149<br />
hervorgehoben werden.<br />
Übersehen wurden bei der vorliegenden<br />
Untersuchung möglicherweise Formicoxenus<br />
nitidulus Nylander 1846, Myrmica<br />
lobicornis Nylander 1846, Formica<br />
truncorum Fabricius 1804 und mit großer<br />
Wahrscheinlichkeit Lasius flavus, die jedoch<br />
nicht die Hochmoorlebensräume im<br />
engeren Sinne, sondern Randbiotope charakterisieren.<br />
Bedeutung der Hochmoore für den Ameisenschutz und<br />
Berücksichtigung der Ameisenfauna bei Pflege- und<br />
Entwicklungsmaßnahmen<br />
In den Mooren der Hannoverschen<br />
Moorgeest wurden bislang 37 Prozent der<br />
landesweiten Ameisenfauna (70 Arten, vgl.<br />
Sonnenburg 2005) nachgewiesen. Angesichts<br />
der Tatsache, dass die meisten Ameisenarten<br />
zumindest tendenziell eher xerotherm<br />
getönte Lebensräume bevorzugen,<br />
ist dies für eine Moorgegend ein durchaus<br />
beachtlicher Wert.<br />
Aus naturschutzfachlicher Sicht sollten<br />
gefährdete und/oder seltene Arten besonders<br />
berücksichtigt werden. Insbesondere<br />
sollten gefährdete Leitarten der Hochmoore<br />
gefördert werden. In diesem Falle<br />
fällt diese Eigenschaft nur Formica picea<br />
zu. Aus den oben ewähnten Gründen (siehe<br />
Kapitel Kommentierte Artenliste) sollten<br />
im Rahmen einer Ameisenerfassung neben<br />
den Bodenfallenuntersuchungen gezielte<br />
manuelle Nachsuchen erfolgen. Dann ließe<br />
sich anhand der wichtigen Indikatorart F.<br />
picea zeigen, dass Ameisen hinsichtlich der<br />
Praktikabilität im Rahmen von faunistischen<br />
Moorstudien anderen Wirbellosengruppen<br />
(z. B. Faltern oder Agonum ericeti)<br />
deutlich überlegen sein können. Es genügt<br />
eine einzige Begehung zu einem beliebigen<br />
Zeitpunkt zwischen April und September/<br />
Oktober, um diese wichtige Indikator-Art<br />
nachzuweisen und zumindest ungefähre<br />
Angaben zu ihrer Häufigkeit zu machen.<br />
Insofern ist der vergleichsweise geringe<br />
Stellenwert, der den Ameisen von Finck et<br />
al. (1992) im Rahmen von Moorprojekten<br />
zugesprochen wurde (siehe Einleitung), zu<br />
hinterfragen.<br />
Eine niederländische Studie legt nahe,<br />
dass das Ausbreitungsvermögen von F. picea<br />
gering ist und Weibchen meist nicht<br />
weiter als 1 km fliegen (Mabelis & Chardon<br />
2005). Ein genetischer Austausch<br />
zwischen den Teilpopulationen ist jedoch<br />
wichtig, um das Aussterberisiko der Art zu<br />
minimieren. Da Hochmoore und Sphagnum-reiche<br />
Feuchtheiden nicht künstlich<br />
angelegt werden können, kann die Situation<br />
für die stark gefährdete F. picea nur<br />
durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen<br />
verbessert werden. Hierzu zählen die<br />
Vergrößerung von Habitat-Inseln und die<br />
Schaffung von Voraussetzungen für weitere<br />
Trittsteine. Es ist davon auszugehen,<br />
dass F. picea als typische Moorart mit geringer<br />
Schattentoleranz von schonenden<br />
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes<br />
und von einer Zurückdrängung<br />
des Moorwaldes in den Bereichen,<br />
wo sie derzeit noch fehlt oder noch bzw.<br />
schon selten ist, profitieren würde. Zum<br />
einen würden für die Art besiedelbare Bereiche<br />
zunehmen, zum anderen würde die<br />
potenzielle Konkurrenz durch die euryöke<br />
Formica fusca deutlich verringert, denn<br />
diese Art reagiert auf Vernässung empfindlich.<br />
Die Bereiche HM-07.1 und HM-<br />
07.3, wo F. picea vorkommt, werden bereits<br />
<strong>Naturhistorica</strong> BERICHTE DER NATURHISTORISCHEN GESELLSCHAFT HANNOVER <strong>151</strong> · 2009