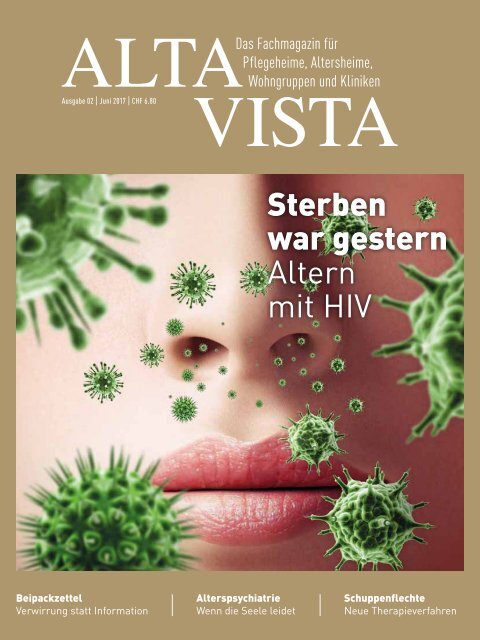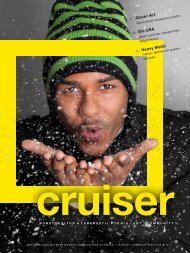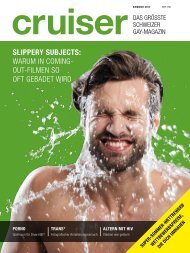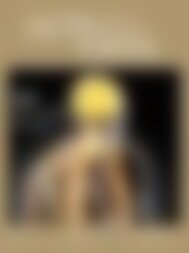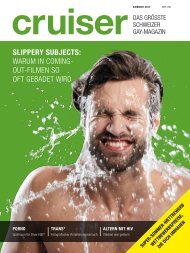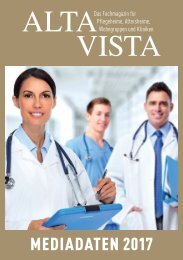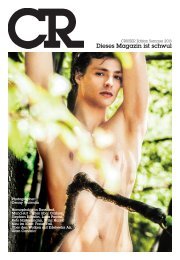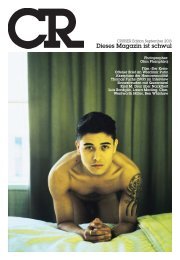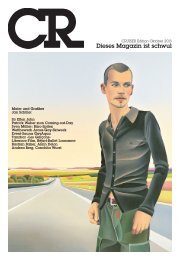AltaVista Juni 2017
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe 02 | <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> | CHF 6.80<br />
Sterben<br />
war gestern<br />
Altern<br />
mit HIV<br />
Beipackzettel<br />
Verwirrung statt Information<br />
Alterspsychiatrie<br />
Wenn die Seele leidet<br />
Schuppenflechte<br />
Neue Therapieverfahren<br />
XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 1
Impressum<br />
Editorial<br />
Inhalt<br />
Weil Gesundheit<br />
das Wichtigste<br />
bleiben muss<br />
Wie können wir Ärzten helfen, Patienten zu heilen,<br />
und gleichzeitig dafür sorgen, Medizin bezahlbar zu<br />
halten? Diese Frage stellen wir uns jeden Tag aufs Neue.<br />
Dafür forschen wir und entwickeln Medizintechnik, die<br />
innovative Diagnose- und Therapieverfahren möglich<br />
macht und darüber hinaus hilft, die Kosten im Gesundheitswesen<br />
zu minimieren. So verkürzen wir Untersuchungszeiten,<br />
vereinfachen Diagnosen und entlasten<br />
medizinisches Personal, damit mehr Zeit für das Wesentliche<br />
bleibt: den Patienten.<br />
Chefredaktion<br />
Peter Empl<br />
Herausgeber<br />
Naeim Said<br />
Autoren dieser Ausgabe<br />
Yvonne Beck<br />
Peter Empl<br />
Ulrich Erlinger<br />
Doreen Fiedler<br />
Ingo Haase<br />
Christoph Held<br />
Stephan Inderbizin<br />
Verena Malz<br />
Maren Nielsen<br />
Stéphane Praz<br />
Art Direction<br />
Nicole Senn | nicolesenn.ch<br />
Korrektorat<br />
Birgit Kawohl<br />
Bildredaktion<br />
Peter Empl & Nicole Senn<br />
Web<br />
www.altavistamagazin.ch<br />
redaktion@altavistamagazin.ch<br />
Administration & Anzeigen<br />
Telefon 044 709 09 06<br />
anzeigen@altavistamagazin.ch<br />
Nächste Ausgabe<br />
7. Juli <strong>2017</strong><br />
Druckauflage<br />
30 000 Ex.<br />
<strong>AltaVista</strong> ist in der Schweiz als<br />
Marke eingetragen.<br />
ISSN:<br />
2504-3358<br />
Naeim Said<br />
Herausgeber<br />
Peter Empl<br />
Chefredaktor<br />
D<br />
ie Medizin macht rasante<br />
Fortschritte. Waren HIV und<br />
AIDS vor wenigen Jahren<br />
noch ein Todesurteil, ist es<br />
dank der heutigen Therapien möglich,<br />
meist weitgehend normal zu<br />
leben. Was immer «normal» auch<br />
heissen mag. Dennoch gibt es noch<br />
keine Langzeiterfahrungen mit der<br />
Krankheit, entsprechend hoch ist<br />
die Verunsicherung für alle Beteiligten.<br />
Wie altert man mit dieser<br />
Krankheit, die weitestgehend symptomfrei<br />
abläuft? Welche Wechselwirkungen<br />
können sich mit anderen<br />
Medikamenten ergeben? Unser Interview<br />
in der Titelgeschichte zeigt,<br />
dass genau das momentan erforscht<br />
wird. Und wenn wir schon<br />
bei «Wechselwirkungen» sind: Dieses<br />
Thema vertiefen wir mit unserer<br />
Geschichte «Vorsicht, Beipackzettel»<br />
– denn nach wie vor ist dieser<br />
für Laien (und manchmal auch für<br />
Fachleute) alles andere als eine<br />
klare Informationsquelle. Viele<br />
spannende Themen also in dieser<br />
neuen Ausgabe von <strong>AltaVista</strong> und<br />
natürlich freuen wir uns auch über<br />
Ihre Leser-Inputs!<br />
Herzlich<br />
Naeim Said, Herausgeber &<br />
Peter Empl, Chefredaktor<br />
4<br />
9<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
19<br />
20<br />
22<br />
26<br />
30<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
|<br />
Thema<br />
Altern mit HIV<br />
Kolumne<br />
Dr. Christoph Held<br />
Wissenschaft<br />
Geruchssinn<br />
News<br />
Gesehen & gehört<br />
Multiresistente Erreger<br />
neue Erkenntnisse<br />
Forschung<br />
Schuppenflechte<br />
Forschung<br />
Schmerztherapie<br />
O r g a n e<br />
Aus dem 3D-Drucker<br />
Fokus<br />
Alterspsychiatrie<br />
Palliative<br />
Care<br />
Info<br />
nATional & International<br />
www.altavistamagazin.ch<br />
32<br />
|<br />
Beipackzettel<br />
fragwürdiger Nutzen<br />
Erfahren Sie mehr unter:<br />
www.philips.ch/gesundheit<br />
2 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> XXX XXX Inhalt <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 3
Sterben war gestern.<br />
Altern mit HIV<br />
Dank moderner Medikamente haben HIV-Patienten eine fast ebenso hohe<br />
Lebenserwartung wie gesunde Menschen. So kann ein 20-Jähriger, der nach 2008<br />
mit einer HIV-Behandlung begonnen hat, statistisch gesehen 78 Jahre alt werden.<br />
Peter Empl / Interview von Lic. phil. Stéphane Praz*<br />
I<br />
nsgesamt verlängerte sich die Lebensspanne<br />
der nach 2008 behandelten<br />
Aids-Kranken um zehn Jahre,<br />
wie aus einer Studie in der<br />
Fachzeitschrift «The Lancet HIV»<br />
vom hervorgeht.<br />
An der Immunschwächekrankheit<br />
Aids erkrankte Menschen, die ihre Behandlung<br />
2008 oder später begonnen haben,<br />
leben der Studie zufolge länger und<br />
gesünder. Dies liegt zum einen daran, dass<br />
moderne Medikamente weniger Nebenwirkungen<br />
haben, zum anderen daran, dass es<br />
heute mehr Behandlungsmöglichkeiten für<br />
HIV-Infizierte mit Resistenzen gibt. Ferner<br />
könnten parallel auftretende Probleme wie<br />
Herzkrankheiten, Hepatitis C und Krebs<br />
besser behandelt werden, hiess es weiter.<br />
Für die Studie werteten die Forscher<br />
der britischen Universität Bristol Daten von<br />
mehr als 80 000 HIV-Patienten aus Europa<br />
und den USA aus. Die daraus gewonnenen<br />
Erkenntnisse seien wichtig, um Risikopersonen<br />
zu Aids-Tests zu ermutigen, erklärten<br />
die Wissenschaftler.<br />
Diejenigen, die sich mit dem HI-Virus<br />
infiziert hätten, könnten zudem besser<br />
überzeugt werden, sofort eine antiretrovirale<br />
Therapie zu beginnen. Auch könnte die<br />
gestiegene Lebenserwartung dazu beitragen,<br />
dass HIV-Kranke weniger stigmatisiert<br />
würden und bessere Jobchancen hätten,<br />
hiess es in der Studie weiter.<br />
Dennoch steht die Krankheit im Verdacht,<br />
den «Alterungsprozess» zu beschleunigen.<br />
Daher: Altern HIV-positive<br />
Menschen schneller? Wenn ja: alle? Auch<br />
in der Schweiz wird diesbezüglich geforscht.<br />
Es ist eine Tatsache, dass eine HIV-<br />
Infektion schon seit geraumer Zeit sehr<br />
erfolgreich behandelt werden kann,<br />
nur fehlen – immerhin war das Krankheitsbild<br />
AIDS bis weit in die 1990er Jahre<br />
tödlich – noch Langzeiterfahrungen mit<br />
Patienten, welche mit den entsprechenden<br />
Medikamenten gute Behandlungserfolge<br />
erzielen.<br />
Viele Fragen sind also nach wie vor<br />
ungeklärt, rund um das Thema «HIV und<br />
Alter». Die wenigen Antworten dazu können<br />
zudem kaum generalisiert werden. Nun<br />
will die Studie «Metabolismus und Aging»,<br />
kurz M+A, zu fundierten Erkenntnissen<br />
gelangen. Wie das gelingen soll und welche<br />
Herausforderungen sich dabei stellen, erklärt<br />
Studienleiterin Helen Kovari im Interview.<br />
Frau Kovari, wie funktioniert die<br />
«Metabolismus und Aging» Studie?<br />
Helen Kovari: Das Prinzip ist einfach: Wir<br />
messen bei tausend HIV-Patienten, die<br />
mindestens 45 Jahre alt sind, verschiedene<br />
Werte wie Knochendichte, Nierenfunktion<br />
sowie die geistige Fitness. Zwei Jahre später<br />
führen wir dieselben Tests nochmals<br />
durch und sehen dann, bei welchen Patienten<br />
die Leistungen am stärksten abgenommen<br />
haben, also der Alterungsprozess am<br />
schnellsten fortschreitet. Bei 400 Patienten<br />
messen wir zusätzlich, ob Verengungen<br />
oder Verkalkungen der Herzkranzgefässe<br />
vorliegen und wie rasch diese innerhalb der<br />
zwei Jahre fortschreiten. Diese Werte vergleichen<br />
wir mit einer Kontrollgruppe<br />
HIV-negativer Personen.<br />
Was ist das Spezielle an dieser Studie im<br />
Vergleich zu bisherigen Studien?<br />
In der M+A-Studie untersuchen wir verschiedene<br />
Organe gleichzeitig und über<br />
längere Zeit. So können wir diverse Befunde<br />
miteinander verknüpfen. Zum Beispiel<br />
werden wir untersuchen, ob Verkalkungen<br />
der Herzkranzgefässe einhergehen mit Abnutzungserscheinungen<br />
an den Knochen<br />
oder mit vorzeitig auftretender Demenz. ➔<br />
4 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Altern mit HIV<br />
Forschung Altern mit HIV <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 5
Zudem wird die Studie im Rahmen der<br />
Schweizerischen HIV-Kohortenstudie<br />
SHCS (vgl. Box) durchgeführt. Die SHCS<br />
ist im internationalen Vergleich eine besondere<br />
Kohorte. Sie repräsentiert die HIV-positive<br />
Bevölkerung sehr gut, da sie drei<br />
Viertel aller HIV-Patienten in der Schweiz<br />
umfasst: sowohl Frauen als auch Männer,<br />
Personen, die sich über Drogenkonsum angesteckt<br />
haben, über homosexuellen Geschlechtsverkehr<br />
oder über heterosexuellen<br />
sowie Migrantinnen und Migranten.<br />
Das ist bei anderen Studien nicht der<br />
Fall?<br />
Viele Studien werden nur in ganz bestimmten<br />
Gruppen durchgeführt, zum Beispiel in<br />
Kliniken, die vor allem Männer betreuen,<br />
die Sex mit Männern haben. In der Kohorte<br />
hingegen ist die HIV-positive Bevölkerung<br />
der Schweiz umfassend repräsentiert.<br />
Sie mussten also nicht extra nach<br />
Teilnehmern für die M+A-Studie suchen?<br />
HIV-Kohortenstudie<br />
Doch, auch in der SHCS müssen wir Patienten<br />
anfragen, ob sie an einer zusätzlichen<br />
Studie mitmachen. Wir benötigen ihre<br />
schriftliche Einwilligung. Für diese Studie<br />
war es aber relativ einfach, Teilnehmer zu<br />
rekrutieren. Das Interesse war sehr gross.<br />
In der Kohorte ist die<br />
HIV-positive Bevölkerung<br />
der Schweiz umfassend<br />
repräsentiert.<br />
Warum untersuchen Sie Patienten ab 45<br />
Jahren?<br />
Mit 45 Jahren können sich auf Organebene<br />
bereits Veränderungen zeigen. Das ist von<br />
Person zu Person aber unterschiedlich.<br />
Dass wir die Grenze bei 45 Jahren zogen,<br />
hat letztlich auch praktische Gründe. Hätten<br />
wir die Schwelle bei 60 gesetzt, dann<br />
hätten wir viel weniger Patienten einschliessen<br />
können. Ein bedeutender Vorteil<br />
dieser Studie ist die grosse Zahl an Teilnehmern<br />
sowie deren Zusammensetzung,<br />
die repräsentativ ist für die HIV-positiven<br />
Personen in der Schweiz. Das wird sich in<br />
den Resultaten spiegeln.<br />
Liegen bereits Resultate vor?<br />
Nein. Die erste Testreihe wurde erst im<br />
Spätsommer 2016 bei allen Teilnehmern<br />
abgeschlossen.<br />
Mit der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie steht eine stabile Infrastruktur zur Verfügung, innerhalb der sich immer wieder neue<br />
Fragen rund um HIV beantworten lassen. Auch zum Älterwerden mit HIV.<br />
Obwohl die Studie bereits 2013 begonnen<br />
hat?<br />
Die Vorbereitungen vor der eigentlichen<br />
Umsetzung waren sehr aufwändig. Das ist<br />
bei solchen Studien meistens der Fall. Wir<br />
haben zunächst ausgearbeitet, welche Werte<br />
wir mit welchen Methoden erheben.<br />
Dann musste der Studienplan vor die verschiedenen<br />
kantonalen Ethik-Kommissionen.<br />
Bis jedes der beteiligten Spitäler den<br />
entsprechenden Antrag gemacht hat, alle<br />
Formulare beisammen sind, die Erlaubnis<br />
erteilt ist, vergeht Zeit. Gleichzeitig mussten<br />
wir die Koordination zwischen den Spitälern<br />
organisieren, ebenso wie innerhalb<br />
der Spitäler die Zusammenarbeit mit all<br />
den Abteilungen, die in die Untersuchungen<br />
involviert sind.<br />
Die Tests werden nicht von HIV- Spezialisten<br />
durchgeführt?<br />
Nein, die machen die entsprechenden<br />
Fachärzte. Kardiologen führen die Computertomografie<br />
der Herzkranzgefässe<br />
durch, Rheumatologen messen die<br />
Knochendichte, Neurologen erheben die<br />
geistige Fitness. Die Durchführung der<br />
Untersuchungen für den einzelnen Teilnehmer<br />
braucht Zeit. Es ist eine Herausforderung,<br />
die Termine für alle Ärzte so<br />
zu legen, dass die Patienten nicht für jeden<br />
einzelnen Test extra ins Spital kommen<br />
müssen.<br />
Die Zusammenarbeit mit den anderen<br />
Kliniken, etwa mit der Kardiologie, der<br />
Neurologie und der Rheumatologie, ist sehr<br />
wichtig. Wir treffen uns regelmässig, um<br />
die Abläufe zu besprechen. Die Motivation<br />
der anderen Fachärzte ist gross. Auch sie<br />
sind der Meinung, dass die M+A-Studie ein<br />
wichtiges Projekt ist, um offene Fragen zu<br />
beantworten.<br />
Wie geht eine Untersuchung vonstatten?<br />
Für alle Tests bei einem Studienteilnehmer<br />
benötigen wir einen ganzen Tag. Wir nehmen<br />
Blut- und Urinproben (nüchtern) ab,<br />
ANZEIGE<br />
messen die Knochendichte, fahren eine koronare<br />
Computertomografie und erfassen<br />
mittels neuropsychologischer Testung die<br />
geistige Fitness. Bei der Verlaufsuntersuchung<br />
nach zwei Jahren führen wir zusätzlich<br />
ein Interview zu den Ernährungsgewohnheiten<br />
durch.<br />
«Für diese Studie war es<br />
relativ einfach, Teilnehmer<br />
zu rekrutieren. Das Interesse<br />
war sehr gross.»<br />
Verknüpfen Sie die erhaltenen Daten<br />
auch mit anderen Daten der Patienten?<br />
Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ein<br />
weiterer Vorteil unserer Studie. In der<br />
SHCS werden über längere Zeit viele zusätzliche<br />
Informationen erhoben. Ab Eintritt<br />
eines Patienten werden in der SHCS<br />
alle sechs Monate verschiedenste Daten<br />
erfasst: von HIV-spezifischen Daten wie<br />
CD4-Zellzahl, Viruslast und verschiedenen<br />
antiretroviralen Substanzen bis zu<br />
nicht-HIV-Medikamenten, Nikotin-, Alkohol-<br />
und Drogenkonsum. Auch Erkrankungen,<br />
die körperliche Tätigkeit und soziale<br />
Faktoren wie Partnerschaft und Arbeitstätigkeit<br />
halten wir fest. Diese Daten ermöglichen<br />
uns nun, verschiedene Faktoren zu<br />
untersuchen, die den Alterungsprozess beeinflussen.<br />
Damit gesehen werden kann, ob Menschen<br />
mit HIV schneller altern als die Allgemeinbevölkerung,<br />
muss mit einer negativen<br />
Kontrollgruppe verglichen werden …<br />
Für die Herzkranzgefässe-Untersuchung<br />
haben wir eine HIV-negative Kontrollgruppe.<br />
In dieser erfassen wir zusätzliche<br />
Informationen wie Risikofaktoren für<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Medikamenteneinnahme,<br />
körperliche Tätigkeit<br />
und weitere Informationen.<br />
Doch für die gesamte M+A-Studie<br />
haben wir keine HIV-negative Kontrollgruppe.<br />
Das wäre logistisch und finanziell<br />
eine grosse Herausforderung. Zudem wäre<br />
es grundsätzlich schwierig, eine geeignete<br />
Vergleichsgruppe zu finden.<br />
Weshalb?<br />
Eine HIV-negative Kontrollgruppe müsste<br />
vergleichbar zusammengesetzt sein in Bezug<br />
auf Alter und Geschlecht, aber auch<br />
auf Begleiterkrankungen wie die Hepatitis-C-Infektion,<br />
Nikotin- und Drogenkonsum,<br />
Ernährung, körperliche Bewegung<br />
und mehr. Gezielt nach Personen zu suchen,<br />
die diesen Kriterien entsprechen,<br />
wäre sehr aufwändig. Und bei der Suche<br />
via Inserat melden sich in der Regel fast<br />
ausschliesslich gesundheitsbewusste, kerngesunde<br />
Menschen.<br />
Wie haben Sie die Vergleichsgruppe für<br />
die Herzkranzgefässe-Untersuchung<br />
gewählt?<br />
Wir haben HIV-negative Patienten, die<br />
ohnehin für eine Computertomografie<br />
der Herzkranzgefässe angemeldet waren,<br />
angefragt, ob wir ihre Daten für die Studie<br />
verwenden dürfen. Dabei haben wir ➔<br />
«Was geht mich meine Gesundheit an!»<br />
Wilhelm Nietzsche<br />
Wir sind die erste Adresse für diskrete Beratung in allen Gesundheitsfragen.<br />
Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie (SHCS) wurde1988 gegründet. Sie ist eine Kollaboration aller Schweizer Universitätsspitäler,<br />
zweier Kantonsspitäler, kleinerer Spitäler sowie auf HIV spezialisierter Arztpraxen. In der SHCS werden halbjährlich klinische<br />
Informationen von HIV-Patienten erfasst, Blutwerte bestimmt sowie Blutproben für spätere Auswertungen eingefroren. Dies<br />
immer unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmer ihr schriftliches Einverständnis dazu gegeben haben. In einer Kohortenstudie<br />
werden keine experimentellen Interventionen durchgeführt. Vielmehr beobachtet man lediglich eine Gruppe von Menschen<br />
über längere Zeit, mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen einem oder mehreren Faktoren und dem Auftreten einer Krankheit<br />
aufzudecken<br />
6 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Altern mit HIV<br />
Ihr Gesundheits-Coach.<br />
Stampfenbachstr. 7, 8001 Zürich, Tel. 044 252 44 20, Fax 044 252 44 21<br />
leonhards-apotheke@bluewin.ch, www.leonhards.apotheke.ch<br />
XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 7
Personen mit vergleichbarem Alter, Geschlecht<br />
und Herz-Kreislauf-Risikoprofil<br />
gewählt. Die zusätzlichen Angaben wie<br />
Medikamente, Nikotin- und Alkoholkonsum,<br />
körperliche Tätigkeit und Vorerkrankungen<br />
haben wir per Fragebogen erfasst.<br />
Und in der M+A-Studie können Sie auch<br />
ohne HIV-negative Vergleichsgruppe den<br />
Einfluss von HIV auf den Alterungsprozess<br />
bestimmen?<br />
Wir werden unsere Resultate mit Studienresultaten<br />
aus der Allgemeinbevölkerung<br />
vergleichen. Hier gibt es zahlreiche Publikationen.<br />
In der M+A-Studie möchten wir<br />
jedoch nicht nur ganz grundsätzlich den<br />
Einfluss von HIV erkennen, sondern darüber<br />
hinaus jenen von einzelnen HIV- Medikamenten,<br />
der Viruslast, der Dauer der<br />
HIV-Infektion und weiteren mit HIV verbundenen<br />
Faktoren. Diese Analysen ermöglichen<br />
uns unser detailliertes Datenset<br />
der HIV-Patienten.<br />
Zu was für Anwendungen könnten die<br />
Erkenntnisse dieser Studie führen?<br />
Sie könnten die Durchführung gewisser<br />
Vorsorgeuntersuchungen sowie präventive<br />
Massnahmen bei HIV-positiven Personen<br />
unterstützen. Und sie könnten in der<br />
HIV-Therapie die Wahl gewisser antiretroviraler<br />
Substanzen beeinflussen, abhängig<br />
vom individuellen Risikoprofil für eine Erkrankung.<br />
Werden Sie die Frage, ob HIV das Altern<br />
beschleunigt, beantworten können?<br />
Ich hoffe es. Unsere Resultate werden ein<br />
wichtiger Mosaikstein sein zur umfassenden<br />
Beantwortung dieser Frage.<br />
*Das Interview ist in ausführlicher Form in den «Swiss<br />
Aids News» des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nachzulesen.<br />
Helen Kovari<br />
Helen Kovari ist Oberärztin mit erweiterter<br />
Verantwortung an der Klinik für<br />
Infektionskrankheiten und Spitalhygiene<br />
des Universitätsspitals Zürich. Als<br />
HIV-Spezialistin ist sie sowohl in der Betreuung<br />
von Patienten wie in der Forschung<br />
tätig. Im Rahmen der Schweizerischen<br />
HIV-Kohortenstudie leitet sie<br />
zurzeit zwei Studien, die sich mit dem<br />
Alterungsprozess HIV- positiver Personen<br />
sowie dem Einfluss von HIV auf die<br />
Leber beschäftigen.<br />
Jonas<br />
Kolumne<br />
B<br />
erlin ist immer eine Reise wert. Auf eine Mauer im Stadtteil Friedrichshain,<br />
wo ich jeweils wohne, hat einer den Spruch «Es war nicht alles schlecht<br />
am Kapitalismus» gesprayt. Ganz schön frech, dieser Satz, redet er doch<br />
schon eine neue Zeit herbei, die den Kapitalismus, – er bestimmt auch die<br />
Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege – überwunden hat. So schnell<br />
wird das nicht passieren – ich jedenfalls werde das kaum noch erleben.<br />
Aber vielleicht der 24-jährige Jonas, der als Fachmann Gesundheit arbeitet. Wie viele<br />
seiner KollegInnen weiss er, dass es für die verwirrten Bewohner wichtig wäre, die Zeit<br />
mit ihnen zu verbringen, die Zeit mit ihnen zu ertragen, so gut es eben geht. Aber Zeit<br />
kostet Geld. Die Zeit im Pflegezentrum muss heute effizient verbracht werden. Weil die<br />
Kostenträger der Pflege nicht mehr trauen, muss neuerdings die Echtzeit in der Pflege<br />
erfasst werden. Jonas erfasst Leistung und Zeit mit einem kleinen Gerät, in dem eine<br />
Stoppuhr eingebaut ist, die nach jeder Erfassung automatisch wieder auf null gestellt<br />
wird – so erfasst das Gesundheitszentrum neben den Leistungen für die Bewohner auch<br />
noch, ob Jonas nur faul herumsteht.<br />
Aber dazu hat er wirklich keine Zeit! Beim Ankleiden der Bewohner (Code 1 Grundpflege,<br />
Ankleiden) oder einem kleinen Gespräch Führen (Code 12c Psychogeriatrische<br />
Leistungen) hält Jonas den Sensor des Gerätes auf eine Bewohneretikette und dann auf<br />
den Leistungscode. «Piep, piep» macht das Gerät. Beim Rapport im Stationszimmer<br />
sitzen alle KollegInnen von Jonas im Kreis und drücken die Sensoren ihrer Geräte auf die<br />
Etiketten (Code 14b Pflegerapporte), «Piep, piep, piep, piep». Auch wenn Jonas zur Toilette<br />
oder in die Kaffeepause geht, darf er nicht vergessen, den Code 25 (Persönliche Zeiten,<br />
Strukturzeiten) zu erfassen. «Piep, Piep, Piep» macht sein Gerät den ganzen Tag und die<br />
Geräte seiner KollegInnen piepsen ebenfalls. «Ihr kostet, Bewohner!», piepsen sie im<br />
Chor, «Beeilt euch und sterbt endlich! Piep, piep!». Viele Bewohner werden ob der Pieptöne<br />
ängstlich und unruhig und Jonas singt laut ein Lied, um das Piepsen zu übertönen.<br />
Nach Dienstschluss trainiert er in seinem Box-Club. Beim Aufwärmen auf dem Rudergerät<br />
piepst es immer noch in seinem Kopf. Seine Arbeit mit den verstörten Bewohnern<br />
kommt ihm schändlich und schäbig vor. Die Kostenträger haben keine Ahnung, denkt er.<br />
Neben der schweren körperlichen Arbeit noch mit Ängsten und Traurigkeit der Bewohner<br />
konfrontiert zu werden – das lässt sich nicht mit einem Code erfassen! Einige seiner<br />
KollegInnen greifen neben Alkohol und Zigaretten zu Beruhigungs- und Schlafmitteln,<br />
um am Arbeitsplatz erscheinen zu können.<br />
Der Puls von Jonas steigt. «Was kommt als Nächstes?», denkt er, «werden die Bewohner<br />
noch mehr bezahlen müssen, vielleicht für die Anzahl ihrer unregelmässigen Herzschläge,<br />
für die Frequenz der eingeatmeten Luft, für die Schrittchen, die sie auf der Abteilung<br />
noch tun oder für die Anzahl der Worte, die sie noch zu sprechen versuchen? Erfassen<br />
lässt sich alles.» Das Rudern hat Jonas gestärkt – er ist zum Kampf bereit.<br />
Dr. Christoph Held<br />
Dr. Christoph Held, arbeitet als Heimarzt<br />
und Gerontopsychiater beim<br />
Geriatrischen Dienst der Stadt Zürich<br />
sowie im Alterszentrum Doldertal.<br />
Lehrbeauftragter der Universität Zürich<br />
sowie Dozent an den Fachhochschulen<br />
Bern, Careum Aarau und ZAH Winterthur<br />
sowie an der Universität Basel.<br />
Bücher «Das demenzgerechte Heim»<br />
(Karger, 2003), «Wird heute ein guter<br />
Tag sein? Erzählungen» (Zytglogge,<br />
2010), «Accueillir la demence»<br />
(Médecine et Hygiène, 2010), «Was<br />
ist gute Demenzpflege?» (Huber, 2013)<br />
Im Herbst <strong>2017</strong> erscheint «Bewohner»<br />
Erzählungen Dörlemannverlag<br />
Dr. Christoph Held wird künftig an<br />
dieser Stelle regelmässig über seine<br />
Erfahrungen im Umgang mit Demenz<br />
berichten.<br />
Kontakt<br />
christoph.held@bluewin.ch<br />
8 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Altern mit HIV<br />
Kolumne Dr. Christoph Held <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 9
Wir riechen besser<br />
als gedacht!<br />
Hunde können Verbrechern hinterherschnüffeln, Parfümprofis erkennen<br />
hingegen Hunderte von Blumendüften. Menschennasen sind gar nicht so<br />
schlecht, wie häufig angenommen.<br />
Stephan Inderbizin<br />
M<br />
enschen haben viel feinere<br />
Nasen als gemeinhin angenommen.<br />
Sie können<br />
schnuppernd Spuren verfolgen,<br />
und manche Düfte<br />
riechen sie sogar besser als Hunde und Nagetiere.<br />
Die verbreitete Meinung vom<br />
«schlechten menschlichen Geruchssinn»<br />
gehe auf einen Mythos aus dem 19. Jahrhundert<br />
zurück, schreibt der US-Forscher<br />
John McGann im Fachjournal «Science».<br />
Der Neurologe der Rutgers University<br />
in New Brunswick hat zahlreiche jüngere<br />
Studienergebnisse in einem Überblicksartikel<br />
zusammengefasst. Mit dem Ergebnis:<br />
Menschliche Nasen sind chronisch unterschätzt.<br />
Beim Menschen ist das Riechzentrum<br />
im Gehirn relativ gesehen kleiner als etwa<br />
bei Mäusen. Mit dieser Feststellung habe<br />
der französische Anatom Paul Broca im 19.<br />
Jahrhundert den Grundstein für das Vorurteil<br />
gelegt, der menschliche Geruchssinn<br />
sei unterentwickelt, schreibt McGann. Hinzu<br />
kamen entsprechende Abwertungen<br />
durch Psychologen wie Sigmund Freud.<br />
Grösse und Zahl nicht immer<br />
entscheidend<br />
Aber neue Studien weisen darauf hin,<br />
dass der sogenannte Bulbus olfactorius im<br />
Gehirn – der sogenannte Riechkolben – die<br />
Ausnahme von der Regel darstellt, dass die<br />
relative Grösse eines Hirnteils Rückschlüsse<br />
auf seine Leistungsfähigkeit zulässt. Die<br />
Zahl der Neuronen im Riechzentrum ist<br />
demnach über Speziesgrenzen hinweg relativ<br />
ähnlich, trotz erheblicher Unterschiede<br />
beim Körpergewicht.<br />
Ähnlich verhält es sich mit den Duftrezeptoren:<br />
Ihre Zahl ist beim Menschen<br />
mit knapp 400 deutlich geringer als bei<br />
Hunden (etwa 800) oder Ratten (etwa<br />
1000). Dies sage aber wenig über die Empfindlichkeit<br />
und die Unterscheidungsfähigkeit<br />
des menschlichen Geruchssinns aus,<br />
betont McGann. Wichtig dabei: Unterscheidungsvermögen<br />
könne antrainiert<br />
werden, die Sensitivität aber nicht.<br />
Der Hund gilt als Supernase.<br />
Noch zu wenig erforscht<br />
Beim Geruchssinn, lange als minderwertig<br />
betrachtet, fehle weiterhin viel Grundlagenforschung,<br />
sagen die Wissenschaftler. Das<br />
gelte auch mit Blick auf den Vergleich von<br />
Hunde- und Menschennasen. «Der Hund<br />
gilt als Supernase. Aber bislang wurden bei<br />
Hunden erst 15 Düfte daraufhin getestet, ab<br />
welchem Schwellenwert sie wahrgenommen<br />
werden. Und bei fünf dieser Düfte war<br />
der Mensch sensitiver», erklärt Geruchsforscher<br />
Hans Hatt. Die Ergebnisse der Übersichtsstudie<br />
seien für Experten nicht überraschend<br />
– für die Allgemeinheit hingegen<br />
schon. «Dahinter steckt wohl die Urangst<br />
des Menschen, dass Düfte uns instinktiv<br />
steuern», sagt der Forscher weiter. Auch er<br />
glaubt, dass die Abwertung des Geruchssinns<br />
kultursoziologische Hintergründe<br />
habe. «Düfte sind etwas Intimes, haben<br />
auch etwas mit Sexualität zu tun. Wir aber<br />
wollen uns von den Tieren unterscheiden.»<br />
Vieles bei Gerüchen laufe völlig unbewusst<br />
ab. (mit Material der SDA)<br />
ANZEIGE<br />
Modulare Weiterbildungen für Profis<br />
im Gesundheits- und Sozialbereich<br />
Tagung 06.09.<strong>2017</strong><br />
Trendthemen der Führung<br />
«Erfolgsfaktor Querdenken»<br />
Pflege & Betreuung<br />
– Langzeitpflege und -betreuung (FaGe, FaBe)<br />
– Pflege mit verschiedenen Schwerpunkten<br />
– Case Management im Gesundheitswesen<br />
– Haushelferinnen in der Spitex<br />
Alter(n) & Generationen<br />
– Altersarbeit/Praktische Gerontologie<br />
– Care Gastronomie<br />
– Gerontopsychiatrie/Demenz<br />
– Dementia Care Mapping<br />
Persönliche Beratung: Tel. + 41 (0)62 837 58 39<br />
Führung & Management<br />
– Führung kompakt<br />
– Team-, Bereichs-, Institutionsleitung<br />
– Vorbereitungskurse eidg. Berufsprüfung,<br />
eidg. höhere Fachprüfung<br />
– Qualitätsmanager in Spitex und Langzeitpflege<br />
www.careum-weiterbildung.ch<br />
_<br />
Mühlemattstrasse 42<br />
CH-5000 Aarau<br />
Tel. +41 (0)62 837 58 58<br />
info@careum-weiterbildung.ch<br />
10 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Wissenschaft Geruchssinn
Gesehen & gehört<br />
Suchen Sie den (Wieder-)Einstieg ins<br />
Berufsleben, bei dem Ihre Erfahrung im<br />
Haushalt zählt?<br />
Leben an Land ist vielleicht älter<br />
als bisher angenommen<br />
Leben an Land könnte es schon viel länger geben als bisher<br />
angenommen. Darauf weisen fossile Spuren von Mikroorganismen<br />
hin, die Forscher in 3,48 Milliarden alten Gesteinsablagerungen<br />
ehemaliger heisser Quellen entdeckt zu haben<br />
glauben.<br />
Solche Thermalquellen an Land seien damit drei Milliarden<br />
Jahre früher besiedelt gewesen als bislang bekannt,<br />
schreiben die Wissenschafter im Fachblatt «Nature Communications».<br />
Die Entdeckung sei auch relevant für die Suche<br />
nach Leben auf anderen Planeten. Auf dem Mars gebe<br />
es vergleichbare heisse Quellen, an denen möglicherweise<br />
Spuren von Leben nachweisbar sind.<br />
Die Forscher lieferten gute Belege dafür, dass es sich<br />
um ehemals terrestrische Quellen handle. Aber «neue Beweise<br />
für Leben dort liefern sie nicht; die Gas-Bläschen, die<br />
sie finden, könnten auch abiotischen Ursprungs sein», gaben<br />
die Forscher zu bedenken.<br />
Wann und wo das Leben auf der Erde entstand, ist bislang<br />
nicht genau bekannt. Kürzlich berichteten Wissenschaftler<br />
im Fachblatt «Nature», die bislang ältesten fossilen<br />
Spuren von Mikroorganismen entdeckt zu haben.<br />
Als solche hatten sie faden- und röhrenförmige Strukturen<br />
in mindestens 3,7 Milliarden Jahre altem Gestein aus<br />
dem nördlichen Kanada interpretiert. Das Gestein ging<br />
ebenfalls auf Ablagerungen von hydrothermalen Quellen<br />
zurück, allerdings von unterseeischen.<br />
Wenig Schlaf macht unbeliebt<br />
Wer wenig schläft, sieht nicht gut aus. Das kennen wohl die<br />
meisten Menschen aus eigener Erfahrung. Mangelnder<br />
Schlaf hat aber noch ganz andere «Nebenwirkungen»: Andere<br />
Menschen wollen mit Unausgeschlafenen lieber<br />
nichts zu tun haben – das zumindest ist das Ergebnis einer<br />
Studie. Vermutlich meiden sie diese unbewusst, um sich<br />
selbst zu schützen, etwa vor ansteckenden Krankheiten,<br />
berichten Wissenschaftler im Fachblatt «Open Science»<br />
der britischen Royal Society. Die Forscher baten 25 gesunde<br />
Menschen zum Fototermin – einmal nach zwei Nächten<br />
mit acht Stunden Schlaf und einmal, nachdem sie zwei<br />
Nächte hintereinander nur vier Stunden geschlafen hatten.<br />
So ein partieller Schlafmangel sei im Alltag üblicher als<br />
totaler Schlafentzug, erklären die Wissenschaftler. Sie baten<br />
danach insgesamt 122 Personen, den Gesichtsausdruck<br />
der Probanden auf den Fotos zu beurteilen. Sie sollten<br />
angeben, wie attraktiv, wie gesund und wie<br />
vertrauenswürdig sie die Porträtierten fanden und ob sie<br />
gerne mit ihnen Zeit verbringen würden.<br />
Die Auswertung zeigte, dass unausgeschlafene Menschen<br />
nicht besonders beliebt waren. Die Bewerter wollten<br />
mit ihnen deutlich weniger gern Zeit verbringen als mit den<br />
ausgeschlafenen Probanden. Müde Menschen wurden zudem<br />
als weniger attraktiv, weniger gesund und schläfrig<br />
eingeschätzt. Einzig im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit<br />
fanden die Forscher keine Unterschiede.<br />
Studie: Weltweit gut 28 000<br />
Pflanzenarten mit Heilkraft<br />
Mehr als 28 000 Pflanzenarten weltweit haben laut einer<br />
umfangreichen Untersuchung Heilkraft – allerdings ist nur<br />
ein Bruchteil von ihnen in der medizinischen Forschung bekannt.<br />
Insgesamt 28 187 Pflanzenarten auf der Erde hätten<br />
medizinischen Nutzen, teilte das renommierte britische<br />
Zentrum für botanische Forschung, Kew Gardens, am Donnerstag<br />
in London mit. Damit sei ihre Zahl im Vergleich zum<br />
Vorjahresbericht um 59 Prozent gestiegen.<br />
Von Übelkeit und Kopfschmerzen, zu Bluthochdruck<br />
und Diabetes, über Magenschmerzen und Virusinfektionen<br />
bis hin zu Depression, Parkinson und Krebs – gegen fast alle<br />
Erkrankungen gibt es pflanzliche Linderungs- und gar Heilmittel<br />
mit fast gar keinen Risiken und Nebenwirkungen.<br />
Allerdings finden nur 16 Prozent der Heilpflanzen in<br />
anerkannten medizinischen Publikationen Erwähnung,<br />
bilanzierte Kew Gardens. Dabei hätten Heilpflanzen ein<br />
«riesiges Potential» bei der Bekämpfung von Krankheiten<br />
wie Diabetes und Malaria. So zählten die beiden Pflanzenstoffe<br />
Artemisinin und Chinin «zu den wichtigsten<br />
Waffen» gegen die Infektionskrankheit Malaria, an<br />
der 2015 mehr als 400 000 Menschen starben.<br />
An der Studie «State of the World’s Plants» (Zustand<br />
der Pflanzen der Erde) beteiligten sich 128 Wissenschaftler<br />
aus zwölf Ländern. Aufgeführt werden<br />
rund 1730 Neuentdeckungen seit dem Vorjahr. Dazu<br />
zählen neun Arten einer Kletterpflanze namens Mucuna,<br />
die bei der Behandlung von Parkinson eingesetzt<br />
werden.<br />
Hoher Blutdruck nimmt bei<br />
Jugendlichen zu<br />
Ein erhöhter Blutdruck wird vor allem mit älteren Menschen<br />
in Verbindung gebracht. Zunehmend sind jedoch<br />
auch Kinder und Jugendliche betroffen. «Wir können in<br />
westlichen Ländern eine deutliche Zunahme an erhöhten<br />
Blutdruckwerten bei übergewichtigen Kindern feststellen»,<br />
sagt Robert Dalla Pozza, leitender Oberarzt<br />
der Abteilung für Kinderkardiologie am Uniklinikum<br />
München, anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages.<br />
Zwar habe es schon immer Kinder mit einem erhöhten<br />
Blutdruck gegeben, etwa aufgrund einer Nierenerkrankung,<br />
erklärt Dalla Pozza. Seit einigen Jahren<br />
aber würden zunehmend übergewichtige Kinder<br />
wegen höherer Blutdruckwerte an Kinderkardiologen<br />
überwiesen. Um der gefährlichen Entwicklung etwas<br />
entgegenzusetzen, müssten Übergewicht und Fettsucht<br />
behandelt werden. (SDA / DPA)<br />
ANZEIGE<br />
Möchten Sie<br />
beruflich<br />
vorankommen<br />
oder im<br />
hauswirtschaftlichen<br />
Umfeld Karriere<br />
machen?<br />
Die Erfolgsaussichten im schweizerischen<br />
Arbeitsmarkt sind für Fachleute im Berufsfeld<br />
Hauswirtschaft ausgezeichnet!<br />
Durch die nachfolgenden Kurse an der Fachschule<br />
Viventa erhöhen Sie Ihre Chancen für eine<br />
vielseitige Tätigkeit im hauswirtschaftlichen Umfeld –<br />
vom gehobenen Privathaushalt bis zum Grossbetrieb<br />
einer Kindertagesstätte, Pflegeeinrichtung o.ä.<br />
Grundlagenkurs Hauswirtschaft:<br />
Fehlen Ihnen nebst praktischen Erfahrungen auch<br />
fundierte Deutsch-kenntnisse zum ersten Schritt in<br />
eine hauswirtschaftliche Tätigkeit? Dann erwerben<br />
Sie in diesem Grundkurs die notwendige Sprachkompetenz<br />
und gleichzeitig die Grundlagen der<br />
Haushaltführung. Dadurch erarbeiten Sie sich<br />
direkte Einstiegsmöglichkeiten in den<br />
schweizerischen Arbeitsmarkt.<br />
Als möglicher Karriereschritt bietet sich Ihnen der<br />
eidg. Fachausweis zur Haushaltleiter/in an.<br />
Eidgenössischer Fachausweis<br />
zur Haushaltleiter/in:<br />
In dieser Ausbildung erweitern Sie Ihr bestehendes<br />
theoretisches und praktisches Wissen über<br />
Ernährung, die Pflege von Wohnräumen und<br />
Wäsche. Ausserdem erfahren Sie Wichtiges über<br />
Personalführung und erlernen die Planung, die<br />
Organisation sowie die Kontrolle der<br />
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Somit<br />
ermöglichen Sie sich eine Karriere im Berufsumfeld<br />
Hauswirtschaft durch diesen eidgenössischen<br />
Fachausweis.<br />
Beginn der Kurse 22. August <strong>2017</strong><br />
Informationsveranstaltung<br />
13. <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong>, 19.00 Uhr<br />
Schulhaus Dorflinde<br />
Schwamendingerstr. 39, Zürich-Oerlikon<br />
Für Auskunft und alle weiteren Informationen<br />
Fachschule Viventa<br />
Wipkingerplatz 48<br />
8037 Zürich<br />
Tel. 044 413 50 00, E-Mail: viventa@zuerich.ch<br />
www.stadt-zuerich.ch/viventa<br />
12 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> News gesehen & Gehört
Mit Teebaumöl gegen<br />
multiresistente Keime?<br />
Krankenhauskeime – zusammengefasst unter MRSA – sind mehr als nur eine<br />
vage Bedrohung. Multiresistente Keime können tödlich sein. Und immer wieder<br />
wird behauptet, dass ätherische Öle dagegen helfen sollen. Ist dem so?<br />
Verena Malz<br />
U<br />
nter der Unter der Überschrift<br />
«Resistente Bakterien: Mediziner<br />
verlieren den Kampf<br />
gegen Killer-Keime» hat sich<br />
Spiegel Online unlängst dieses<br />
Themas angenommen: Jährlich sterben<br />
in der EU 25 000 Menschen durch Infektionen<br />
mit antibiotikaresistenten Mikroben,<br />
400 000 Menschen pro Jahr infizieren sich<br />
mit resistenten Keimen. Meistens ist in<br />
diesem Artikel die Rede von MRSA<br />
(Methicillin-resistenter Staphylococcus<br />
aureus). Bekanntlicherweise erfolgt die<br />
Ansteckung bzw. Übertragung in Pflegeinstitutionen oft im<br />
Rahmen der Behandlung von eigentlichen Routineeingriffen.<br />
Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt bereits vor dem<br />
«post-antibiotischem Zeitalter». Alltägliche Erkrankungen<br />
wie Mandelentzündungen oder Nasennebenhöhlenentzündungen<br />
enden immer öfter tödlich. Obwohl Ärzte / Ärztinnen und<br />
Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal in<br />
Hygiene ausgebildet sind, sind multiresistente Keime ganz offensichtlich<br />
ein grosses Problem in Krankenhäusern. Es werden<br />
seit geraumer Zeit neue Lösungsansätze gesucht und immer<br />
wieder geistert die Idee herum, dass ätherische Öle wie<br />
beispielsweise Teebaumöl Keime in Krankenhäusern und Kliniken<br />
reduzieren können. Die Studienlage zeigt ein weniger<br />
optimistisches Bild.<br />
Studien belegen keine Wirksamkeit<br />
Fall 1: <strong>2017</strong> wurde von Blackwood eine randomisiert kontrollierte<br />
Studie zur Körperwaschung mit 5 % Teebaumöl versus<br />
Standardkörperpflegemittel zur Vorbeugung einer MRSA-<br />
Besiedelung der Haut bei schwer erkrankten Erwachsenen an<br />
der der Queen´s University Belfast, Irland durchgeführt. Die<br />
Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von Oktober 2014 bis Juli<br />
2016 auf zwei Intensivstationen (mit chirurgischen und TraumapatientInnen).<br />
An der Studie waren bis zum Ende 491 TeilnehmerInnen<br />
beteiligt. Teebaumöl 5 % wurde in der Anwendung zwar von<br />
den PatientInnen sehr gut toleriert, der Unterschied beim Prozentsatz<br />
der Wiederbesiedelung war nicht signifikant (P=0,50).<br />
Eine weitere Studie zeigte ebenfalls nicht die erhofften positiven<br />
Resultate.<br />
Fall 2: Falci führte 2015 eine Studie mit Teebaumöl<br />
durch, um den Effekt gegen Staphylococcus aureus beurteilen<br />
zu können. Es handelte sich um Wunden der unteren Extremitäten,<br />
die antibiotikaresistent waren und S. aureus enthielten.<br />
13 Reagenzgläser, die ein mikrobiologisches Nährmedium<br />
enthielten, wurden verwendet, um die minimale Hemmkonzentration<br />
zu bestimmen (MIC).<br />
Falci kommt zu dem Schluss, dass Melaleuca sp. Öl antimikrobielle<br />
Eigenschaften gegenüber Stämmen, die in Wunden<br />
der unteren Extremitäten vorkamen und gegen mehrere<br />
Antibiotika resistent waren, aufweist. Allerdings nicht in erhofftem<br />
Mass.<br />
Fall 3: Edmondson führt eine Studie über die antimikrobielle<br />
und antientzündliche Eigenschaft von Teebaumöl durch<br />
und prüfte, ob es bei MRSA eingesetzt werden kann. Die erste<br />
Frage dieser unkontrollierten Pilotstudie war, ob Teebaumöllösung,<br />
MRSA von akuten und chronischen Wunden unterschiedlicher<br />
Ätiologie dekolonisiert. Die zweite Frage war, ob<br />
Teebaumöl die Wundheilung beeinflusst.<br />
Die Wunden der Studienteilnehmer wurden mit einer<br />
Wasser-Teebaumöl-Mischung (3,3 %) zu jedem Verbandwechsel<br />
gespült. Kein Teilnehmer war nach der Anwendung<br />
MRSA-negativ.<br />
In dieser Studie von Edmondson konnte also nicht nachgewiesen<br />
werden, dass MRSA aus den Wunden dekolonisiert<br />
wird. Teebaumöl hemmt nicht die Heilung, die Mehrheit der<br />
Wunden war nach der Behandlung in der Grösse reduziert.<br />
Quellen: Blackwood/Thompson/McMullan et al, <strong>2017</strong>, S. 1193-1198<br />
Falci/Teixeira/Chagas et al, 2015, S. 401-406, Edmondson et al, 2011<br />
ANZEIGE<br />
Serata, Stiftung für das Alter ist Betreiberin eines modernen<br />
Alterszentrums mit 100 Pflege- und Betreuungsplätzen, 75<br />
Appartements für betreutes und 61 Appartements für selbständiges<br />
Wohnen und einer dezentralen Pflegewohngruppe mit<br />
10 Zimmern. Ein öffentliches Restaurant mit 110 Plätzen, sowie<br />
diversen Bankett- und Seminarmöglichkeiten runden das<br />
Angebot ab.<br />
Wir suchen für die Betreuung und Pflege unserer Bewohnerinnen<br />
und Bewohner im Serata für die beschützte Demenz-Abteilung<br />
und für die Abteilung der Langzeitpflege mit internem Spitex-<br />
Auftrag für den Tagdienst per sofort oder nach Vereinbarung<br />
dipl. Pflegefachpersonen, 80-100 %, (m/w)<br />
Ihre Hauptaufgaben:<br />
• Sicherstellung einer fachgerechten und auf die Bedürfnisse<br />
unserer Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmte Pflege<br />
und Betreuung<br />
• Koordination und Planung der Pflege anvertrauter<br />
Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Konzept der<br />
Bezugspflege<br />
• Erfassung und Dokumentierung der Pflegeleistungen als<br />
RAI-NH MDS-Koordinator/In<br />
• Übernahme der Tagesverantwortung<br />
Unsere Anforderungen:<br />
• Ausbildung als Pflegefachkraft , vorzugsweise mit Abschluss HF<br />
oder vergleichbares Diplom<br />
• Berufserfahrung in der Langzeitpflege<br />
• Erfahrung als RAI-NH MDS-Koordinator/In<br />
• Ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft, hohes<br />
Verantwortungsbewusstsein, wertschätzende Haltung,<br />
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Selbständigkeit<br />
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie PC-Anwenderkentnisse<br />
Unser Angebot:<br />
• Modernes und innovatives Arbeitsumfeld<br />
• Eine anspruchsvolle, interessante und vielseitige Tätigkeit<br />
• Arbeit mit hoher Eigenverantwortung<br />
• Internes Fort- und Weiterbildungsangebot<br />
Möchten Sie Teil eines Teams werden, das dynamisch, motiviert<br />
und lösungsorientiert die zukünftigen Aufgaben zum Wohle<br />
unserer Bewohnerinnen und Bewohner bewältigt? Dann freuen<br />
wir uns auf Ihre Bewerbung. Für fachbezogene Auskünfte<br />
wenden Sie sich an Herrn Ernst Grossenbacher, Leiter Pflege und<br />
Betreuung, Telefon 044 723 71 05. Ihre vollständigen<br />
Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie an:<br />
Serata, Stiftung für das Alter, Gisela Seiler, Personaldienst<br />
Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil, gisela.seiler@serata.ch, www.serata.ch<br />
14 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Multiresistente Erreger Neue Erkenntnisse
Auf dem Weg zur Heilung<br />
der Schuppenflechte<br />
Eine neue Generation von Medikamenten hat die Behandlung der Schuppenflechte<br />
revolutioniert. Sie greifen in die Kommunikation der Immunzellen ein<br />
und stoppen so die überschiessende Entzündungsreaktion.<br />
Dr. Ingo Haase<br />
16 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Schuppenflechte<br />
S<br />
eit Tausenden von Jahren<br />
kennt man diese Krankheit:<br />
Schuppenflechte oder Psoriasis.<br />
Ebenso lange sind Forscher<br />
auf der Suche nach ihrer<br />
Ursache. In der Antike ging man<br />
möglicherweise von einer Infektionserkrankung<br />
aus, denn «Psora» bedeutet so<br />
viel wie «Krätze». Erst um 1800 trennte<br />
der englische Arzt in der Systematik der<br />
Hautkrankheiten die Psoriasis von den<br />
infektiösen Erkrankungen ab.<br />
Heute wissen wir, dass es sich hierbei<br />
um zwei völlig verschiedene Krankheitsbilder<br />
handelt: Krätze ist eine durch Parasiten<br />
hervorgerufene Hautkrankheit; hingegen<br />
ist Psoriasis die Folge einer fehlerhaften<br />
Aktivierung des Immunsystems.<br />
Die Geschichte kennt zahllose Versuche,<br />
Psoriasis mit Medikamenten oder physikalischen<br />
Therapieverfahren zu heilen.<br />
Stark giftige Substanzen wie Arsen (Fowlersche<br />
Lösung, Salvarsan, Ellpsoral II),<br />
Quecksilber (Kalomel, Rochard’sche Salbe)<br />
oder Schwefel (Psorosulf) wurden äusserlich<br />
und innerlich zur Behandlung eingesetzt.<br />
Später kam eine äusserliche Behandlung<br />
mit Teer in Verbindung mit ultraviolettem<br />
Licht hinzu. Diese Therapiemethoden<br />
waren mit starken Nebenwirkungen<br />
behaftet; ihr Erfolg in der Behandlung der<br />
Psoriasis war begrenzt.<br />
Forschung ermöglicht gezielte<br />
Entwicklung neuer Therapieverfahren<br />
In den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts<br />
wurde der Beweis erbracht, dass Zellen des<br />
Immunsystems an der Entstehung der Psoriasis<br />
beteiligt sind. In der Folge entwickelte<br />
man Medikamente, die bestimmte Immunzellen<br />
(Lymphozyten) inaktivieren<br />
konnten (Alefacept, Efalizumab). Dies waren<br />
die ersten Medikamente, die gezielt gegen<br />
die Schuppenflechte entwickelt wurden.<br />
Die blosse Inaktivierung von Lymphozyten<br />
durch diese Medikamente war aber<br />
nur wenig wirksam. Hinzu kamen einzelne<br />
Fälle ernsthafter Nebenwirkungen, so dass<br />
diese Methode für die Behandlung der Psoriasis<br />
kaum noch eingesetzt werden.<br />
Die Forschung zur Entwicklung neuer<br />
Therapien speziell gegen die Psoriasis<br />
führte zu der Erkenntnis, dass die Entzündung<br />
bei Psoriasis erst durch das Zusammenwirken<br />
verschiedener Zellen der Haut<br />
entsteht. Dies sind Immunzellen im Unterhautgewebe<br />
(Dendritische Zellen), Immunzellen<br />
des Blutes (Lymphozyten) und die<br />
Zellen der Oberhaut (Keratinozyten). Des-<br />
ANZEIGE<br />
MoliCare Inkontinenzlösungen<br />
Sparen Sie Zeit und Kosten<br />
Bei IVF HARTMANN liegt die Priorität auf der engen Zusammenarbeit mit den Anwendern von<br />
Inkontinenzprodukten. Wir bieten ein modernes Sortiment und ganzheitliche Lösungen für eine<br />
verantwortungsvolle Pflege.<br />
Lassen Sie sich überzeugen – wir beraten Sie gerne vor Ort.<br />
IVF HARTMANN AG – Ihre Bedürfnisse, unser Anspruch.<br />
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info<br />
halb ist die Inaktivierung nur einer Gruppe<br />
von Immunzellen nicht ausreichend.<br />
Diese Zellen müssen normalerweise<br />
miteinander kommunizieren, damit die Haut<br />
wichtige Reparatur- und Abwehrvorgänge<br />
ausführen kann. Psoriasis ist die Folge einer<br />
fehlerhaften Aktivierung solcher Reparaturund<br />
Abwehrvorgänge. Neue Strategien zur<br />
Psoriasis entsteht durch<br />
das Zusammenwirken<br />
verschiedener Zellen in<br />
der Haut.<br />
Behandlung zielen deshalb darauf, die Kommunikation<br />
zwischen den beteiligten Zellen<br />
zu unterbinden, damit die fehlerhafte Aktivierung<br />
rückgängig gemacht werden kann.<br />
Zielgerichteter Eingriff in die<br />
Kommunikationswege der<br />
Immunzellen<br />
Um miteinander Informationen auszutauschen,<br />
produzieren die Zellen des Körpers<br />
bestimmte Botenstoffe (Interleukine) und<br />
geben sie an die Zellen der Umgebung ab.<br />
Forschungsergebnisse haben gezeigt,<br />
dass für die Entstehung der Entzündung, die<br />
die Grundlage der Schuppenflechte bildet,<br />
bestimmte Interleukine eine grosse Bedeutung<br />
haben: Interleukin 23 (IL-23), Interleukin<br />
17 (IL-17) und das Entzündungshormon<br />
Tumor Nekrose Faktor (TNF).<br />
Die neuesten Medikamente gegen die<br />
Schuppenflechte, Biologics genannt, sind<br />
körperverwandte Antikörper oder andere<br />
Eiweissmoleküle. Sie legen die Kommunikation<br />
zwischen verschiedenen Immunzellen<br />
lahm, indem sie genau diese Interleukine<br />
und Entzündungsstoffe sehr gezielt<br />
neutralisieren. Auf diese Weise wird die<br />
fehlerhafte Aktivierung der Reparatur- und<br />
Abwehrprozesse in der Psoriasishaut rückgängig<br />
gemacht und die Hautveränderungen<br />
können abheilen.<br />
Unterdrückung der Symptome<br />
oder Heilung?<br />
Die Vorteile des gezielten Eingriffs in die<br />
Kommunikation der Abwehrzellen sind<br />
offensichtlich: Die neuen Biologics sind ➔<br />
«Unser Antrieb:<br />
die Lebensqualität<br />
bei Inkontinenz<br />
weiter verbessern.»<br />
XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 17
Musik lindert Schmerzen<br />
Oberhaut<br />
(Epidermis)<br />
Keratinozyten<br />
Musik zur Behandlung von chronischen Schmerzen wurde bisher offenbar unterschätzt.<br />
Studien zeigen, dass die Klänge einen heilsamen Hormon-Cocktail im<br />
Körper freisetzen<br />
Stephan Inderbizin<br />
Lederhaut<br />
(Dermis)<br />
Dendritische<br />
Zellen<br />
äusserst effektiv und sehr gut verträglich.<br />
Sie haben deutlich weniger Nebenwirkungen<br />
als frühere Medikamente, die das Immunsystem<br />
generell unterdrückten. Anfängliche<br />
Befürchtungen, dass es zu einer<br />
starken Zunahme schwerer Infektionen<br />
bei den Behandelten kommen würde, haben<br />
sich nicht bestätigt.<br />
Deshalb sind Biologics für die Langzeitbehandlung<br />
von Menschen mit Schuppenflechte<br />
geeignet. Die effektive Unterdrückung<br />
der Entzündung an der Haut<br />
bewirkt sogar, dass Begleiterkrankungen<br />
der schweren Psoriasis, wie die Verkalkung<br />
der Herzkranzgefässe, langfristig verbessert<br />
werden. Bei der schweren Psoriasis<br />
hilft die Behandlung also nicht nur der<br />
Haut, sondern dem gesamten Organismus.<br />
Doch können die neuen und sehr teuren<br />
Biologics die Schuppenflechte auch<br />
heilen? Eine vollständige Heilung erscheint<br />
unwahrscheinlich. Die Veranlagung,<br />
Psoriasis zu bekommen, ist genetisch<br />
festgelegt. Dies kann nicht durch<br />
Anti- TNF:<br />
Infliximab, Adalimumab,<br />
Etanercept<br />
Anti- IL-23:<br />
Ustekinumab<br />
Neue Medikamente gegen Schuppenflechte und wo sie in die Kommunikation der Hautzellen eingreifen.<br />
Medikamente geändert werden. Eine<br />
schlüssige Antwort ist jedoch derzeit noch<br />
nicht möglich. Bei kurzer Behandlungsdauer<br />
scheinen Biologics lediglich die<br />
Symptome der Psoriasis zu unterdrücken.<br />
Nach Absetzen der Medikamente kommt<br />
die Erkrankung in den meisten Fällen<br />
Nach Absetzen der<br />
Medikamente kommt die<br />
Erkrankung in den meisten<br />
Fällen zurück.<br />
über kurz oder lang zurück. Doch wenig<br />
ist bisher über die Auswirkungen einer<br />
Langzeitbehandlung bekannt. Ob es gelingen<br />
kann, den Körper durch eine mehrjährige<br />
Unterdrückung der Psoriasis die<br />
Krankheit quasi «vergessen» zu lassen,<br />
werden Untersuchungen der kommenden<br />
Jahre zeigen.<br />
Anti- IL-17:<br />
Secukinumab,<br />
Ixekizumab<br />
Lymphozyten<br />
Dr. Ingo Haase ist als Hautarzt in der<br />
Gemeinschaftspraxis «Hautspezialisten<br />
am Glattpark» in Opfikon tätig. Er<br />
ist ausserordentlicher Professor für<br />
Dermatologie und Venerologie an der<br />
Universität Köln. 2014 kam er als<br />
Praxisnachfolger in die Schweiz. Spezialgebiete<br />
sind die Behandlung entzündlicher<br />
und Sonnenlicht-induzierter<br />
Hautveränderungen.<br />
www.hautspezialisten.ch<br />
Dr. Ingo<br />
Haase<br />
M<br />
ediziner auf der Jahrestagung<br />
der Österreichischen<br />
Schmerzgesellschaft<br />
(ÖSG) in Zell am See berichten<br />
von einer schmerzlindernden<br />
Wirkung von Musik. «Musik<br />
entspannt und verbessert die Stimmung»,<br />
sagte Günther Bernatzky, Dozent an der<br />
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
Salzburg und Tagungs-Präsident.<br />
«Dabei werden auch eine ganze Reihe körpereigener<br />
Hormone aktiviert.» So sorgen<br />
schon ein paar Takte harmonischer Musik<br />
für die vermehrte Ausschüttung der<br />
Glückshormone Serotonin und Dopamin.<br />
Diese Behandlung war schon in der<br />
Antike bekannt. So liess etwa König Saul<br />
gerne den Harfenspieler David zur Linderung<br />
seiner Schwermut herbeirufen. Auch<br />
in der griechischen Medizin setzten Ärzte<br />
Heilgesänge ein, um Leiden zu mildern.<br />
Was damals aus reiner Intuition geschah,<br />
lässt sich mittlerweile wissenschaftlich gut<br />
belegen: «Zwar wissen wir noch nicht genau,<br />
auf welchen Wegen Musik im Einzelnen<br />
wirksam wird, dennoch zeigen viele<br />
neue Studien, dass bereits das selektive Hören<br />
von bestimmter standardisierter Musik<br />
sowohl bei akuten als auch bei chronischen<br />
Schmerzen oder bei Stress eine deutliche<br />
Verbesserung bringt», erklärte Bernatzky.<br />
50 Prozent Schmerzreduktion<br />
Wie wirksam ein paar Takte Musik sein<br />
können, zeigte sich etwa in einer Studie mit<br />
65 Patienten, die an schmerzhaften Wirbelsäulensyndromen<br />
litten. Alle wurden zwar<br />
mit den gleichen Medikamenten und einer<br />
standardisierten Physiotherapie behandelt,<br />
die Hälfte der Patienten bekam aber zusätzlich<br />
einen CD-Spieler und Kopfhörer<br />
ausgehändigt. Damit hörten sie täglich 25<br />
Minuten Musik und eine vorangestellte<br />
Entspannungsanleitung.<br />
Nach drei Wochen waren die Unterschiede<br />
signifikant: Während die Schmerzen<br />
in der Musik-Gruppe durchschnittlich<br />
um 50 Prozent reduziert werden konnten,<br />
war in der Kontrollgruppe ein Rückgang<br />
von nur zehn Prozent messbar.<br />
Eine andere Arbeit zeigte, dass bei<br />
Patienten, die am Tag vor sowie rund um<br />
eine Operation Musik und Entspannungsanleitung<br />
hörten, der Verbrauch von<br />
Schmerzmitteln um 54 Prozent und jener<br />
an Schlafmitteln um 63,6 Prozent sank.<br />
Lady Gaga wirkt stimmungsaufhellend<br />
Welche Art von Musik diese heilsame<br />
Wirkung entfaltet, hängt zwar auch von<br />
individuellen Vorlieben ab – dennoch<br />
gibt es verallgemeinerbare Muster. Klassische<br />
Musik wirkt auf viele Menschen<br />
beruhigend, Rock und Pop hingegen haben<br />
einen anregenden Effekt und mildern<br />
die Wirkung der klassischen «Immunkiller»<br />
wie Stress oder Müdigkeit.<br />
Lady Gagas Single «Alejandro» oder der<br />
U2-Hit «Beautiful Day» haben eine<br />
stimmungsaufhellende und leistungssteigernde<br />
Wirkung.<br />
Die wissenschaftliche Erklärung dafür<br />
liegt im Tempo der Lieder: «Normale<br />
Körperfunktionen laufen bei 72 Herzschlägen<br />
pro Minute ab. Bei einem Tempo von<br />
mehr als 72 Beats per Minute wirkt Musik<br />
aufputschend, bei weniger wirkt Musik dagegen<br />
beruhigend», erklärt Bernatzky.<br />
18 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Schuppenflechte<br />
Forschung Schmerztherapie <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 19
Kommen bald Organe aus<br />
dem 3D-Drucker?<br />
Noch klingt es wie Science Fiction, wenn Mediziner von Ersatzorgangen<br />
aus dem Drucker sprechen. Tatsächlich ist eine Leber aus dem Drucker noch<br />
ein ferner Traum. Andere Körperteile aber werden längst verbaut.<br />
Doreen Fiedler<br />
20 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Technik Neue Technologie<br />
M<br />
it rasanter Geschwindigkeit<br />
hat sich der 3D-Druck in<br />
der Medizin ausgebreitet.<br />
Hörgeräte und Zahnkronen<br />
stammen vielfach längst<br />
aus Druckmaschinen, auch für chirurgische<br />
Einmal-Instrumente sowie zur Herstellung<br />
von Modellen für das Proben eines Eingriffs<br />
wird die Technik verwendet. Selbst für Tabletten:<br />
Weil Epileptiker Pillen nicht schlucken<br />
können, wird eine sehr poröse Struktur<br />
im Drucker fabriziert, die bei Kontakt mit<br />
Flüssigkeit im Mund zerfällt.<br />
28 Prozent der Unternehmen aus der<br />
Medizintechnik und Pharmazie hätten<br />
schon Erfahrung mit 3D-Druck gesammelt,<br />
ermittelte die Unternehmensberatung<br />
Ernst & Young bei einer Umfrage in zwölf<br />
vor allem westlichen Ländern. Bei den<br />
Hörgeräten sei nahezu der ganze Markt<br />
umgestiegen, sagt Ernst & Young-Managerin<br />
Stefana Karevska. Dabei nutze die Medizintechnik<br />
das junge Verfahren häufiger<br />
als andere Branchen. Tendenz aber überall:<br />
steigend.<br />
Drucken statt verpflanzen<br />
«Das ist faszinierend», sagt Bilal Al-<br />
Nawas, leitender Oberarzt der Klinik für<br />
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der<br />
Unimedizin Mainz. «Die Chirurgen brauchen<br />
den 3D-Druck und die Patienten wünschen<br />
ihn. Dass wir von irgendwo im Körper<br />
ein Stück Knochen oder ein Stück<br />
Gefäss rausnehmen und das Teil irgendwo<br />
anders wieder einbauen – das kann nicht<br />
die Zukunft sein», sagt er.<br />
Als Pionier ist auch die Firma Eos<br />
aus der Nähe von München im boomenden<br />
Business mit dabei. Eos ist führender Anbieter<br />
im industriellen 3D-Druck von Metallen<br />
und Kunststoffen, die als Pulverwerkstoff<br />
vorliegen.<br />
Einer ihrer Drucker könne pro Tag 400<br />
individuelle Zahnkronen herstellen – zu einem<br />
Zehntel des Preises der konventionellen<br />
Fertigung, sagte Martin Bullemer, Experte<br />
für die Additive Fertigung im Medizin- und<br />
Dentalbereich bei Eos. «Im gesamten Orthopädie-Bereich<br />
geht es vorwärts.»<br />
Gedruckter Gefässersatz<br />
Was hingegen bisher nicht aus dem Drucker<br />
kommt, sind Schrauben – das können<br />
Drehmaschinen schneller. Auch gefräst<br />
und gegossen wird weiter. Die Forscher<br />
stürzten sich momentan lieber auf Gefässe,<br />
sagt Al-Nawas. In Tierversuchen habe man<br />
sie schon erfolgreich als Ersatz eingebaut.<br />
«Gefässe sind der erste Schritt. Wenn das<br />
klappt, dann kann man sich auch vieles andere<br />
vorstellen.» Leber und Schilddrüse<br />
ANZEIGE<br />
Hier will<br />
ich arbeiten<br />
Unser attraktives Stellenangebot finden Sie unter:<br />
www.karriere.tertianum.ch<br />
seien sehr interessant – aber auch noch sehr<br />
weit weg von der Anwendung.<br />
Beim 3D-Druck werden Werkstoffe<br />
wie Titan, Kunststoff oder Keramik mit<br />
Hilfe von Lasern oder Infrarotlicht Schicht<br />
für Schicht verschmolzen. Da die Schichten<br />
nur hundertstel Millimeter dick sind,<br />
ist das Verfahren äusserst präzise. Auch<br />
komplizierte Wabenstrukturen sind möglich,<br />
die durch Bohren oder Spritzen nicht<br />
herstellbar wären. Der Bauplan ist individuell<br />
– und wird etwa nach einem Scan aus<br />
dem Computertomographen entworfen.<br />
Chirurgen wie Al-Nawas würden gerne<br />
etwas anderes verbauen als Metall, wenn<br />
sie zum Beispiel nach einem Pferdetritt ein<br />
Gesicht rekonstruieren. «Wir wollen am<br />
liebsten ein Material, das vom Körper zu<br />
Knochen umgebaut wird, wie etwa Magnesium.<br />
Oder zumindest ein Material, das knochenähnlicher<br />
ist», sagt er. Daran tüftelt er<br />
zusammen mit Materialforschern der Uni<br />
Darmstadt und der Unimedizin Mainz.<br />
Eierstöcke, Knorpel und Muskeln<br />
Forscher der Northwestern University in<br />
Chicago haben im 3D-Druck schon funktionsfähige<br />
Eierstöcke von Mäusen produziert.<br />
Nach der Transplantation entwickelten<br />
die weiblichen Tiere ohne jegliche<br />
weitere Behandlung Eizellen, die auf natürliche<br />
Weise befruchtet wurden, wie das<br />
Team vor wenigen Tagen im Fachblatt «Nature<br />
Communications» berichtete.<br />
Im vergangenen Jahr hatten US-Forscher<br />
gezeigt, dass Knorpel und Muskelstücke<br />
aus dem Drucker anwachsen und<br />
sich dort Blutgefässe und Nervenverbindungen<br />
bilden. Das ist einer der ganz grossen<br />
Knackpunkte der 3D-Teile.<br />
Dabei sind die gedruckten Individual-<br />
Stücke keineswegs nur etwas für Menschen<br />
in den reicheren Ländern. Eine Untersuchung<br />
mit 19 Patienten mit Unterschenkelamputationen<br />
in Togo, Madagaskar und<br />
Syrien zeige, dass mit einem leichten<br />
3D-Scanner eine digitale Form der Gliedmasse<br />
erstellt werden könne, erklärte die<br />
Hilfsorganisation Handicap International.<br />
Anschliessend sei mit einem 3D-Drucker<br />
eine massgeschneiderte Fassung hergestellt<br />
worden. Das eröffne neue Möglichkeiten<br />
gerade in entlegenen Gebieten und Konfliktzonen.<br />
(mit Material der Agenturen)<br />
Suchen Sie einen Nebenerwerb auf<br />
selbständiger Basis?<br />
Dann sind Sie<br />
bei uns absolut richtig!<br />
seriöse Schulung ■<br />
freie Zeiteinteilung ■<br />
keine eigene Finanzierung ■<br />
kein Umsatzdruck ■<br />
keine teure Lagerhaltung ■<br />
kompetente Unterstützung ■<br />
optimale Warenverfügbarkeit ■<br />
gute Verdienstmöglichkeiten ■<br />
Nähere Informationen unter<br />
www.joergkressig.ch<br />
KOSMETIKBERATERIN<br />
IM NEBENJOB
Alterspsychiatrie in der<br />
Praxis und im Pflegeheim<br />
Die Zahl hochbetagter Menschen, die gleichzeitig unter psychischen Störungen<br />
leiden, wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Eine alterspsychiatrische<br />
Diagnostik und Behandlung bietet einen grossen Mehrwert für die Lebensqualität.<br />
Dr. Ulrich Erlinger<br />
I<br />
n der alterspsychiatrischen Praxis stellen sich vor allem<br />
Patienten mit Depression mit den verschiedensten Kofaktoren<br />
vor, zum Beispiel nach Verlusterlebnissen, bei und<br />
nach schweren Erkrankungen wie Schlaganfall und<br />
Herzinsuffizienz, chronischen Schmerzen oder nach einem<br />
Sturz. Häufig entsteht die Depression auch bei der Pflege<br />
demenzkranker Angehöriger. Einsamkeit, alte, unbewältigte<br />
Konflikte oder Sorgen vor einem Umzug in eine altersgerechtere<br />
Umgebung sind ebenfalls häufige Begleit- und Risikofaktoren.<br />
Nicht selten liegt ein zusätzlicher Medikamenten- und<br />
Alkoholmissbrauch vor. Die häufigsten psychiatrischen Hauptdiagnosen<br />
bei den alterspsychiatrischen Patienten im Pflegeheim<br />
sind Demenz, Delir, schwere Verhaltensauffälligkeiten<br />
bei fortgeschrittener Demenz (BPSD), aber auch Depression<br />
sowie Sucht bzw. Medikamentenmissbrauch.<br />
Fast alle hochbetagten Patienten zeigen die im Alter typische<br />
Polymorbidität, welche zumeist mit einer Polypharmazie<br />
verbunden ist. Dementsprechend entfällt ein grosser Teil des<br />
Aufwandes bei einer ambulanten Neuaufnahme oder einem<br />
alterspsychiatrischen Konsiliums im Pflegeheim auf die Erfassung<br />
aller Diagnosen, der damit verbundenen Befunde und der<br />
Medikation. Die Würdigung eines möglichst aktuellen EKG,<br />
relevanter Laborbefunde sowie eine gründliche Systemanamnese,<br />
ein körperlicher Befund und die Erfassung der Funktionalität<br />
(ADL, IADL) sind ebenfalls Teil des Assessments. Ein<br />
ungünstiges Medikament gegen Depression bei Herzkrankheit,<br />
die fehlende Berücksichtigung von Schmerzen, einer<br />
Blutarmut oder chronischer Atemnot bei der Depressionsbehandlung,<br />
das Übersehen eines Harnverhaltes bei der Behandlung<br />
von Agitiertheit eines Patienten mit schwerer Demenz<br />
oder die fehlende Sicht auf die Sturzgefährdung bei der Behandlung<br />
mit Psychopharmaka sind Beispiele für Interventionen,<br />
die dem Patienten mehr schaden als nützen können. Diese<br />
Beispiele verdeutlichen, warum es so wichtig ist, die psychischen<br />
Symptome des Patienten in einen medizinischen Gesamtzusammenhang<br />
zu setzen, wofür zusätzlich die Erfragung<br />
und Untersuchung der Funktionalität wichtig ist. Wenn die<br />
Patienten in der alterspsychiatrischen Praxis keinen Hausarzt<br />
haben, möchten sich viele Patienten wegen der verschiedenen<br />
chronischen Begleiterkrankungen nicht in einer der Walk-In-<br />
Praxen vorstellen, sondern begrüssen das Management dieser<br />
allgemeinmedizinischen Erkrankungen im Rahmen der psychiatrischen<br />
Behandlung. Eine Praxisinfrastruktur, die Blutentnahmen,<br />
die Ableitung eines EKG, körperliche Untersuchungen<br />
einschliesslich die der Funktionalität sowie das<br />
schnelle Versenden von Überweisungen ermöglicht, ist für<br />
diese Seite der alterspsychiatrischen Arbeit von Vorteil.<br />
Der Alterspsychiater als Heimarzt<br />
Bei der Arbeit als Heimarzt gehört neben der Diagnostik und<br />
Behandlung von psychischen Störungen unter anderem der<br />
Umgang mit strukturellen Herzerkrankungen, mit entgleistem<br />
Bluthochdruck und Blutzucker, chronischen Lungenerkrankungen<br />
und Infektionen der Harn- und Luftwege sowie<br />
Schmerzbehandlung zum klinischen Alltag. Diese anspruchsvolle<br />
Aufgabe sollten Psychiater, wenn sie denn als Heimarzt<br />
tätig sind, auch abhängig von ihrer Vorerfahrung in möglichst<br />
engem Austausch mit den an der Behandlung ebenfalls<br />
beteiligten Internisten angehen, wobei ein Tandem aus ➔<br />
ANZEIGE<br />
Die individuellen Wohn- und Betreuungsangebote von<br />
Senevita schenken Lebensqualität im Alter. Wir sind ein<br />
privates Dienstleistungsunternehmen, erfolgreich in der<br />
Betriebsführung von Seniorenresidenzen, Alters- und<br />
Pflegezentren sowie betreuten Wohnanlagen.<br />
Die Senevita-Familie wächst – und zählt mittlerweile über<br />
1700 Mitarbeitende in der ganzen Deutschschweiz. Zur<br />
Verstärkung unserer motivierten Teams suchen wir ab<br />
sofort initiative Persönlichkeiten als<br />
Dipl. Pflegefachpersonen<br />
50 – 100%<br />
In unseren gleichermassen modernen wie behaglichen<br />
Häusern wollen wir älteren Menschen ein selbstbestimmtes<br />
Leben in Sicherheit und Würde bieten. Dieses Ziel ist<br />
nur mit motivierten Mitarbeitenden erreichbar, die unsere<br />
Bewohnerinnen und Bewohner mit Freude begleiten,<br />
betreuen und einfühlsam pflegen. Wir sind bestrebt, Ihnen<br />
dafür optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn<br />
nur wer gerne zur Arbeit kommt, macht diese auch gut.<br />
Detaillierte Informationen zu den vakanten Stellen an<br />
diversen Standorten finden Sie auf unserer Webseite<br />
www.senevita.ch.<br />
Unsere Betriebe befinden sich in den Kantonen Aargau,<br />
Basel, Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn und Zürich.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem Hinweis<br />
«Altavista».<br />
Senevita AG<br />
Worbstrasse 46 | Postfach 345 | CH-3074 Muri b. Bern<br />
Tel. 031 960 99 99 | kontakt@senevita.ch | www.senevita.ch<br />
22 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Fokus Alterspsychiatrie
Prävention und Behandlung von<br />
Migräne mit Nervenstimulation<br />
Rund eine Million Menschen in der Schweiz leiden unter Migräne. Durch ein neues<br />
Therapieverfahren, bei dem der Hirnnerv Trigeminus stimuliert wird, lässt sich Migräne<br />
ohne den Einsatz von Medikamenten reduzieren oder lindern.<br />
Publireportage<br />
Die Zusammenarbeit medizinischer Fachbereiche muss gut koordiniert werden.<br />
Alterspsychiater und Geriater wohl die<br />
fachliche Kombination ist, von der der<br />
hochbetagte Patient am meisten profitiert<br />
(Erlinger & Bergmann, <strong>2017</strong>). Im<br />
Behandlungsteam, das mit der spezialisierten<br />
Pflege im Pflegeheim zusammenarbeitet,<br />
ist neben der Medizin idealerweise<br />
auch die Gerontopsychologie und oder<br />
Neuropsychologie, ressourcenorientierte<br />
Aktivierungstherapie, altersspezialisierte<br />
Physiotherapie und Seelsorge vertreten.<br />
Empfehlenswert ist die Verankerung aller<br />
Assessments im elektronischen Dokumentationssystem<br />
der möglichst in das Heim<br />
integrierten Arztpraxis, wobei ein Abgleich<br />
der Informationen der verschiedenen<br />
Berufsgruppen empfehlenswert ist.<br />
Eine Fragmentierung der medizinischen<br />
Informationen über den einzelnen Patienten,<br />
wie sie häufig vorliegt, sollte überwunden<br />
werden. Als Beispiel soll hier die Physiotherapie<br />
dienen, von der der hochbetagte<br />
und polymorbide Patient noch mehr profitiert,<br />
wenn die Physiotherapeutin über die<br />
kognitiven Defizite des Patienten informiert<br />
ist und bei der Behandlung darauf<br />
Rücksicht nehmen kann.<br />
Psyche und Körpergesundheit<br />
wichtig für Lebensqualität<br />
Die Lebensqualität und damit auch das<br />
seelische Wohlbefinden im höheren Alter<br />
hängen zum grossen Teil von körperlichen<br />
Parametern ab. Am Beispiel der Depression<br />
nach Herzinfarkt wird deutlich, dass<br />
einerseits die Schwere der strukturellen<br />
Herzerkrankung mit den daraus resultierenden<br />
Einbussen an Leistungsfähigkeit<br />
und damit auch die Resultate der kardiologischen<br />
Behandlung das Risiko der Entstehung<br />
einer Depression massgeblich beeinflussen,<br />
und andererseits eine eventuell<br />
auftretende Depression die Überlebenschancen<br />
nach einem Herzinfarkt senkt.<br />
Bei Delirien, Verhaltensauffälligkeiten und<br />
psychischen Leiden bei Demenz, Erkrankungen<br />
und Syndromen, die der Alterspsychiater<br />
vor allem im Heim behandelt, ist<br />
immer die Prüfung und allfällige Behandlung<br />
typischer Auslöser angezeigt. Solche<br />
Auslöser können eine akute somatische Erkrankung,<br />
eine Verschlimmerung einer<br />
chronischen Erkrankung oder eine neu aufgetretene<br />
funktionelle Einschränkung sein.<br />
Um die Wechselwirkungen zwischen körperlichen<br />
und seelischen Leiden für eine<br />
Behandlung und den Erhalt oder die Verbesserung<br />
der Lebensqualität polymorbider<br />
und betagter Patienten nutzen zu können,<br />
ist es deshalb sinnvoll, geriatrische<br />
und alterspsychiatrische Standards zu<br />
kombinieren, wie oben bereits beschrieben.<br />
Sowohl in der Praxis als auch im Pflegeheim<br />
sollten diese altersmedizinischen As-<br />
sessments und Behandlungen auch im<br />
Rahmen alterspsychiatrischer Behandlungen<br />
durchgeführt oder berücksichtigt werden,<br />
wenn sie bereits vorliegen.<br />
Dr. med. U.<br />
Erlinger<br />
Herr Dr. med. U. Erlinger M.P.H. ist Inhaber<br />
einer Praxis für Alterspsychiatrie<br />
mit Standorten an der Beckenhofstrasse 6,<br />
8006 Zürich (Partner in der Psychiatrischen<br />
Praxisgemeinschaft Zürich) und<br />
im Pflegezentrum Gorwiden, 8057 Zürich.<br />
Er ist spezialisiert auf die Behandlung<br />
von mehr- und vielfach erkrankten, polymorbiden,<br />
Patienten, die auch unter<br />
psychischen Symptomen leiden. Herr<br />
Dr. med. U. Erlinger verfügt über langjährige<br />
Berufserfahrung als Leitender<br />
Arzt im Stadtärztlichen Dienst Zürich<br />
und als Chefarzt Alterspsychiatrie des<br />
Sanatoriums Kilchberg.<br />
P<br />
ulsierende, einseitige Kopfschmerzen, begleitet von Übelkeit,<br />
Licht- und Lärmsensibilität sowie sensorische oder motorische<br />
Störungen gehören zu den Symptomen einer akuten<br />
Migräne. Weltweit leiden 18 % der Frauen und 6 % der Männer<br />
an Migräne 1 .<br />
Herkömmliche Behandlungsmethoden reichen kaum aus<br />
Primäres Ziel der Migränebehandlung ist es, die Anzahl und Intensität<br />
von Anfällen zu reduzieren und zu verhindern, dass sich ein chronischer<br />
Schmerz entwickelt. Verschiedene Medikamente und Alternativtherapien<br />
stehen zur Verfügung, um Migräne vorzubeugen und zu<br />
behandeln. Trotzdem reicht das breite Angebot oft nicht aus. «Eine<br />
Schwierigkeit in der Migränebehandlung kann sein, dass medikamentöse<br />
Therapien Unverträglichkeiten mit sich bringen oder wenig wirken»<br />
meint PD Dr. med. Andreas Gantenbein, Präsident der Schweizerischen<br />
Kopfwehgesellschaft.<br />
Sichere und wirksame Migränetherapie ohne Einsatz von<br />
Medikamenten<br />
Eine neue Möglichkeit der Migränebehandlung bietet das Therapiesystem<br />
Cefaly. Das leichte, ca. 5 cm grosse Gerät wird mit einer Klebeelektrode<br />
an der Stirn angebracht und stimuliert mit feinen Impulsen<br />
den Trigeminus-Nerv (Abb. 1). Dieser Hirnnerv ist bei der Entstehung<br />
der Migräneschmerzen involviert. Eine randomisierte, placebokontrollierte<br />
Doppelblindstudie zeigte, dass die regelmässige Anwendung von<br />
täglich 20 Minuten die Häufigkeit von Migräneanfällen reduziert<br />
(Abb. 2) 2 . Eine weitere Studie zeigte, dass sich der Migräne-Arzneimittelkonsum<br />
um 75 % senken kann 3 . Die Wirksamkeit von Cefaly zeigte<br />
sich bei 75 % aller Nutzer, die das Therapiesystem regelmässig und<br />
korrekt anwendeten. Während einer Migräne- oder Kopfschmerzattacke<br />
kann die Anwendung von Cefaly die Schmerzen lindern und die<br />
Migränedauer verkürzen. «Cefaly bietet Betroffenen eine interessante<br />
und evidenzbasierte Ergänzung zur medikamentösen Therapie», erklärt<br />
PD Dr. med. Andreas Gantenbein.<br />
Weitere Informationen zu Cefaly finden Sie unter<br />
www.cefaly.ch<br />
1<br />
Webseite der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft: www.headache.ch<br />
2<br />
Schoenen, J., Vandersmissen, B., Jeangette, S., Herroelen, L., Vandenheede,<br />
M., Gérard, P., Magis, D. (2013). Neurology, 80(8), 697-704.<br />
3<br />
Russo, A., Tessitore, A., Conte, F., Marcuccio, L., Giordano, A., Tedeschi, G.<br />
(2015). The Journal of Headache and Pain, 16(1):69<br />
Tägliche, 20-minütige Stimulation des Trigeminus-Nervs<br />
mit Cefaly.<br />
0.5<br />
0.0<br />
-0.5<br />
-1.0<br />
-1.5<br />
Placebo<br />
-2.0<br />
Cefaly<br />
-2.5<br />
*<br />
-3.0<br />
0 1 2 3 Months<br />
Reduktion der Migränetage durch regelmässige Anwendung<br />
von Cefaly 2 .<br />
24 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Fokus Alterspsychiatrie<br />
Migräne Neuer Behandlungsansatz <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 25
Palliative Care –<br />
ein Konzept oder<br />
eine Haltung?<br />
Die Zielsetzungen von Palliative Care sind vielfältig – Gedanken zu einem Thema,<br />
welches nicht nur in den Medien ein Dauerbrenner ist.<br />
Maren Nielsen<br />
S<br />
owie der Begriff Palliative<br />
Care fällt, wird darunter meistens<br />
Sterbebegleitung verstanden<br />
oder er wird nur auf den<br />
Bereich der Krebserkrankungen<br />
reduziert. Das geht nicht nur vielen<br />
Menschen so, welche nicht im Gesundheitswesen<br />
tätig sind, sondern trifft auch<br />
häufig auf Fachpersonen zu. Dabei beginnt<br />
Palliative Care viel früher und nicht erst<br />
dann, wenn ein Mensch sich in der Sterbephase<br />
befindet.<br />
Palliative wurde vom lateinischen<br />
Wort Pallium, Mantel / Ummantelung, abgeleitet.<br />
Care vom englischen Wort für<br />
Pflege, Betreuung und Fürsorge. Übertragen<br />
betrachtet bieten wir Menschen eine<br />
Art der Umhüllung, einen besonderen<br />
Schutz an.<br />
Palliative Care richtet sich an Menschen,<br />
welche unter chronisch fortschreitenden,<br />
unter unheilbaren oder lebensbedrohlichen<br />
Erkrankungen leiden.<br />
Die Zielsetzungen von Palliative<br />
Care sind vielfältig und orientieren sich<br />
immer am Wunsch des jeweiligen Betroffenen<br />
und dessen Angehörigen. Die<br />
Schwerpunkte der Betreuung und Behandlung<br />
liegen darin, Leiden jeglicher<br />
Art zu lindern und dem Betroffenen so die<br />
bestmögliche Lebensqualität, gemessen<br />
an seiner Situation, zu bieten. Der Experte<br />
für die Lebensqualität ist stets der Betroffene<br />
selbst, denn nur er kann entscheiden,<br />
was er als lebenswert empfindet.<br />
Die Zielsetzungen von<br />
Palliative Care sind vielfältig<br />
und orientieren sich<br />
immer am Wunsch des<br />
jeweiligen Betroffenen und<br />
dessen Angehörigen.<br />
Was ist eigentlich Palliative<br />
Care?<br />
Palliative Care beinhaltet medizinische<br />
Behandlungen, angemessene Schmerztherapien<br />
und pflegerische Interventionen.<br />
Dazu gehören aber auch Massnahmen,<br />
welche Betroffene psychisch, sozial und<br />
spirituell unterstützen. Es geht darum,<br />
möglichen Problemen und Belastungen<br />
vorzubeugen oder diese frühzeitig zu erkennen.<br />
Dann darauf zu reagieren, um<br />
diese angemessen zu behandeln. Es ist<br />
eine umfassende, ganzheitliche sowie individuelle<br />
Behandlung und Betreuung, daher<br />
ist diese auch sehr anspruchsvoll. Um<br />
diesen Herausforderungen begegnen zu<br />
können, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
unabdingbar.<br />
Aus diesem Grund ist es gerade auch<br />
bei chronisch fortschreitenden Erkrankungen<br />
sehr wichtig, die Möglichkeiten der<br />
Palliative Care vorausschauend und frühzeitig<br />
einzubeziehen, das heisst in Ergänzung<br />
zu kurativen (heilenden) und rehabilitativen<br />
Massnahmen. Es ist für Betroffene<br />
oft von grosser Bedeutung, dass ihr Gesundheitszustand<br />
lange stabilisiert werden<br />
kann, auch wenn eine Heilung nicht mehr<br />
möglich ist. Die Person gewinnt so die<br />
Möglichkeit, möglichst lange im gewohnten<br />
Umfeld aktiv zu leben. Diese stabile<br />
Phase sollte von den Betroffenen auch<br />
dahingehend genutzt werden, einen ➔<br />
ANZEIGE<br />
Bestes Preis-Leistungs-<br />
Verhältnis der Schweiz!<br />
I d’diga muesch higa!<br />
Infoservice: 055 450 54 19<br />
www.diga.ch/care<br />
26 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Thema Palliative Care
Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung<br />
zu erstellen. Damit die eigenen Wünsche,<br />
Bedürfnisse und Vorstellungen auch<br />
dann umgesetzt werden können, wenn der<br />
Betroffene es vielleicht nicht mehr selbst<br />
bestimmen oder äussern kann. Die Autonomie,<br />
der Wille des Betroffenen steht dabei<br />
im Vordergrund. Es trägt auch massgeblich<br />
zur Entlastung der Angehörigen bei, wenn<br />
sie darüber informiert sind, was eine Person<br />
entschieden und festgelegt hat. Wann<br />
immer möglich, sollte Palliative Care an<br />
dem Ort angeboten werden, welchen die<br />
betroffene Person wählt. Die ist nicht an<br />
Institutionen oder Örtlichkeiten gebunden,<br />
auch nicht an bestimmte Berufsgruppen<br />
und kann durchaus im privaten Lebensumfeld<br />
stattfinden.<br />
Palliative Care und das Sterben<br />
Palliative Care will den Tod nicht beschleunigen,<br />
aber auch nicht verzögern.<br />
Denn lebensverlängernde Massnahmen<br />
verlängern auch sehr häufig das Leiden.<br />
Ein Leben in Würde führen zu können, beinhaltet<br />
auch ein würdevolles Sterben. Ein<br />
anderer wichtiger Aspekt liegt in der Unterstützung<br />
von Angehörigen, damit sie die<br />
Krankheit des Patienten und die eigene<br />
Trauer verarbeiten können. Palliative Care<br />
bedeutet auch, sich mit ethischen Fragen<br />
auseinanderzusetzen. Es geht darum, eine<br />
ethische Grundhaltung gemeinsam im interdisziplinären<br />
Team zu entwickeln, zum<br />
Wohle von Betroffenen und Angehörigen.<br />
Unterstützend können hier auch die medizinisch-ethischen<br />
Richtlinien der Palliative<br />
Care sein, welche von der Schweizerischen<br />
Akademie der Medizinischen Wissenschaften<br />
entwickelt wurden.<br />
Palliative Care ist kein Konzept, sondern<br />
eine Haltung. Eine Haltung, die nach<br />
den Bedürfnissen der Betroffenen fragt.<br />
Das war eine der Hauptaussagen am 2. Zürcher<br />
Fachsymposium «Palliative Care im<br />
Jahr 2016».<br />
Entwicklung einer Haltung<br />
Eine Haltung ist jedoch nicht einfach vorhanden,<br />
eine Haltung muss gemeinsam und<br />
bereichsübergreifend entwickelt werden.<br />
Eine Auseinandersetzung mit den eigenen<br />
persönlichen Sichtweisen sowie auch den<br />
eigenen Ängsten zu den Themen Sterben<br />
und Tod ist dabei wichtig. Es erfordert Diskussionen<br />
und die Entwicklung gemeinsamer<br />
Werte. Einerseits für den professionellen<br />
Umgang miteinander und andererseits<br />
auch für die Erlangung oder Vertiefung der<br />
Dem Tod ohne Angst ins Auge sehen können.<br />
Fachkompetenz in Palliative Care. Denn<br />
längst nicht jede Fachperson im Gesundheitswesen<br />
verfügt über Grundkompetenzen<br />
in diesem Bereich. In der Schweiz existieren<br />
jedoch immer noch Lücken in der<br />
Versorgung, der Finanzierung, der Information,<br />
der Bildung und Forschung von<br />
Palliative Care. Der Bund und die Kantone<br />
haben daher beschlossen, die Palliative<br />
Care in der Schweiz gemeinsam mit den<br />
wichtigsten Akteuren zu fördern. Das Bundesamt<br />
für Gesundheit hat dazu die nationalen<br />
Leitlinien Palliative Care herausgegeben.<br />
Es wurden Ziele festgelegt, um die<br />
festgestellten Lücken zu schliessen und das<br />
Angebot von Palliative Care-Leistungen zu<br />
erweitern. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt<br />
sich als Fazit ziehen, dass man in der<br />
Schweiz im Bereich Palliative Care zwar<br />
unterwegs ist, jedoch viele der gesetzten<br />
Ziele noch nicht erreicht wurden. Denn<br />
noch immer haben nicht alle Menschen Zugang<br />
zu Palliative Care-Leistungen.<br />
Maren<br />
Nielsen<br />
Maren Nielsen, geb. 1965, ist diplomierte<br />
Pflegefachfrau und Dozentin für verschiedene<br />
Fach- sowie Führungsthemen,<br />
unter anderem auch für Palliative<br />
Care. Sie verfügt über langjährige Berufs-<br />
und Führungserfahrung im Akutsowie<br />
Langzeitbereich. Sie ist selbständig<br />
erwerbend und bietet Unterricht und<br />
Beratungen im Gesundheitswesen an.<br />
Als Kaderperson in der Pflege mitgestalten und<br />
mitentwickeln?<br />
Am Stadtrand von Zürich, mit Blick ins Grüne, werden in den Pflegezentren Witikon und Riesbach<br />
270 Menschen gepflegt und betreut.<br />
Als unser/-e neuer/neue Abteilungsleiter/-in 80 % - 100 % in Witikon haben Sie Freude an der<br />
spezifischen Pflege und Betreuung von betagten Menschen.<br />
Die Pflegeabteilung ist in 1er und 2er Zimmer aufgeteilt und umfasst insgesamt 27 Betten. Auf Ihrer<br />
Abteilung betreuen Sie multimorbid erkrankte Bewohner/-innen. Das stellt hohe Ansprüche an Sie<br />
und Ihr Team und erfordert Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Kreativität und Bereitschaft zu<br />
aussergewöhnlichen Lösungen. Ihr reicher Erfahrungsschatz vorzugsweise im Bereich Geriatrie<br />
kommt Ihnen hier zugute.<br />
Sie sind verantwortlich für die personellen, organisatorischen und operativen Belangen Ihres<br />
Teams sowie für das physische und psychische Wohlergehen der Ihnen anvertrauten Bewohner/-<br />
innen. Sie verstehen es, auf Ihrer Abteilung eine wohlwollende und unterstützende Teamkultur zu<br />
schaffen und können dafür auf motivierte und begeisterungsfähige Mitarbeitende zählen. Nicht nur<br />
Ihre Ausbildung auf Stufe HF Pflege, Ihre Führungserfahrung und Ihre Führungskompetenzen sind<br />
uns wichtig, sondern auch Ihre Lösungsorientierung, Ihre Fähigkeiten zur Beratung und last but not<br />
least - Ihre Kreativität. Zusätzlich schätzen wir Sie für Ihr Einfühlungsvermögen, Ihren<br />
wertschätzenden Umgang und für Ihre Fähigkeit, mit unseren Bewohner/-innen deren Leben im<br />
Hier und Jetzt gestalten zu können.<br />
Als Arbeitgeberin setzen wir Trends in der Gesundheitsbranche. Wir bieten unseren Mitarbeitenden<br />
attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und stellen modernste Arbeitsinstrumente zur Verfügung.<br />
Was Sie sonst noch von uns erwarten können, sagt Ihren gerne unsere Leiterin Pflegedienst,<br />
Cornelia Conzett. Sie erreichen sie unter 044 414 83 05. Rufen Sie an!<br />
Ihr Potenzial interessiert uns. Wir möchten Sie kennenlernen. Sie uns auch? Dann<br />
bewerben Sie sich per E-Mail, pzz-wir-jobs@zuerich.ch.<br />
28 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Thema Palliative Care<br />
XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 29
Info<br />
Gesundheit – OECD: Übergewicht<br />
und Fettleibigkeit nehmen<br />
weiter zu<br />
In den OECD-Ländern leiden immer mehr Menschen an<br />
Übergewicht und Fettleibigkeit. Im Schnitt sind mehr als die<br />
Hälfte der Erwachsenen sowie jedes sechste Kind davon betroffen.<br />
Das geht aus den jüngsten Daten der OECD hervor,<br />
die am Donnerstag veröffentlicht wurden.<br />
In den vergangenen fünf Jahren hat insbesondere auch<br />
der Anteil Fettleibiger weiter zugenommen, wie aus dem<br />
Bericht der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit<br />
und Entwicklung) hervorgeht. Als fettleibig gilt,<br />
wer einen Body Mass Index (BMI) von über 30 aufweist. Bei<br />
einem BMI von 25 bis 30 spricht man von Übergewicht.<br />
Besonders ausgeprägt ist dieses Problem in den USA,<br />
Mexiko, Neuseeland und Ungarn. In allen vier Ländern gelten<br />
mehr als 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung als<br />
fettleibig. In Japan und Korea sind es dagegen nur 3,7 beziehungsweise<br />
5,3 Prozent. Besonders<br />
hoch ist der Anteil<br />
auch in Deutschland, dort liegt<br />
er bei 23,6 Prozent.<br />
Die Schweiz liegt dabei<br />
deutlich unter dem OECD-<br />
Durchschnitt (19,5 Prozent),<br />
nämlich bei 10,3 Prozent. Allerdings<br />
wird der Anteil Fettleibiger<br />
laut dem «OECD Obesity<br />
Update <strong>2017</strong>» in der Schweiz<br />
und Korea bis 2030 voraussichtlich<br />
deutlich schneller ansteigen<br />
als bisher.<br />
23 Millionen US-Bürger wegen<br />
US-Gesundheitsreform ohne<br />
Versicherung<br />
Der neue Vorschlag der US-Republikaner zu einer<br />
Rückabwicklung von Obamacare könnte in den kommenden<br />
zehn Jahren etwa 23 Millionen Menschen die Versicherung<br />
kosten. Das geht aus Berechnungen des überparteilichen<br />
Haushaltsbüros des US-Kongresses hervor,<br />
die kürzlich veröffentlicht wurden. Vor allem auf Menschen<br />
mit Vorerkrankungen könnten erhebliche Mehrkosten<br />
zukommen.<br />
Die Berechnungen dürften es den Republikanern erschweren,<br />
das Gesetzespaket mit dem Namen American<br />
Health Care Act durch den Senat zu bringen. Mehrere Republikaner<br />
in der zweiten Parlamentskammer kündigten bereits<br />
an, dem Gesetz nicht zuzustimmen.<br />
Die Republikaner im Abgeordnetenhaus hatten das Gesetz<br />
verabschiedet, bevor das Haushaltsbüro seine Berechnungen<br />
vorgelegt hatte. Das hatte<br />
scharfe Kritik ausgelöst. Der Senat<br />
arbeitet derzeit an einer eigenen Fassung<br />
einer Gesundheitsreform.<br />
Der Umbau von Obamacare war<br />
eines von Trumps zentralen Wahlversprechen.<br />
Ein erster Reformvorschlag<br />
war gescheitert, bevor er zur<br />
Abstimmung gestellt worden war.<br />
Die Republikaner lehnen Obamacare<br />
grundsätzlich als einen zu starken<br />
Eingriff des Staats in den Gesundheitsmarkt<br />
ab und halten sie<br />
für zu teuer.<br />
Blaues Licht steigert Leistung<br />
von Sportlern<br />
Sportler, die sich vor einem Wettkampf am Abend blauem<br />
Licht aussetzen, können sich im Endspurt deutlich steigern.<br />
Das haben Forscher der Universität Basel in einer Studie mit<br />
74 männlichen Athleten ermittelt. Ein Teil der Sportler wurde<br />
dafür während einer Stunde mit blauem monochromatischem<br />
Licht bestrahlt, wie die Universität Basel mitteilte. Die<br />
weiteren Athleten wurden hellem Licht oder einem Kontrolllicht<br />
ausgesetzt. Unmittelbar danach erfolgte ein zwölfminütiger<br />
Leistungstest auf dem Fahrrad-Ergometer.<br />
Das blaue Licht verbesserte die Fähigkeit der Athleten<br />
deutlich, ihre Leistung im Endspurt des Zeitfahrens zu erhöhen,<br />
wie die Forschenden des Departements für Sport,<br />
ANZEIGE<br />
Bewegung und Gesundheit im Fachblatt «Frontiers in Physiology»<br />
berichten. Die Steigerung stand zudem in Zusammenhang<br />
mit der eingesetzten Menge an blauem Licht.<br />
Die Schweiz hat die drittbeste Gesundheitsversorgung der Welt<br />
Die Gesundheitsversorgung hat sich in den allermeisten Ländern der Welt zwischen 1990 und 2015 verbessert. Die Schweiz<br />
landet dabei auf Platz 3, zeigt eine internationale Studie. Allerdings ist auch die Schere zwischen den Ländern mit der besten<br />
und der schlechtesten Versorgung weiter aufgegangen. Laut der Studie ist in 167 Ländern der Zugang zur Gesundheitsversorgung<br />
und deren Qualität deutlich besser geworden. Insgesamt haben Forschende unter der Leitung von Christopher<br />
Murray von der University of Washington in Seattle 195 Länder untersucht, darunter auch die Schweiz.<br />
Auf einer Skala von 0 bis 100 erreichte 2015 Andorra mit 94,6 den höchsten Wert, die Zentralafrikanische Republik mit<br />
28,6 den niedrigsten.<br />
30 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Info National und International<br />
XXX XXX JUNI <strong>2017</strong> ALTA VISTA 31
Kleine Hinweise –<br />
grosse Wirkung!<br />
Jeder kennt diesen Satz: «Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen<br />
Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker».<br />
Doch kaum jemand hält sich daran. Das kann fatale Folgen haben.<br />
Yvonne Beck<br />
Tabletten werden von Patienten oftmals als Gefahr für ihre Gesundheit gesehen.<br />
«<br />
Lesen Sie die Packungsbeilage!»,<br />
heisst es immer, aber ist<br />
das wirklich so sinnvoll? Der<br />
Beipackzettel in Arzneimitteln<br />
verunsichert viele Patienten.<br />
Verantwortlich dafür sind die darin beschriebenen<br />
Nebenwirkungen und in der Tat<br />
hören sich viele Nebenwirkungen recht bedrohlich<br />
an. Dabei soll die Packungsbeilage<br />
keine Angst machen, sondern Patienten<br />
schützen. Bereits seit Ende der 70er-Jahre ist<br />
der Beipackzettel Pflicht, um Patienten über<br />
Nutzen und Risiken ihres Medikaments aufzuklären.<br />
Natürlich auch über Nebenwirkungen<br />
und dafür wird jede jemals aufgetretene<br />
Nebenwirkung gelistet. So werden die<br />
Inhalte von Beipackzetteln für viele Patienten<br />
eine Hürde, ein verschriebenes Medikament<br />
einzunehmen. Um alle Anforderung<br />
des Gesetzesgebers zu erfüllen, werden die<br />
Packungsbeilagen oft lang und unübersichtlich<br />
– vor allem die Liste der Nebenwirkungen.<br />
Laut Studie nehmen 28% der Patienten<br />
ein verschriebenes Medikament aus Angst<br />
vor Nebenwirkungen nicht ein.<br />
Der digitale Beipackzettel<br />
Alle Arzneimittel, die wirken, können<br />
auch unerwünschte Nebenwirkungen haben.<br />
Aber können Nebenwirkungen auch<br />
deshalb auftreten, weil man sie erwartet?<br />
Es gibt zahlreiche Studien, die genau dieser<br />
Frage nachgegangen sind. Probanden<br />
wurden zur Kontrolle in Medikamentenund<br />
Placebo-Gruppen eingeteilt. Das eindeutige<br />
Ergebnis: Sogar in den Placebo-Gruppen<br />
berichtet durchschnittlich<br />
jeder Vierte über Nebenwirkungen, ohne<br />
den Wirkstoff je bekommen zu haben.<br />
Also nur weil man glaubt, die Pillen verursachen<br />
Nebenwirkungen, kann man sie<br />
auch bekommen. Was im Beipackzettel<br />
steht, kann also eintreten, wenn man es<br />
erwartet. Den Patienten sollte jedoch<br />
durch ausführliche Gespräche die Angst<br />
vor diesen möglichen Nebenwirkungen<br />
genommen werden.<br />
Sogar in den Placebo-<br />
Gruppen berichtet durchschnittlich<br />
jeder Vierte<br />
über Nebenwirkungen.<br />
Die Zukunft werden digitale Packungsbeilagen<br />
sein. Zurzeit laufen bereits<br />
einige Pilotprojekte. Der Vorteil liegt auf<br />
der Hand: Digitale Beipackzettel lassen<br />
sich aktualisieren, gehen nicht verloren und<br />
die Schrift lässt sich vergrössern (vermehrt<br />
beklagen sich besonders ältere Menschen,<br />
dass sie die kleingedruckten Beipackzettel<br />
nicht lesen können). Überdies lässt sich die<br />
Onlineversion gut mit anderen Informationen<br />
wie etwa Wechselwirkungen verknüpfen.<br />
Viele ältere Menschen scheuen jedoch<br />
immer noch das Internet (nur ein Viertel<br />
der über 70-Jährigen nutzt heute überhaupt<br />
das Internet), die Gespräche mit dem Apotheker<br />
oder dem Arzt werden also weiterhin<br />
die tragende Säule der Arzneimitteltherapie<br />
bleiben. Und gerade aus diesem<br />
Grund müssen besonders Ärzte und medizinisches<br />
Fachpersonal weiterhin geschult<br />
werden, um Patienten in verständlicher<br />
Form zu informieren. Dabei müssen vor<br />
allem Ärzte von ihrem Fachchinesisch Abstand<br />
nehmen, denn kein normaler Patient<br />
weiss, was beispielsweise eine orale Candidiasis<br />
ist, aber jeder würde Pilzerkrankung<br />
im Mund verstehen. Patienten sollten nicht<br />
das Gefühl haben, Medizin oder Pharmazie<br />
studiert haben zu müssen, um den Inhalt<br />
eines Beipackzettels zu verstehen oder<br />
den Ausführungen eines Arztes folgen zu<br />
können. Die Expertensprache muss entschlüsselt<br />
und Fachausdrücke übersetzt<br />
werden. Momentan scheint es, als schreibe<br />
man Beipackzettel eher für die Zulassungsbehörde<br />
als für die Patienten. Es geht mehr<br />
um die juristische Absicherung der ➔<br />
32 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Fertigarzneimittel Verwirrende Packungsbeilage<br />
Fertigarzneimittel Verwirrende Packungsbeilage <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 33
Hersteller als um Verständlichkeit und dabei<br />
treten die Interessen der Verbraucher<br />
bisweilen in den Hintergrund.<br />
ANZEIGE<br />
Burnout-Präventions-Tag<br />
Tages-Seminar zur Stressregulation in Gesundheitsberufen<br />
Samstag<br />
24. <strong>Juni</strong> 17<br />
Solothurn<br />
Freitag<br />
15. Sept. 17<br />
Zürich<br />
Samstag<br />
21. Okt. 17<br />
St. Gallen<br />
Wie Sie Ihren Stress im Alltag in den Griff bekommen!<br />
Ein Seminartag in lockerer Atmosphäre und Sie gewinnen<br />
fundierte Erkenntnisse über Stress und seine Auswirkungen.<br />
Soforthilfe! Erkennen Sie, wo Sie gerade stehen und was Sie<br />
jetzt für sich ganz persönlich unternehmen können.<br />
Der ideale Werkzeugkasten für Ihren Alltag! Wir vermitteln<br />
praktische Übungen, Tipps und Tricks und Sie kehren mit einem<br />
vollen Rucksack zur Stressregulation nach Hause zurück.<br />
Ihre Arbeit mit Menschen in besonderen Lebenssituationen fordert Sie stark heraus?<br />
Wollen Sie den hektischen Berufsalltag gelassener nehmen, abschalten, wesentliche Dinge<br />
effizienter angehen und mit mehr Lebensfreude durchs Leben schreiten?<br />
Die Burnout-Präventionstage helfen Menschen in Gesundheitsberufen, ihr körperliches<br />
und seelisches Gleichgewicht wieder herzustellen und erhalten zu können. Lernen Sie,<br />
ohne Vorkenntnisse, wirkungsvolle und einfach umsetzbare Strategien zur Stressvermeidung<br />
kennen. Es gibt für Sie Mittel gegen persönlichen und beruflichen Stress!<br />
Wächst Ihnen<br />
manchmal alles<br />
ein wenig über<br />
den Kopf?<br />
Das Ende des Fachchinesisch<br />
Verständliche Angaben über Sinn und<br />
Zweck eines Medikamentes sind die beste<br />
Motivation für den Patienten, es zuverlässig<br />
einzunehmen. Daher sollten schlichte<br />
und verständliche Sätze zum Standard einer<br />
jeden Beratung gehören. Sicherlich haben<br />
Fachausdrücke ihre Berechtigung,<br />
doch sollte man sie zudem noch allgemeinverständlich<br />
übersetzen, denn Patienten<br />
möchten mit ihrem Arzt kommunizieren<br />
können – und zwar auf Augenhöhe. Etwa<br />
100 Millionen Tonnen Arzneimittel landen<br />
jährlich auf dem Müll, ein Viertel der Packungen<br />
ist nicht angebrochen. Über 57 000<br />
Menschen sterben jährlich sogar an den<br />
Nebenwirkungen von Medikamenten – die<br />
Hälfte der Todesfälle wäre durch richtige<br />
Informationen über Risiken, Nebenwirkungen<br />
und Wechselwirkungen mit anderen<br />
Mitteln vermeidbar gewesen. Doch tatsächlich<br />
stirbt nur etwa einer von 10 000 bis<br />
100 000 Patienten pro Jahr an Arzneimitteln.<br />
Zum Vergleich: Durch Zigaretten<br />
stirbt etwa jeder 215. Raucher.<br />
Aber auch medizinisches Fachpersonal,<br />
Ärzte und Apotheker verstehen Beipackzettel<br />
manchmal falsch. Besonders bei<br />
der Angabe zur Häufigkeit von Nebenwirkungen<br />
schätzt man Medikamente als viel<br />
gefährlicher ein als sie eigentlich sind. Eine<br />
Studie des «Deutschen Ärzteblattes» fand<br />
heraus, dass Mediziner und Apotheker oftmals<br />
Schwierigkeiten haben, die Begriffe<br />
«häufig», «gelegentlich» oder «selten» in<br />
Bezug auf Nebenwirkungen richtig zu deuten.<br />
So gab die Mehrheit der Befragten<br />
beim Begriff «häufig» eine Nebenwirkungsrate<br />
von 60% an. Laut Definition des<br />
Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte<br />
beträgt die Rate jedoch nur<br />
maximal zehn Prozent. «Häufig» unerwünschte<br />
Wirkungen treten also in bis zu<br />
10 Prozent der Fälle auf. «Gelegentlich»<br />
sind Nebenwirkungen, wenn sie 0,1 bis weniger<br />
als 1 Prozent der Fälle betreffen und<br />
nur 0,01 bis weniger als 0,1 Prozent, wenn<br />
die Nebenwirkungen mit «selten» beschrieben<br />
werden. Doch auch auf andere Begriffe<br />
auszuweichen wäre keine Lösung, da andere<br />
Bezeichnungen auch wieder einen Interpretationsspielraum<br />
bieten. Fachleute plädieren<br />
deshalb immer mehr auf grafische<br />
Tools, die Eindeutigkeit erzeugen (bspw.<br />
10 Männchen und eins davon rot).<br />
Fazit<br />
Arzneimittel sind informationsbedürftige<br />
Produkte, mit denen Patienten nicht alleine<br />
gelassen werden dürfen. Im Beipackzettel<br />
fehlt die Information zum Nutzen des Medikaments<br />
und Risikoangaben, die der Patient<br />
auch versteht. Doch auch die Informationen<br />
für Ärzte und medizinisches Personal, die<br />
heute weitgehend von Pharmavertretern und<br />
an pharmagesponserten Veranstaltungen interessenorientiert<br />
informiert werden, müssen<br />
dringend verbessert werden. Die Pflicht<br />
des Arztes ist es, sich erstens selbst intensiv<br />
mit dem Vokabular des Beipackzettels auseinanderzusetzten<br />
und zweitens eine patientenbezogene<br />
Aufklärung durchzuführen,<br />
denn Beipackzettel erleichtern zwar die<br />
Aufklärung, ersetzten aber nie das Aufklärungsgespräch.<br />
Jeder Patient liest und versteht<br />
anders, der Arzt muss daher individuell<br />
die Richtung angeben.<br />
Wünschen<br />
Sie sich mehr<br />
Ruhe?<br />
„Lass Dich<br />
nicht so stressen!“<br />
Können Sie das nicht<br />
mehr hören?<br />
«Werden Sie Ihr<br />
eigener Entstress-Profi»<br />
Suchen Sie<br />
realisierbare Tipps<br />
zur Stressvermeidung?<br />
Preis / Person: Fr. 475.–<br />
Sonderangebot für Gruppen: ab 6 Personen Fr. 395.– statt 475.–<br />
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.sabl.ch<br />
SABL ist seit über 10 Jahren das schweizweit führende Ausbildungsinstitut für Burnout-<br />
Prävention, Stressbewältigung und -forschung. Die Ausbildungen im Bereich der Stressregulation<br />
beruhen auf einem einzigartigen, ganzheitlichen Konzept. Die Aus- und Weiterbildungen<br />
zum Trainer oder Experten für Stressregulation ist durch das Erfahrungs-<br />
Medizinische Register EMR anerkannt. SABL bietet, neben Beratungen und Coachings<br />
für Private, Firmen und Organisationen, auch individuelle Kurse für Spitäler und Pflegeeinrichtungen<br />
an.<br />
Aus der Praxis für die Praxis:<br />
Monatlich aktuell zum Vorzugspreis<br />
in ihrem Briefkasten!<br />
Jahresabo<br />
11 Ausgaben<br />
statt CHF 74.80<br />
nur CHF 65.–<br />
altavistamagazin.ch<br />
SABL 34 GmbH ALTA ˜ Püntenstrasse VISTA mai 24 ˜ 8932 <strong>2017</strong> Mettmenstetten Alter ZH Segen oder Fluch?<br />
+41 44 545 36 66 ˜ info@sabl.ch ˜ www.sabl.ch<br />
Schweizerisches Ausbildungsinstitut<br />
für Burnout-Prävention und Lebenscoaching<br />
XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 35
Schweizerische<br />
Stellenvermittlung für<br />
Gesundheitsberufe<br />
Danya Care<br />
Danya Care<br />
Danya Care<br />
Alle Vermittlungsdienste<br />
kostenlos – staatlich<br />
und kantonal anerkannt<br />
Wir suchen Sie (m/w) als: Pflegefachfrau/-mann HF,<br />
DNI, FaGe – auch für OP, Anästhesie und Intensivpflege<br />
Altenpfleger, Pflegeassistenten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten sowie<br />
Ärzte und medizinische Fachangestellte – kostenlose und unverbindliche Beratung!<br />
Nutzen Sie Ihre Chancen! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Alle weiteren Infos:<br />
www.danyacare.ch<br />
Danya Care GmbH, Albisstrasse 55, 8134 Adliswil, Telefon: 076 393 48 48, www.danyacare.ch