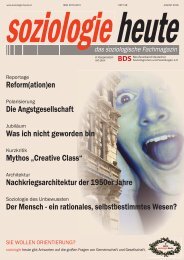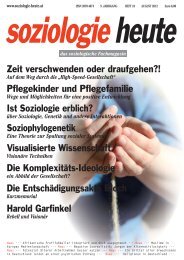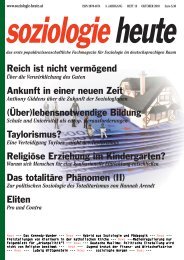soziologie heute April 2009
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>April</strong> <strong>2009</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 31<br />
1897 traf man Weber in Heidelberg,<br />
wo er allerdings ein Jahr später einen<br />
Nervenzusammenbruch erlitt<br />
und beurlaubt wurde.<br />
Im „Archiv für Sozialwissenschaft”<br />
veröffentlichte Weber programmatische<br />
Ausätze zur Soziologie, u. a. „Die<br />
Objektivität sozialwissenschaftlicher<br />
Erkenntnis” (1904) oder „Die protestantische<br />
Ethik und der Geist des Kapitalismus”<br />
(1905). In letzterem versuchte<br />
er nachzuweisen, dass - im<br />
Gegensatz zur marxistischen Lehre<br />
vom ökonomischen Determinismus<br />
- bei der Entstehung des modernen<br />
Kapitalismus in erster Linie religiöse<br />
Ideen bestimmend waren.<br />
1909 gründete Max Weber die Deutsche<br />
Gesellschaft für Soziologie. In<br />
seinem Haus in Heidelberg fanden<br />
fast jeden Nachmittag Diskussionen<br />
mit Intellektuellen statt; ab 1912 gab<br />
es auch einen wöchentlichen Jour<br />
Fixe, zu welchem auch Studenten<br />
kommen durften.<br />
Während des ersten Weltkrieges<br />
wandte sich Weber aus Sorge um<br />
die politische Stellung Deutschlands<br />
- insbesondere wenn die Nation den<br />
Max Weber und die Wertfreiheit der Wissenschaft<br />
Krieg verlieren würde und damit ein<br />
machtpolitischen Vakuum entstünde<br />
- gegen die deutschen Kriegsziele<br />
und den uneingeschränkten U-Boot-<br />
Krieg. Weber sah ein Zeitalter europäischer<br />
Ohnmacht angesichts zweier<br />
sich die Weltherrschaft künftig<br />
teilender Staaten, nämlich der Vereinigten<br />
Staaten und Rußland, voraus.<br />
Nachdem er kurzzeitig Berater der<br />
deutschen Delegation in Versailles<br />
war, folgte er 1919 einem Ruf nach<br />
München. Hier erregte er besonderes<br />
Aufsehen durch seine Vorträge über<br />
„Politik als Beruf und Wissenschaft<br />
als Beruf”. Am 14. Juni 1920 erlag<br />
Max Weber schließlich einer Lungenentzündung<br />
- kurz vor Fertigstellung<br />
seines Hauptwerkes „Wirtschaft und<br />
Gesellschaft”.<br />
Leider sind die Arbeiten Webers über<br />
die Ablösung von heimischen Stammarbeitern<br />
durch polnische Wanderarbeiter<br />
in der in den späten 1960er<br />
und 1970er Jahre aufkommenden<br />
Gastarbeiterfrage kaum beachtet<br />
worden.<br />
In seinem religionssoziologischen<br />
Werk „Die Protestantische Ethik und<br />
der Geist des Kapitalismus” versucht<br />
Weber aufzuzeigen, dass die Religion,<br />
und hier insbesondere der Calvinismus,<br />
für die Entstehung des „Geistes<br />
des Kapitalismus” bestimmend ist.<br />
Indem er wirtschaftlich erfolgreiche<br />
Gebiete miteinander verglich, stellte<br />
er fest, dass es stets calvinistische<br />
Gegenden waren, welche eine besonders<br />
hervortretende ökonomische<br />
Entwicklung aufwiesen. Im Calvinismus<br />
herrscht die Prädestinationslehre,<br />
also die Vorherbestimmung des<br />
Ausgewähltseins durch Gottes Gnade<br />
vor. Um sich dieser Gnadenauswahl<br />
zu versichern, ist es notwendig,<br />
Bei der Frage, ob Wissenschaftler sich nur der Untersuchung empirischer<br />
Tatsachen widmen sollen oder ob es auch ihre Pflicht sei, Urteile über soziale<br />
Zusammenhänge zu fällen und Stellung zu beziehen, sprach sich Weber klar<br />
für eine Trennung von Wissenschaft und Politik aus. Für ihn ist Wissenschaft<br />
ein Beruf mit strengen Regeln, an welche sich Wissenschaftler halten müssen.<br />
Da auch die Auswahl eines Forschungsthemas unter dem Einfluss der<br />
Erkenntnis und Wertideen des Wissenschaftlers steht, müssen auch diese in<br />
die wissenschaftliche Selbstreflexion einbezogen werden. Ist dies gegeben,<br />
dann können (und sollen) WissenschaftlerInnen auch Werturteile fällen.<br />
Noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg missverstand man das Postulat<br />
der Wertfreiheit und meinte, WissenschaftlerInnen sollten sich aus der Politik<br />
heraushalten. Erst in den 1960er Jahren änderte sich dies - wenn auch zögerlich.<br />
Nach wie vor ist dieses „Zwei-unterschiedliche-Welten-Denken” bequem.<br />
Verantwortungs- u. Gesinnungsethik<br />
In seinem Vortrag „Politik als Beruf“<br />
spricht WEBER u.a. von „Verantwortungsethik“<br />
und „Gesinnungsethik“.<br />
Erstere ist die Handlungsgrundlage<br />
der Politik und durch die unmittelbare<br />
Sorge um das Gemeinwesen<br />
definiert. Sie muss „mit Leidenschaft<br />
und Augenmaß“ die verschiedenen<br />
Interessen und Handlungsfolgen gegeneinander<br />
abwägen. Unter Gesinnungsethik<br />
versteht man die Haltung,<br />
die einen Menschen – auch wenn<br />
ihm persönlich oder anderen daraus<br />
Nachteile erwachsen - eher nach seiner<br />
Überzeugung als nach Nützlichkeitserwägungen<br />
handeln lässt.<br />
Erfolg im Beruf zu haben und seine<br />
Pflicht zu erfüllen. Indem die Calvinisten<br />
ihr ganzes Dasein unter eine<br />
strenge Askese stellten, sich jeglicher<br />
Vergnügungen, dem Genuss und<br />
Luxus enthielten, wurden die Gewinne<br />
immer wieder investiert. Dadurch<br />
entstanden letztlich - auch in Gegenden,<br />
wo die Calvinisten nur wenige<br />
Jahre aktiv waren - prosperierende<br />
Wirtschaftsregionen. Im Laufe der<br />
Zeit ging oftmals die religiöse Grundlage<br />
dieser Lebensführung verloren,<br />
was allerdings erhalten blieb, war<br />
diese Art der Lebensführung in Form<br />
eines bürgerlichen Berufsethos.<br />
In seiner Kategorienlehre unterscheidet<br />
Weber drei Idealtypen legitimer<br />
Herrschaft - legale, traditionale<br />
und charismatische Herrschaft - und<br />
erweitert diese idealtypische Beschreibung<br />
mit den jeweils entsprechenden<br />
Verwaltungsstäben. Sehr<br />
ausführlich befasst er sich mit der<br />
Bürokratie, welche zur unausbleiblichen<br />
Nivellierung, zum Formalismus<br />
und zur Unpersönlichkeit sowie zum<br />
Eigenleben der Verwaltung führt.<br />
Raymond Aron beschrieb Max Weber<br />
als einen „Mann der Wissenschaft,<br />
er war weder Politiker noch<br />
Staatsmann, doch zuweilen politischer<br />
Journalist” und Ralf Dahrendorf<br />
meinte im Nachwort zur Reclam-Ausgabe<br />
von „Politik als Beruf”:<br />
„Es gibt ja nicht gerade viele lesbare<br />
Anleitungen zum Beruf der Politik;<br />
unter ihnen ragt die von Max Weber<br />
hervor.”