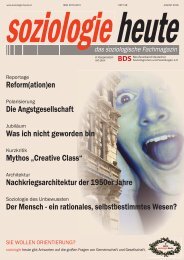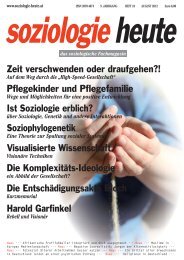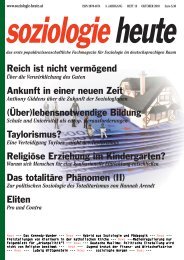soziologie heute April 2009
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>April</strong> <strong>2009</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 9<br />
Müller: Dieser Gedanke irritiert die<br />
meisten Menschen <strong>heute</strong> und man<br />
fragt sich, wer denn dann gegeneinander<br />
spielen soll. Aber zunächst mal<br />
muss man sich verdeutlichen, dass es<br />
aus der Perspektive funktionaler Differenzierung<br />
gedacht, überhaupt nicht<br />
notwendig ist, dass der Vergleich sportlicher<br />
Leistungen an irgendwelchen<br />
territorialen Genzen halt machen sollte.<br />
Ebensowenig wie dies Geldströme<br />
auf Finanzmärkten oder wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse tun. Grundsätzlich<br />
könnten also die Mannschaftsaufteilung<br />
sowie Wettkämpfe im Fußball anders<br />
organisiert sein.<br />
Ein gutes Beispiel dafür ist der Konföderationen-Pokal,<br />
der ja eigentlich als<br />
Turnier der Kontinente gedacht ist.<br />
Tatsächlich spielen aber nicht etwa<br />
kontinentale Auswahlmannschaften<br />
gegeneinander (also die besten elf<br />
Spieler Europas gegen die besten elf<br />
Spieler Afrikas etc.), sondern es treten<br />
die verschiedenen Kontinentalmeister<br />
gegeneinander an (also Nationalmannschaften).<br />
DEMNÄCHST<br />
IM VS-VERLAG<br />
Marion Müller<br />
Fußball als Paradoxon der Moderne<br />
Zur Bedeutung ethnischer, nationaler<br />
und geschlechtlicher Differenzen<br />
im Profifußball<br />
<strong>2009</strong>. Ca. 300 S. Br.<br />
ISBN: 978-3-531-16608-7<br />
EUR: ca. 29,90<br />
Ethnografie des Fußballs<br />
Die Ursachen für die große Bedeutung<br />
der Nation im Fußball hat historische<br />
Ursachen. Institutionalisierung und<br />
Verbreitung des Fußballs verliefen zeitgleich<br />
mit der Durchsetzung der Idee<br />
der Nation als einziger legitimen Form<br />
staatlicher Organisation. Hier scheinen<br />
vor allem das Zeitalter des Imperialismus<br />
und die beiden Weltkriege<br />
eine wichtige Rolle gespielt zu haben<br />
- und zwar sowohl für die massenhafte<br />
Verbreitung des Fußballs als auch der<br />
Idee der Nation. Hier lassen sich einige<br />
Synergieeffekte beobachten: Der<br />
Fußball (sowie der Sport allgemein)<br />
bot eine besonders geeignete Bühne<br />
zur Inszenierung nationaler Differenzen<br />
und nationaler Einheit. Außerhalb<br />
von Kriegen wurde Nation vor allem<br />
auf dem Fußballplatz erstmals tatsächlich<br />
erfahrbare Wirklichkeit. Und<br />
andersherum erfuhr das Spiel durch<br />
die politische Aufladung und die damit<br />
verbundenen Emotionen eine Steigerung<br />
an Bedeutung und Spannung, die<br />
es für das Publikum besonders attraktiv<br />
machte. In diesem Zusammenhang<br />
scheint vor allem die Militarisierung<br />
der Fußballsprache wichtig zu sein,<br />
die übrigens auch eine entscheidende<br />
Rolle für die Durchsetzung von Fußball<br />
als Männersport spielte.<br />
***<br />
Warum stört sich beim Fußball eigentlich<br />
niemand daran, wenn Franz Beckenbauer<br />
über die „angeborene Geschmeidigkeit der Afrikaner“<br />
sinniert? Warum fi nden wir die Existenz<br />
von Ausländerregelungen in der Bundesliga<br />
so selbstverständlich? Und weshalb ist<br />
die Vorstellung so abwegig, dass Frauen und<br />
Männer gemeinsam Fußball spielen?<br />
In jedem anderen Funktionssystem wären<br />
derartige partikularistische Diskriminierungen<br />
hochgradig legitimationspflichtig. Nur<br />
im Fußball bzw. im Sport werden nationale,<br />
ethnische sowie geschlechtliche Zuschreibungen<br />
unhinterfragt akzeptiert.<br />
Wieso aber gelten Ausländerbeschränkungen<br />
und Geschlechtersegregation nicht als Widerspruch<br />
zum sportlichen Leistungsprinzip und<br />
dem Inklusionspostulat funktional differenzierter<br />
Gesellschaften?<br />
Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit<br />
anhand einer historischen Analyse des<br />
Fußballsports und ethnografischer Untersuchungen<br />
in drei Bundesligaklubs beantwortet.<br />
Foto: Gerd Altmann, pixelio<br />
Fotos v.l.n.r.: : HAUK-Medien-Archiv, Peter, pixelio