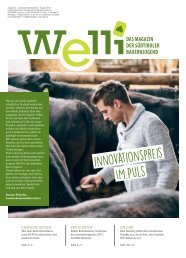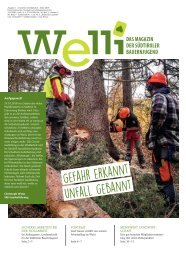Funktionärsleitfaden 2019
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LEITFADEN FÜR<br />
FUNKTIONÄRE<br />
FIT FÜR DEN<br />
VEREIN<br />
www.sbj.it
2<br />
DER INHALT<br />
AUF EINEN BLICK<br />
KAPITEL 1<br />
Die Südtiroler<br />
Bauernjugend<br />
S. 4-5<br />
KAPITEL 2<br />
Ehrenamt<br />
bringt´s!<br />
S. 6-7<br />
KAPITEL 3<br />
Mit Teamarbeit<br />
zum Erfolg<br />
S. 8-9<br />
KAPITEL 4<br />
Ortsobmann und<br />
Ortsleiterin<br />
S. 10<br />
KAPITEL 5<br />
Die Stellvertreter<br />
und die Ausschussmitglieder<br />
S. 11<br />
KAPITEL 6<br />
Der Schriftführer<br />
und der Kassier<br />
S. 12<br />
KAPITEL 7<br />
Neue Mitglieder<br />
anwerben?<br />
So geht´s ...<br />
S. 13-14<br />
KAPITEL 8<br />
Sitzungen<br />
gekonnt leiten<br />
S. 15-16<br />
KAPITEL 9<br />
Protokolle<br />
schreiben leicht<br />
gemacht<br />
S. 17<br />
KAPITEL 10<br />
Ortsausschuss:<br />
so wird gewählt<br />
S. 18-19<br />
KAPITEL 11<br />
Reden wie die<br />
Profis<br />
S. 20-24<br />
KAPITEL 12<br />
Die Welt der<br />
Medien: Öffentlichkeitsarbeit<br />
S. 25-30<br />
KAPITEL 13<br />
Veranstaltungen<br />
organisieren<br />
S. 31-35<br />
KAPITEL 14<br />
Das perfekte<br />
Foto<br />
S. 36-42<br />
KAPITEL 15<br />
Mit Weiterbildung<br />
einen Sprung<br />
voraus<br />
S. 43
3<br />
EIN LEITFADEN ZUR<br />
VEREINSARBEIT<br />
Funktionär sein heißt Verantwortung<br />
zu übernehmen, sich Ziele<br />
zu setzen und diese zu verwirklichen,<br />
neue Herausforderungen<br />
anzunehmen, Vorbild sein und<br />
sich für andere einzusetzen.<br />
Funktionär sein heißt aber auch<br />
Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewusstsein,<br />
neues Wissen<br />
und neue Freundschaften<br />
fürs Leben kennen zu lernen<br />
und dadurch auch persönlich zu<br />
wachsen.<br />
In den Reihen der Südtiroler Bauernjugend<br />
arbeiten über 1.300<br />
Funktionäre, die täglich auf<br />
Orts-, Bezirks- und Landesebene<br />
für die Südtiroler Bauernjugend<br />
ihr Bestes geben.<br />
Um sie bei ihrer täglichen Arbeit<br />
noch stärker zu unterstützen hat<br />
die Südtiroler Bauernjugend diesen<br />
<strong>Funktionärsleitfaden</strong> ausgearbeitet.<br />
Aufgeteilt in verschiedene Kapitel,<br />
mit vielen Tipps und Tricks<br />
und Beispielen soll er eine wertvolle<br />
Stütze bei der täglichen Vereinsarbeit<br />
sein. Daneben stehen drei<br />
hauptamtliche Mitarbeiter im SBJ-<br />
Landessekretariat allen Funktionären<br />
und Mitgliedern täglich mit Rat und<br />
Tat zur Seite.<br />
Wir wünschen Euch weiterhin viel<br />
Freude, Begeisterung und Genugtuung<br />
bei Eurer Arbeit für die Südtiroler<br />
Bauernjugend.<br />
Wilhelm Haller<br />
Landesobmann<br />
Angelika Springeth<br />
Landesleiterin<br />
Evi Andergassen<br />
Landessekretärin<br />
Impressum:<br />
Herausgeber: Südtiroler Bauernjugend (SBJ)<br />
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 5, 39100 Bozen,<br />
Tel. 0471 999 401 - bauernjugend@sbb.it - www.sbj.it<br />
Erscheinungsjahr: Februar <strong>2019</strong>
4<br />
DIE SÜDTIROLER<br />
BAUERNJUGEND<br />
Organisation<br />
Ortsgruppen: 149<br />
Mitglieder: ca. 9.000<br />
Funktionäre: >1.300<br />
Die Südtiroler Bauernjugend ist eine freiwillige, selbstständige,<br />
unabhängige und nicht gewinnorientierte Jugendorganisation.<br />
Sie hat ihren Sitz beim Südtiroler Bauernbund<br />
(SBB). Derzeit gliedert sich die Südtiroler Bauernjugend<br />
in 149 Ortsgruppen, die jeweils vom Ortsausschuss mit<br />
Ortsobmann und Ortsleiterin an der Spitze geführt werden.<br />
Diese 149 Ortsgruppen verteilen sich auf die sechs<br />
Bezirke: Bozen (33), Meran (27), Eisacktal (23), Pustertal(28),<br />
Unterland (11) und Vinschgau (27). Die Bezirksobmänner<br />
und -leiterinnen aller Bezirke bilden gemeinsam<br />
mit der Landesführung (Landesobmann und Landesleiterin<br />
mit jeweils 2 Stellvertreter/innen) die Landesleitung. Das<br />
oberste Organ der Südtiroler Bauernjugend ist die Mitgliederversammlung.<br />
Sie setzt sich zusammen aus allen Ortsgruppen<br />
der Südtiroler Bauernjugend.<br />
Die Südtiroler Bauernjugend will nicht nur die bäuerliche,<br />
sondern die gesamte Jugend im ländlichen Raum ansprechen.<br />
Gemeinsam wollen wir die Zukunft des ländlichen<br />
Raumes und unseres Landes mitgestalten. Ein Jugendverband<br />
macht ständig Entwicklungen durch. Seine Arbeit ist<br />
so gut wie es die vielen aktiven, ehrenamtlich tätigen Menschen<br />
sind. Die Themen der Südtiroler Bauernjugend sind<br />
zeitgemäß. Es ist selbstverständlich, dass der Verband<br />
durch wechselnde Menschen und neue Funktionäre immer<br />
wieder ein neues Gesicht erhält. In einer Jugendorganisation<br />
ist das gut so!<br />
Mitgliedschaft<br />
Die Mitgliedschaft können alle Jugendlichen zwischen 14<br />
und 35 Jahren erwerben, die sich mit den Zielen und den<br />
Satzungen der Südtiroler Bauernjugend identifizieren.<br />
Das Leitbild der Südtiroler Bauernjugend:<br />
Die Südtiroler Bauernjugend ist die größte Jugendorganisation<br />
in Südtirol und spricht alle Jugendlichen zwischen<br />
14 und 35 Jahren an.<br />
• Wir sind eine eigenständige Jugendorganisation im<br />
Südtiroler Bauernbund.<br />
• Wir sind eine aufgeschlossene Gemeinschaft und stehen<br />
Neuem und Modernem offen gegenüber; gleichzeitig<br />
pflegen und leben wir Kultur und Brauchtum<br />
unserer Heimat.<br />
• Wir gestalten die Gegenwart und die Zukunft unseres<br />
Landes aktiv mit und setzen neue Akzente.<br />
• Wir übernehmen Verantwortung in der Gesellschaft<br />
und vertreten unsere Meinung in Wirtschaft und Politik.<br />
• Wir sind bereit, mit weltlichen und kirchlichen Organisationen<br />
zusammenzuarbeiten.<br />
• Wir setzen uns für den Fortbestand der bäuerlichen<br />
Betriebe und für die Erhaltung unserer Kulturlandschaft<br />
ein.
5<br />
• Wir bieten den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung<br />
• Wir fördern die Aus- und Weiterbildung im fachlichen<br />
und persönlichkeitsbildenden Bereich.<br />
Die Ziele der Südtiroler Bauernjugend:<br />
Wirtschaft<br />
Die Südtiroler Bauernjugend bejaht die Verflechtung der<br />
verschiedenen Wirtschaftszweige, der in sinnvollem Ausmaße<br />
auch im Berggebiet künftig noch mehr Bedeutung<br />
zukommen soll. Um so dringlicher braucht es in Zukunft<br />
eine verantwortungsbewusste Planung von brauchbaren<br />
und machbaren Entwicklungsprogrammen, die mit dem<br />
unvermehrbaren Kulturgrund und Siedlungsraum sparsam<br />
umgehen und den Menschen in allen Regionen unseres<br />
Landes zufriedenstellende Lebens- und Arbeitsbedingungen<br />
gewährleisten.<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
Die Südtiroler Bauernjugend will, dass sich ihre Funktionäre<br />
und Mitglieder die bestmögliche Berufsausbildung aneignen.<br />
Eine gute Aus- und ständige Weiterbildung sollte<br />
für jeden Landwirt selbstverständlich sein. Unser Ziel: Kein<br />
Übernehmer eines landwirtschaftlichen Betriebes ohne<br />
landwirtschaftliche Fachschule. Auch für Nebenerwerbsbauern<br />
ist die Aneignung landwirtschaftlichen Fachwissens<br />
unerlässlich. Ein großes Anliegen im Bemühen um<br />
stetige Fortbildung und Qualifizierung ist die Persönlichkeitsbildung<br />
unserer Mitglieder und Funktionäre.<br />
Kultur und Brauchtum<br />
Die Bauernjugend ist der Tradition sehr verbunden. In der<br />
Brauchtumspflege sieht sie einen wichtigen Erhalt kultureller<br />
Identität. Alte Bräuche wie die Trachtenpflege schließen<br />
moderne Lebensformen nicht aus - im Gegenteil: sie<br />
bereichern sie.<br />
Politik<br />
Seit eh und je zählt das bäuerliche Element zu den maßgeblichen<br />
Trägern der politischen Ordnung in unserer Heimat.<br />
Deshalb fühlt sich die Bauernjugend dem politischen<br />
Ziel verpflichtet, die Interessen der ländlichen Jugend in<br />
demokratischer Weise in allen dafür geeigneten Gremien<br />
zu vertreten. Unsere Aufgabe ist es auch, die Jugend dazu<br />
zu befähigen, den Maßstab des politischen Denkens und<br />
Handelns am geschichtlichen Hintergrund unserer Heimat<br />
zu orientieren.<br />
Berufsstand<br />
Wir bekennen uns zur Demokratie in Theorie und Praxis.<br />
Die Südtiroler Bauernjugend will sie in ihren eigenen<br />
Reihen verwirklichen und ein lebendiges demokratisches<br />
Element in Gesellschaft und Berufsstand sein. Sie ist darum<br />
entschlossen, eine echte Nachwuchsorganisation im<br />
demokratischen Leben unseres Landes zu sein. Die Südtiroler<br />
Bauernjugend will unter Vermeidung jeder Voreingenommenheit<br />
zur Pflege eines gesunden Gemeinschaftssinnes<br />
aufrufen. Sie will auch Bindeglied sein zwischen den<br />
bäuerlichen und nichtbäuerlichen Familien und Einzelmenschen<br />
und Organisationen im ländlichen Raum.<br />
Freizeitgestaltung<br />
Wettbewerbe als beliebte, jugendgerechte und gemeinschaftsbetonte<br />
Form der Freizeitgestaltung, gehören zum<br />
Programm der Südtiroler Bauernjugend wie auch gesellige<br />
Veranstaltungen und Lehrfahrten. Als sinnvolle Freizeitgestaltung<br />
bieten sie Anlass für verschiedene Anregungen<br />
und Erfahrungen, die persönlich bereichern und zu einer<br />
Festigung der Gemeinschaft führen.<br />
Umwelt<br />
Die Erhaltung unserer Heimat als Erholungsraum ist seit jeher<br />
ein besonderes Anliegen der Südtiroler Bauernjugend.<br />
Wir setzen uns ein für umweltschonende landwirtschaftliche<br />
Produktionsmethoden, für die Erhaltung der Kulturund<br />
Erholungslandschaft und für die Bewusstseinsbildung<br />
in diesem Sinne.
6<br />
EHRENAMT<br />
BRINGT´S!<br />
Die Südtiroler Bauernjugend mit ihren Funktionären und<br />
Mitgliedern leistet eine Fülle von Aufgaben, und zwar<br />
regelmäßig, unbezahlt und freiwillig. Dazu braucht es<br />
Idealismus, den Mut zur Verantwortung und die Bereitschaft<br />
Freizeit zu opfern.<br />
Aber auch sonst erfüllt die Südtiroler Bauernjugend jene<br />
Voraussetzungen, wie sie auch andere ehrenamtliche<br />
Organisationen aufweisen: Die Organisation ist nach<br />
demokratischen Prinzipien geregelt, die Ämter werden<br />
durch Wahlen besetzt, es bestehen keine Gewinnabsichten.<br />
Ihre Tätigkeit ist breit gefächert, von der Kultur, der<br />
Bildung über die Freizeit bis hin zum Landschaftsschutz.<br />
Tatsache ist: Unsere Mitglieder sind ein wesentlicher Teil<br />
unserer ländlichen Gemeinden, indem sie sich aktiv im<br />
Dorfleben einbringen und sich für die ländliche Jugend<br />
und die Dorfgemeinschaft einsetzen.<br />
Freiwillig für die Gemeinschaft<br />
Das Ehrenamt ist der Klebstoff, der die Dorfgemeinschaft<br />
zusammenhält. Ehrenamtliche kümmern sich<br />
um alte Menschen, engagieren sich in Jugendvereinen,<br />
Sportvereinen oder retten Leben bei Rettungsorganisationen.<br />
Sie setzen sich für sozial Schwächere ein und<br />
pflegen Traditionen. Ohne Ehrenamtliche wäre unser<br />
Dorf, unsere Stadt und unser Land Südtirol nicht das<br />
was es heute ist.<br />
Es ist nicht immer einfach sich die wenige Freizeit neben<br />
Arbeit, der Mithilfe Zuhause zu nehmen und sich ehrenamtlich<br />
zu engagieren. Der ehrenamtliche Einsatz kann<br />
jedoch viele Vorteile für das spätere Berufsleben bringen.<br />
Man erlernt soziale Kompetenzen wie Offenheit,<br />
Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein.<br />
Aufgaben des Ehrenamts<br />
Ehrenamtlich tätig zu sein bedeutet, seine Aufgabe im<br />
Interesse der Organisation auszuüben, die Verantwortung<br />
für sein Handeln bzw. für seine Organisation zu<br />
übernehmen und damit auch - je nach Funktion - Entscheidungsträger<br />
innerhalb seiner Entscheidungsmöglichkeiten<br />
für seine Organisation zu sein. Das Ehrenamt<br />
orientiert sich an den Zielen und Leitlinien der Organisation.<br />
Ehrenamt birgt aber auch einen Spielraum zum Entwickeln<br />
neuer Ideen und Visionen sowie zur inhaltlichen<br />
Ausrichtung des Vereins. Dabei gilt aber immer der vorgegebene<br />
Rahmen, nämlich das Vereinsstatut.<br />
Das Ehrenamt hat die Arbeit mit Jugendlichen zum<br />
zentralen Inhalt. Motivation Jugendlichen für Themen<br />
und Inhalte, für Aktionen und Veranstaltungen ist ebenso<br />
wichtig wie das Motivieren anderer Ehrenamtlicher.<br />
Ehrenamt fördert das Bilden und Pflegen von Gemeinschaft,<br />
schafft soziales Kapital, vermittelt Ideale und<br />
trägt durch seine Tätigkeit positiv zum Gemeinwohl<br />
bei.<br />
Ideale Rahmenbedingungen für das<br />
Ehrenamt<br />
Wertschätzung<br />
Damit das Ehrenamt erhalten werden kann, braucht es<br />
Anerkennung und Wertschätzung für das Geleistete,<br />
Förderung und Verständnis seitens der Gesellschaft<br />
und der Politik. Schule und Arbeit unterstützen Ehrenamt,<br />
indem sie im angemessenen Maß Freistellung<br />
bzw. flexible Arbeitszeiten ermöglichen. Auch die Wertschätzung<br />
jener Jugendlichen, für die man sich engagiert,<br />
und von anderen Ehrenamtlichen ist ein wichtiger<br />
Motivationsfaktor für die Ehrenamtlichen.
7<br />
Klare Vereinsstrukturen<br />
Zu den idealen Rahmenbedingungen gehören auch klare<br />
Vereinsstrukturen, die Halt und Orientierung geben<br />
und rechtlichen Schutz bieten.<br />
Geselligkeit<br />
Das Vereinsklima muss stimmen und motivieren, und<br />
das Gesellige darf nicht zu kurz kommen. Ehrenamt<br />
muss auch Spaß machen, gerade weil es oft neben der<br />
beruflichen Tätigkeit ausgeführt wird.<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
Wer sich ehrenamtlich engagiert, will inhaltlich mitreden.<br />
Das nötige Rüstzeug dazu erhält man durch eine<br />
auf die Tätigkeit zugeschnittene und praxisorientierte<br />
Aus- und Weiterbildung, die zwar nicht Voraussetzung<br />
für die Übernahme eines Ehrenamtes, wohl aber ein<br />
wichtiges Element innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeiten<br />
darstellt.<br />
Infrastrukturen<br />
Ehrenamtlichkeit darf nicht an nicht bestehenden Infrastrukturen<br />
oder fehlenden Mitteln scheitern. Die<br />
öffentliche Hand fördert ehrenamtliche Initiativen und<br />
respektiert zugleich die Freiheit der Ideenvielfalt und<br />
die Eigenständigkeit der ehrenamtlich getragenen Organisationen,<br />
unter Beachtung des Prinzips der Eigenverantwortung.<br />
Gerne Funktionär sein<br />
Es gibt viele Gründe die dafür sprechen sich als Funktionär<br />
bei der Südtiroler Bauernjugend aktiv einzusetzen.<br />
Ansporn und Reiz kann es sein:<br />
• Bäuerliche Interessen zu vertreten<br />
• Ziele der Südtiroler Bauernjugend der Öffentlichkeit<br />
nahe zu bringen<br />
• Interesse und Verständnis für die Landwirtschaft<br />
zu wecken<br />
• Gedanken und Interessen auszutauschen<br />
• Freundschaften zu knüpfen<br />
• Übernahme von Organisationstätigkeiten<br />
• Einblicke in die Gemeinschaftsarbeit zu gewinnen<br />
• Verantwortung zu übernehmen<br />
• Brauchtumserhaltung (z.B. bei Kirchtag, Prozessionen,…)<br />
• Fachliche Weiterbildung<br />
• Sinnvolle Freizeitgestaltung für die Jugend<br />
• Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Vereinen<br />
• Mut, Initiative und Ideen aufzugreifen und zu verwirklichen<br />
• An Lehrfahrten und Vorträgen teilzunehmen<br />
• Aktuelle Themen aufzugreifen und kreativ zu sein<br />
• Das Dorfleben aktiv mitzugestalten<br />
• Chance in seiner persönlichen Kompetenz zu<br />
wachsen<br />
• Jugendarbeit zu fördern und diese gleichzeitig aufzuwerten<br />
Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen<br />
und Hauptamtlichen<br />
Ein Dauerbrenner in der Jugendarbeit ist der zum Teil<br />
unterschiedliche Zugang von Haupt- und Ehrenamtlichen.<br />
Haupt- und Ehrenamt sind in einer Vereinsstruktur<br />
häufig wie zwei Ehepartner in einer Ehe: Beide brauchen<br />
sich, schätzen und ergänzen sich – und dennoch<br />
kommt es immer wieder zu Konflikten.<br />
Für das gute Funktionieren eines Vereines, der sowohl<br />
Ehrenamt als auch Hauptamt in sich vereint, ist es unabdingbar,<br />
dass beide Seiten klare Rahmenbedingungen<br />
vorfinden und die Kommunikation zwischen beiden<br />
Ebenen reibungslos verläuft.
8<br />
MIT TEAMARBEIT<br />
ZUM ERFOLG<br />
Um erfolgreich im Ortsausschuss zu arbeiten braucht es<br />
einige Spielregeln. Wenn alle diese Spielregeln befolgen,<br />
kann gemeinsam sehr viel erreicht werden.<br />
Informationsaustausch<br />
Wer mitreden und mitarbeiten soll, benötigt Informationen.<br />
Fallen in einem Verein alle wichtigen Entscheidungen<br />
im stillen Kämmerlein, kann sich beim einfachen Mitglied<br />
schnell Desinteresse einstellen. „Die da“ wissen Bescheid,<br />
sollen auch sie tun, was zu tun ist. Information kann auf<br />
verschiedenen Wegen weitergegeben werden. Ein Rundschreiben<br />
eignet sich da ebenso wie ein Brief, eine SMS<br />
oder eine entsprechende Veranstaltung. Wesentlich ist,<br />
nicht erst dann zu informieren, wenn alle Entscheidungen<br />
schon getroffen sind. Werden wichtige Vereinsvorhaben<br />
rechtzeitig diskutiert, können Mitglieder zahlreiche neue<br />
Ideen einbringen. Zudem steigt die Bereitschaft das Vorhaben<br />
zu unterstützen.<br />
Jede Meinung ist wichtig<br />
Alle gelten lassen - damit diese Vorgangsweise greifen<br />
kann, soll am Beginn grundsätzlich jede Meinung gleich<br />
viel zählen. Gemeinsam erfolgt dann die Bewertung der<br />
Vorschläge, bis schließlich ein Beschluss gefasst wird. Wer<br />
eine andere Meinung äußert ist nicht gleich ein Gegner. Er<br />
sieht das Thema eben von einem anderen Standpunkt aus,<br />
beurteilt die Zusammenhänge anders oder hat nicht sämtliche<br />
Informationen. Die gegenteilige Meinung trägt vielleicht<br />
dazu bei, eine Angelegenheit einmal in völlig neuem<br />
Licht zu sehen. Vielen fällt es schwer die eigenen guten<br />
Ideen im Team mit anderen zu teilen.<br />
Kritik soll man nie im Ausschuss, sondern immer unter<br />
vier Augen aussprechen. Wer im Ausschuss kritisiert wird,<br />
muss sich verteidigen und fühlt sich bloßgestellt. Die meisten<br />
Menschen sehen unter vier Augen Fehler ein.<br />
Das „Wir“ in den Mittelpunkt<br />
Eine der Teamgeist-Erfolgsformeln heißt das „Wir“ in den<br />
Mittelpunkt stellen. Das heißt nicht „ich“ habe das geschafft,<br />
sondern „wir“ haben das gemeinsam geschafft.<br />
Wenn es darum geht Kollegen zu schützen, soll jeder handeln.<br />
Auch Lob soll angemessen weitergeleitet werden.<br />
TIPP<br />
Eine erfolgreiche Teamarbeit zeichnet sich aus:<br />
• Teamarbeit soll stets im Vordergrund stehen.<br />
• Information der Vereinsmitglieder ist Voraussetzung<br />
für Teamarbeit<br />
• Ideen sammeln ohne sie gleich zu zerpflücken. Was<br />
auf den ersten Blick vielleicht undurchführbar erscheint,<br />
kann sich zum großen Erfolg entwickeln<br />
• Sichtbar bei Diskussionen mitschreiben (Flipchart)<br />
• Projekte gut vorbereiten und Verantwortliche für die<br />
einzelnen Punkte bestimmen<br />
• Probleme offen ansprechen<br />
• Gute Moderation bei strittigen Themen kann verhindern,<br />
dass aus der Diskussion ein Streit wird. Bei Bedarf<br />
vereinsfremde Moderatoren hinzuziehen<br />
• Wer von der Einstellung ausgeht, das Team werde das<br />
gestellte Problem schon lösen (ich bin ja nicht dafür<br />
verantwortlich), der zerstört die gute Atmosphäre<br />
• Jedes Teammitglied ist nicht nur für den eigenen Teilbereich,<br />
sondern auch für den Gesamterfolg mit verantwortlich<br />
Motivation - der Schlüssel zum Erfolg<br />
Jedes Teammitglied muss seine eigenen Stärken und Fähigkeiten,<br />
sowie auch die eigenen Schwachpunkte kennen.<br />
Nun gilt es, die besonderen, individuellen Fähigkeiten im<br />
Team mit einzubringen. Das einzelne Mitglied ist verpflichtet,<br />
auch ohne Aufforderung, diese Stärken einzubringen,<br />
damit das Team die individuelle Stärke des einzelnen Mitgliedes<br />
nutzen kann.<br />
Beispiel: Wenn jemand im Team sehr gewandt im Schreiben<br />
ist, nützt es dem Team wenig, wenn niemand diese<br />
Stärke kennt. Es darf nicht sein, dass jemand aus falscher<br />
Bescheidenheit oder Angst vor zu viel Arbeit diese Stärke<br />
nicht zeigt. Ein anderer unbegabter Schriftführer hilft dem<br />
Team nicht so viel.
9<br />
Motivation aufbauen<br />
• Der Ton ist oft ausschlaggebend, ob eine Verhaltensänderung<br />
akzeptiert wird: das „Wie“ (Stimme, Ton,<br />
Atmosphäre) beeinflusst die Stimmung der Kommunikationsprozesse<br />
enorm. Wer echt, natürlich, partnerzentriert<br />
spricht d.h. wer das „Du“ ernst nimmt, wird<br />
feststellen, dass der Ton wirklich die Musik macht.<br />
• Anerkennung des Erfolgs d.h. das Erleben lassen des<br />
Erfolgs ist wichtig. Jeder Mensch möchte von anderen<br />
akzeptiert werden. Lob und die Bestätigung des<br />
Erfolgs steigern das Selbstwertgefühl. Durch Anerkennung<br />
werden die Erfolgserlebnisse bewusst gemacht.<br />
• Es ist wichtig die Mitarbeitenden auftragsorientiert<br />
arbeiten lassen ohne dauerndes Einflussnehmen und<br />
Kontrollieren. Die Führungskraft gewinnt nicht nur Zeit<br />
und Energie, die Freude und Begeisterung steigt auf<br />
beiden Seiten.<br />
• Sich selbst und andere motivieren kann nur jemand,<br />
der von seiner Meinung überzeugt ist und selbst über<br />
genügend Begeisterungsfähigkeit verfügt.<br />
• Glaubwürdigkeit erleichtert das Motivieren. Man muss<br />
selbst an das glauben, was man sagt.<br />
• Reizworte lösen bestimmte Denk- und Handlungsmuster<br />
aus. Vielen Begriffen müssen wir eine neue Bedeutung<br />
geben z.B. mit Umschreibungen. Oft muss<br />
mehr gesagt werden. Zusatzinfos sind notwendig<br />
damit es nicht zu Missverständnissen kommen<br />
kann.<br />
• Sachverhalte sollen von zwei oder mehreren Seiten<br />
gesehen werden: Es lohnt sich, vor jedem<br />
Klärungsgespräch gedanklich die Gegenposition<br />
versuchen zu verstehen.<br />
Nachwuchs aufbauen<br />
Wenn Ausschussmitglieder in einem Verein oft genug<br />
hören, dass ohne sie nichts läuft, glauben das einige<br />
irgendwann. Natürlich gibt es in einem Verein Funktionäre,<br />
die sich besonders einsetzen. Es ist ein Fehler,<br />
diese dann mit Arbeit zu überhäufen. Auch die beste<br />
Ortsleiterin, der beste Schriftführer wird irgendwann<br />
einmal abgelöst. Dann beginnt die Suche nach geeigneten<br />
Nachfolgern. Wo Verantwortung geteilt wird, ist<br />
es einfacher auch junge Leute einzubinden und aufzubauen.<br />
Wer weiß, dass er nicht alleine gelassen wird,<br />
ist eher bereit, im in der Vereinsarbeit aktiv mitzuwirken.
10<br />
ORTSOBMANN UND<br />
ORTSLEITERIN<br />
Der Ortsobmann und die Ortsleiterin sind die beiden<br />
Verantwortlichen der Ortsgruppe. Sie stehen für die eigene<br />
Ortsgruppe ein und präsentieren sie nach außen.<br />
Bei der Wahl zum Ortsobmann oder der Ortsleiterin<br />
ist es wichtig gut zu überlegen, geeignete Personen<br />
zu finden und diese dann tatkräftig zu unterstützen.<br />
Ortsobmann und Ortsleiterin sollen wie jedes andere<br />
Ausschussmitglied seriöse und verlässliche Personen<br />
sein.<br />
Die Aufgaben von Ortsobmann und<br />
Ortsleiterin:<br />
• Die Südtiroler Bauernjugend nach innen und außen<br />
vertreten<br />
• Verantwortung übernehmen und tragen<br />
• Vorbild sein - ein schlechtes Bild fällt auf den gesamten<br />
Verein zurück<br />
• Kontakt- und Ansprechpartner im Dorf sein<br />
• Sitzungen und Versammlungen leiten<br />
• Mitglieder motivieren<br />
• Umsetzung der Mitgliederinteressen<br />
• Informationen weitergeben<br />
• Neue Ideen verwirklichen<br />
• Kontakt zur Bezirks- und Landesebene pflegen und<br />
fördern<br />
• Arbeitsaufteilung zwischen den verschiedenen<br />
Ausschussmitgliedern koordinieren und je nach Fähigkeit<br />
delegieren<br />
• Kontrollieren und überprüfen (z.B. in steuerlichen<br />
Angelegenheiten)<br />
• Vertreter in anderen Gremien sein (z.B. Ortsbauernrat,<br />
Gemeindegremien, usw.)<br />
• Pflege von Tradition und Brauchtum<br />
• Gutes Klima im Ausschuss fördern<br />
• Entscheidungen treffen<br />
• Genehmigungen und Lizenzen einholen<br />
• Verantwortung für die Organisation und Koordination<br />
von Tätigkeiten, Aktionen und Veranstaltungen<br />
übernehmen<br />
Besondere Eigenschaften:<br />
Um die Südtiroler Bauernjugend gut zu vertreten und<br />
zu lenken, sollten die beiden Vorsitzenden verantwortungsbewusst<br />
sein. Sie sollten Organisationstalent<br />
und Durchsetzungsvermögen besitzen. Weiters zählen<br />
Pünktlichkeit und die Fähigkeit Aufgaben abzugeben<br />
zu ihren Stärken. Neben Kreativität soll auch das Verständnis<br />
für Andere und die Toleranz nicht fehlen.<br />
TIPP<br />
Eines der Wörter, die bei einer sinnvollen Vereinsarbeit<br />
gestrichen werden soll ist das Wort „man“. Man ist<br />
nicht Mitglied im Verein und hat auch noch nie etwas<br />
erledigt. Aufgaben gehören eindeutig zugeordnet. Es<br />
muss klar sein wer, was bis wann zu erledigen hat.
DIE<br />
STELLVERTRETER<br />
11<br />
Jede Ortsgruppe der Südtiroler Bauernjugend hat neben<br />
Ortsobmann und Ortsleiterin jeweils einen Stellvertreter<br />
bzw. Stellvertreterin. Diese sollen den Ortsobmann<br />
und die Ortsleiterin vertreten wenn diese eine<br />
Aufgabe nicht ausführen, einen Termin nicht wahrnehmen<br />
oder eine Verpflichtung nicht annehmen können.<br />
Ortsobmann und Ortsleiterin müssen sich auf die Stell-<br />
vertreter verlassen können. Wenn die Stellvertreter den<br />
Ortsobmann oder die Ortsleiterin vertreten, übernehmen<br />
sie dieselben Aufgaben. Daher ist alles was für Ortsobmann<br />
und Ortsleiterin gilt auch für die Stellvertreter sehr<br />
wichtig. Stellvertreter übernehmen oft auch zusätzliche<br />
Aufgaben um die Vorsitzenden zu entlasten.<br />
DIE AUSSCHUSS-<br />
MITGLIEDER<br />
Bei den Ausschussmitgliedern sollte es sich um aktive,<br />
fleißige und seriöse Personen handeln. Im Ausschuss<br />
sollten die Mitglieder vertreten sein die das Beste für<br />
den Verein wollen und gerne ihre Freizeit für und mit<br />
der Bauernjugend verbringen.<br />
Die Aufgaben der<br />
Ausschussmitglieder:<br />
• Führungsspitze unterstützen<br />
• Fotografieren und Fotoalbum gestalten<br />
• Inventar verwalten und den Vereinsraum in Ordnung<br />
halten<br />
• Getränke verwalten<br />
• Schaukasten dekorieren<br />
• dem Schriftführer oder dem Kassier kleinere Aufgaben<br />
abnehmen<br />
• Bei der Organisation von Kursen und Veranstaltungen<br />
helfen<br />
Besondere Eigenschaften:<br />
Die Ausschussmitglieder sollten gerne mitarbeiten, sie<br />
sollten auch „Anweisungen“ der Führungsspitze akzeptieren<br />
können und diese umsetzen. Fleiß, Pünktlichkeit,<br />
Hilfsbereitschaft und die positive Einstellung zum Ehrenamt<br />
sowie der Wille gemeinsam etwas zu Bewegen<br />
sollte die Ausschussmitglieder auszeichnen.
12<br />
DER<br />
SCHRIFTFÜHRER<br />
Die Aufgaben des Schriftführers:<br />
• Protokoll bei jeder Sitzung, bei der Jahreshauptversammlung<br />
und bei allen Besprechungen verfassen.<br />
Diese sind sorgfältig, geordnet und wieder auffindbar<br />
aufzubewahren<br />
• Schriftverkehr führen<br />
• Mitglieder- sowie Ausschussliste genau und ordentlich<br />
führen<br />
• Datenschutzlisten genau und ordentlich führen<br />
• Mitgliedsausweise schreiben oder drucken<br />
• Öffentlichkeitsarbeit in Absprache mit Ortsobmann<br />
und Ortsleiterin betreiben<br />
• Rundschreiben, Flugblätter usw. ausarbeiten<br />
• Einladungen zu Sitzungen, Versammlungen, Veranstaltungen<br />
gestalten und versenden<br />
• Chronik führen<br />
• Sonstigen Schriftverkehr führen (Briefe, Aussendungen,<br />
Stellungnahmen)<br />
• Tätigkeitsbericht erstellen<br />
Der Schriftführer ist ein wichtiges Mitglied im Ortsausschuss.<br />
Es ist eine Tätigkeit, die einem viel gibt und bei<br />
der man viel lernt. Schriftführer sollten Personen sein,<br />
die mit dem PC sehr gut umgehen können, seriös, verlässlich<br />
und genau sind.<br />
Besondere Eigenschaften:<br />
Der Schriftführer muss eine seriöse Person sein. Über<br />
die in Sitzungen besprochenen Inhalte hat er, wenn gefordert,<br />
stillschweigen zu halten. Im Laufe der Zeit sollte<br />
der Schriftführer ein Gespür dafür entwickeln können,<br />
was in ein Protokoll gehört und was nicht. Witze gehören<br />
dort z.B. nicht hin. Beschimpfungen werden aus<br />
Höflichkeit nicht wörtlich aufgenommen, es sei denn<br />
jemand besteht darauf.<br />
Als Schriftführer sollten Personen ausgewählt werden,<br />
denen das Schreiben liegt. Genauigkeit, Pünktlichkeit<br />
und Verlässlichkeit zählen zu den Eigenschaften eines<br />
guten Schriftführers. Er muss mit Terminen, Dokumenten,<br />
Texten und Listen umgehen können.<br />
DER<br />
KASSIER<br />
TIPP<br />
Der Kassier verwaltet die Finanzen der Ortsgruppe. Immer<br />
wenn es um Geld geht, ist Vorsicht geboten. Der<br />
Kassier muss eine Person sein der 100%iges Vertrauen<br />
entgegen gebracht werden kann. Genauigkeit und Ordnung<br />
sind die obersten Prinzipien eines Kassiers.<br />
Die Aufgaben des Kassiers:<br />
• Inkasso und Zahlungen<br />
• Rückerstattung der Spesen an Vereinsmitglieder<br />
bei entsprechender Belegung<br />
• Ordnungsgemäße Aufstellung aller Einnahmen und<br />
Ausgaben<br />
• Auftragserteilung zur Zahlung von allen anfallenden<br />
Steuern an das Landessekretariat<br />
• Führen des IVA-Minori Registers<br />
• Abgabe der geforderten Informationen zur Steuererklärung<br />
im SBJ-Landessekretariat<br />
• Kassabericht für die Jahreshauptversammlung erstellen<br />
Als Hilfe dient dem Kassier der Steuerleitfaden, der im<br />
SBJ-Landessekretariat erhältlich ist.<br />
Besondere Eigenschaften:<br />
Der Kassier muss seriös, glaubwürdig, korrekt und genau<br />
sein. Man muss ihm vertrauen können. Der richtige<br />
Umgang mit Geld ist genau so wichtig wie der Überblick<br />
über Einzahlungstermine und die genaue Ordnung der<br />
Rechnungen und Belege. Weiters ist Genauigkeit oberstes<br />
Gebot.
13<br />
NEUE MITGLIEDER<br />
ANWERBEN? SO GEHT´S...<br />
Die Mitglieder sind die tragende Säule jeder Vereinstätigkeit.<br />
Aus diesem Grund kommt der Mitgliederwerbung eine<br />
besondere Bedeutung zu. Doch bei der Mitgliederwerbung<br />
handelt es sich um kein „Haustürgeschäft“ sondern vielmehr<br />
geht es darum die eigene Ortsgruppe in angemessener<br />
Form zu präsentieren und geeignete und dauerhafte<br />
Maßnahmen zu setzen.<br />
Die Mitglieder geben dem Verein Gewicht. Aus den Mitgliedern<br />
gehen Funktionäre hervor, die für die Geschicke der<br />
Südtiroler Bauernjugend auf Orts-, Bezirks- und Landesebene<br />
verantwortlich sind. Doch gerade die Besetzung der<br />
Ausschüsse mit engagierten Funktionären ist nicht immer<br />
ganz einfach. Umso wichtiger ist es daher bereits bei den<br />
Mitgliedern anzusetzen.<br />
Mitgliederwerbung darf aber nicht aus einmaligen Maßnahmen<br />
oder Aktivitäten bestehen sondern ist ein andauernder<br />
Prozess, der sehr viel mit Kommunikation aber auch<br />
mit der richtigen Präsentation zu tun hat. Die Kommunikation<br />
mit den Jugendlichen soll so direkt wie möglich<br />
sein: Das persönliche Gespräch, die persönliche Einladung,<br />
möglicherweise mit dem Angebot zur Mitfahrt verbunden,<br />
kann durch keine andere Maßnahme ersetzt werden. Was<br />
die Präsentation betrifft so gilt: Die Aktivitäten und Veranstaltungen<br />
sind die Visitenkarte einer Ortsgruppe und<br />
machen die Ortsgruppe bekannt. Zudem bieten Veranstaltungen<br />
die Möglichkeit um mit den Jugendlichen ins Gespräch<br />
zu kommen und sie in die Tätigkeit der Ortsgruppe<br />
einzubinden.<br />
Besonders die Jugendorganisationen haben es schwer. Jugendliche<br />
zu motivieren, sich einem Verband anzuschließen<br />
und Mitglied zu werden ist keine leichte Aufgabe.<br />
Trotz allem wissen wir, dass die Arbeit und Zugehörigkeit<br />
in einem Verband sehr wertvoll und lehrreich sind. Warum<br />
sollte ein Jugendlicher sich beispielsweise für die Südtiroler<br />
Bauernjugend interessieren? Hier einige wichtige Aussagen<br />
dazu:<br />
Die Südtiroler Bauernjugend ist...<br />
eine Gemeinschaft:<br />
Junge Menschen knüpfen bei der Südtiroler Bauernjugend
14<br />
eine Interessensgemeinschaft:<br />
Jugendliche bestimmen gemeinsam wichtige Interessen<br />
und setzen sich dafür ein.<br />
Es gibt also gute Gründe, wieso es nach wie vor sehr<br />
interessant sein kann, Mitglied eines Vereines oder Verbandes<br />
zu sein. Doch wie spreche ich die Leute richtig<br />
an?<br />
TIPP<br />
Die richtige Kommunikation bei der Mitgliederwerbung:<br />
ein Netz persönlicher Beziehungen. Sie nehmen Anteil<br />
am Leben anderer und lassen zu, dass andere an ihrem<br />
Leben Anteil nehmen.<br />
eine Arbeitsgemeinschaft:<br />
Jugendliche bringen ihre vielfältigen Talente und Begabungen<br />
für eine gemeinsame Sache ein. Teamfähigkeit,<br />
Solidarität und Hilfsbereitschaft sind Talente, die auch<br />
in beruflichen Kontexten sehr gefragt sind.<br />
eine Bildungsgemeinschaft:<br />
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen<br />
stärkt die eigene Persönlichkeit, erweitert den Horizont<br />
und fördert das Engagement.<br />
Die Identität des anderen kennen lernen:<br />
Bei jedem erfolgreichen Gespräch, in dem ich etwas rüber<br />
bringen will ist es wichtig, möglichst viel über den<br />
Anderen zu wissen. Was tut die Person? Wo ist er bereits<br />
eingebunden? Welche Interessen hat die Person?<br />
Den anderen gezielt ansprechen:<br />
Ich muss die Personen persönlich ansprechen und mit<br />
Informationen, Argumenten und Angeboten überzeugen.<br />
Dabei sollte ich aufmerksam zuhören und gezielt<br />
Fragen stellen. Die Hinweise zu neuen Ideen, die die<br />
Person einbringt, muss ich ernst nehmen.<br />
Eine „alte“ Fischerweisheit – „Der Fischer fischt nicht<br />
mit Cordon bleu“:<br />
Das bedeutet: Deine Argumente müssen nicht dir,<br />
sondern der/dem Gesprächspartner/in „schmecken“!<br />
Deshalb ist es wichtig, dass ihr beim Ansprechen viele<br />
Beispiele und Erfolgsargumente einbringt.
SITZUNGEN<br />
GEKONNT LEITEN<br />
15<br />
Kommunikation und Austausch um gemeinsam zu guten<br />
Lösungen zu kommen, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor<br />
in der Vereinsarbeit. Jahr für Jahr verbringen die<br />
Funktionäre viel Zeit in Besprechungen, Sitzungen und<br />
Workshops. Leider manchmal nicht zur Zufriedenheit<br />
der Betroffenen. Es wird über verlorene Zeit und zu<br />
wenig Ergebnisse geklagt. Erfahrungsgemäß gelingt<br />
es nur mit einer professionellen Sitzungsleitung aus<br />
gemeinsamen Sitzungen auch nachhaltige Erfolge zu<br />
erzielen.<br />
TIPP<br />
Hier einige Tipps für eine erfolgreiche Sitzung:<br />
• Der Sitzungstermin muss frühzeitig bekannt gegeben<br />
werden (mindestens 2 Wochen vorher)<br />
• Die Einberufung erfolgt durch Ortsobmann und<br />
Ortsleiterin<br />
• Schriftliche Einladung mit den Tagesordnungspunkten,<br />
die zu besprechen sind (das letzte Protokoll<br />
mit senden)<br />
• Pünktlich erscheinen - bei Abwesenheit oder späterem<br />
Erscheinen rechzeitig entschuldigen<br />
• Begrüßung durch Ortsobmann und Ortsleiterin<br />
• Feststellen der Beschlussfähigkeit (die Hälfte plus<br />
ein Ausschussmitglied müssen anwesend sein)<br />
• Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung, damit<br />
alle auf dem gleichen Stand sind<br />
• Sitzungsleiter gibt nochmals die Tagesordnungspunkte<br />
bekannt<br />
• Punkt für Punkt besprechen und entscheiden<br />
• Falls nötig fachbezogene Ansprechpartner miteinbeziehen<br />
• Freie Meinungsäußerung und Diskussion zulassen<br />
• Neue Vorschläge mit einbeziehen, aber nicht den<br />
Faden verlieren<br />
• Gemeinsam Lösungen suchen<br />
• Abstimmen, entscheiden<br />
• Gute und gerechte Aufgabenverteilung<br />
• Verlesung von Veranstaltungen und Aktionen anderer<br />
Ortsgruppen, des Bezirks und des Landesverbandes<br />
sowie von anderen Vereinen im Dorf<br />
• Nachbesprechung von vorangegangenen Veranstaltungen<br />
mit berücksichtigen<br />
• Vorschläge für die nächste Sitzung vorbringen und<br />
festhalten<br />
• Termin der nächsten Sitzung festlegen<br />
• Geselliges Beisammensein nicht vergessen<br />
• Sitzung sollte nicht länger als zwei Stunden dauern,<br />
eventuell nicht termingebundene Tagesordnungspunkte<br />
vertagen<br />
• keine Seitengespräche zulassen<br />
• keine Abschweifungen zulassen<br />
• Ziel nicht aus den Augen verlieren<br />
• Ausschussmitglieder müssen Bescheid wissen,<br />
über was gesprochen wird<br />
Die Jahreshauptversammlung<br />
Die Wahl des Versammlungsortes kann den Verlauf wesentlich<br />
beeinflussen. Sitzen weinige Personen in einem<br />
großen Saal, deprimiert das. Ein zu kleiner Raum<br />
bringt Sitzplatzprobleme mit sich. Sinnvoll ist, Getränke<br />
und Gläser auf den Tischen bereitzustellen und auf<br />
dauernde Störung durch die Bedienung zu verzichten.<br />
Besprechungspunkte<br />
Zahlreiche Tagesordnungspunkte einer Jahreshauptversammlung<br />
sind verpflichtend vorgeschrieben. Zusätzlich<br />
sind noch Stimmzähler zu bestimmen, wenn bei<br />
Neuwahlen schriftlich abgestimmt werden soll.
16<br />
Begrüßung<br />
Eine kurze humorvolle Begrüßung bietet einen guten<br />
Einstieg. Auch wenn die Tagesordnung bereits in der<br />
Einladung enthalten ist bewährt sich eine kurze Erläuterung<br />
des geplanten Ablaufs. Dabei auch angeben, wie<br />
lange die Versammlung etwa dauert. Unter „Allfälliges“<br />
sollen grundsätzlich keine Beschlüsse gefasst werden.<br />
Neben dem Protokoll der letztjährigen Versammlung<br />
können den Mitgliedern mit der Einladung auch die<br />
Jahresberichte zugesandt bzw. für alle Teilnehmer<br />
aufgelegt werden. Das macht möglich, dass sich Berichterstatter<br />
während der Versammlung auf besonders<br />
wichtige Punkte konzentrieren können. Von Vorteil ist<br />
der Einsatz von Hilfsmitteln. Wo das Vereinsleben vom<br />
Fotografen dokumentiert wird, untersteichen Bilder das<br />
gesprochene Wort.<br />
Ziele formulieren:<br />
Vereinsmitglieder wollen bei der Jahreshauptversammlung<br />
nicht nur zurück blicken. Wesentliche Vorhaben<br />
gehören vorgestellt.<br />
Rahmenprogramm<br />
Die Versammlung soll die Mitglieder nicht ermüden,<br />
sondern im Gegenteil zu weiteren Aktivitäten ermutigen.<br />
Dazu kann ein Rahmenprogramm beitragen.<br />
Vorschläge sind: Fotoausstellung, Videofilm (nicht zu<br />
lang!), Musik, Expertendiskussion, Verlosung, Quiz<br />
uvm.<br />
Gastreferent<br />
Ein interessantes Referat zu einem aktuellen Thema<br />
kann ein Höhepunkt einer Versammlung sein. Mit den<br />
Referenten sind alle organisatorischen Fragen rechtzeitig<br />
abzuklären: Thema, Dauer des Referates, technische<br />
Hilfsmittel usw. Unterstützung um geeignete<br />
Referenten zu finden bietet auch die SBB-Weiterbildungsgenossenschaft:<br />
Tel. 0471 999 335, weiterbildung@sbb.it<br />
Ehrungen:<br />
Jahreshauptversammlungen sind Anlass, verdiente<br />
Vereinsmitglieder in den Vordergrund zu stellen. Dabei<br />
gilt wie bei Berichten oder Referaten: Einige Fotos vom<br />
Einsatz der zu Ehrenden bringen mehr als langatmige<br />
Lebensläufe.<br />
Grußworte:<br />
Grußworte machen Vertreter der Landesorganisation<br />
welcher der Verein angehört. Die Mitglieder von Gemeinderat<br />
und Gemeindeverwaltung werden pauschal<br />
erwähnt, ebenso Vertreter anderer Ortsvereine. Wenn<br />
die Ortsfeuerwehr für Ordnung sorgt, das Weisse Kreuz<br />
anwesend ist oder andere Gruppen mithelfen, gebührt<br />
ihnen ebenfalls ein Dank. Eigene Ehrenmitglieder sowie<br />
andere Persönlichkeiten (Sponsor, Fahnenpatin<br />
usw.) sind je nach Anlass ebenfalls zu begrüßen. Pressevertreter<br />
werden nicht einzeln, sondern als Gruppe<br />
begrüßt.<br />
Wer ist anwesend?<br />
Erfahrene Vereinsfunktionäre beauftragen bei Großveranstaltungen<br />
zwei, drei Mitglieder, auf die Ehrengäste<br />
zu achten. Es soll niemand übersehen werden, allerdings<br />
auch niemand begrüßt der verhindert ist. Die<br />
Beobachter melden die ihnen bekannten Namen per<br />
Notizzettel. Sitzen in einem Festzelt 1000 Personen, so<br />
ist es durchaus berechtigt, einen dennoch übersehenen<br />
Ehrengast zu begrüßen.<br />
TIPP<br />
Ehrengäste – wer wird wie begrüßt?<br />
• Begrüßungsliste nicht zu lang. Es muss nicht jeder<br />
Gast einzeln genannt werden.<br />
• Bei Großveranstaltungen achten Helfer darauf,<br />
dass kein Ehrengast übersehen wird<br />
• Reihenfolge der Begrüßung ist kein Evangelium.<br />
• Im Redetext eingeflochtene Nahmen von Ehrengästen<br />
verkürzen, keine zu lange Liste am Beginn.<br />
Ehrenschutz:<br />
Manche Vereinsanlässe stehen unter dem Ehrenschutz<br />
bekannter Persönlichkeiten. Grundsätzlich sollen es<br />
aber Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung sein,<br />
wenn der Landeshauptmann oder andere Personen um<br />
die Übernahme eines Ehrenschutzes gebeten werden.<br />
Abgeordnete, die in den betreffenden Gemeinden wohnen,<br />
der Bürgermeister oder andere Personen mit Bezug<br />
zum Verein können ebenfalls um die Übernahme<br />
des Ehrenschutzes gebeten werden.
PROTOKOLLE SCHREIBEN<br />
LEICHT GEMACHT<br />
17<br />
Gute Protokolle erleichtern die effektive Kommunikation.<br />
Protokolle dienen:<br />
• als Information: Nichtanwesende werden informiert<br />
• als Ergebnisliste: Beschlüsse, Ergebnisse und Maßnahmen<br />
werden zusammengefasst<br />
• als Grundlage zur weiteren Bearbeitung: Kompetenzen<br />
und Aufgaben einzelner Personen werden genau festgelegt<br />
• als Beweis: Vorgänge, Verlauf, Beschlüsse und Zuständigkeiten<br />
werden schriftlich festgehalten<br />
Die optimale Protokollmitschrift<br />
Ein weißes Blatt Papier ist für die Mitschrift ungeeignet,<br />
denn die fehlende Strukturierung des Blattes erschwert die<br />
Arbeit. Zur Reduzierung dieses nachträglichen Aufwandes<br />
sollte vorab eine Blanko-Protokollvorlage genommen werden.<br />
Eine solche Vorlage kann unter www.sbj.it heruntergeladen<br />
werden.<br />
TIPP<br />
Je früher<br />
das Protokoll<br />
nach einer Sitzung<br />
abgefasst wird,<br />
desto besser ist es!<br />
• Bereits vorher durchnummeriertes Papier verhindert,<br />
dass man später die Reihenfolge der mitgeschriebenen<br />
Seiten durcheinander bringt.<br />
• Am leichtesten tut sich der Protokollführer, wenn er<br />
mit Papier nicht spart, die Blätter nur einseitig beschreibt<br />
und fortlaufend nummeriert sowie einen breiten<br />
Rand für spätere Ergänzungen offen lässt.<br />
• Eine zweite Farbe für Unklarheiten erleichtert das<br />
Nachfragen.<br />
• Bei wichtigen Punkten so lange nachfragen, bis genau<br />
verstanden ist, was gemeint ist.<br />
• So viel mitschreiben wie möglich, mehr ist in diesem<br />
Fall meist besser!<br />
• Anträge und Beschlüsse sind wörtlich mitzuschreiben,<br />
hier unbedingt immer nachfragen, bis jeder zufrieden<br />
ist, was im Protokoll steht! Oft wird dem Protokollführer<br />
auch direkt ‚‘ins Protokoll‘‘ diktiert.<br />
• Mitdenken ist angesagt! Nur dann können die einzelnen<br />
Beiträge im Zusammenhang verstanden werden<br />
und richtig im Protokoll wiedergegeben werden.<br />
Abfassen des Protokolls<br />
Verfassen eines Protokolls ist kein Selbstzweck - das Protokoll<br />
wird für andere Leser geschrieben. Daher sollte man<br />
sich in die Lage des Lesenden hineinversetzen.<br />
Je früher das Protokoll nach einer Sitzung abgefasst wird,<br />
desto besser ist es, denn man erinnert sich noch an die<br />
Sitzung und kann etwas mit den Stichpunkten anfangen.<br />
Deswegen: so bald wie möglich, am besten gleich im Anschluss<br />
an eine Sitzung, das Protokoll verfassen!<br />
Als erstes sollten alle noch eventuell vorhandenen Unklarheiten<br />
geklärt werden. Dann wird Schritt für Schritt die eigene<br />
Mitschrift durchgegangen: Was war wesentlich? Was<br />
unwesentlich? Welche Teile gehören wörtlich ins Protokoll?<br />
Protokolle werden in einer Protokollsprache verfasst. Hier<br />
die wichtigsten Punkte:<br />
Kurze und prägnante Sätze erleichtern die Lesbarkeit.<br />
• Zu viele Substantive machen einen Text schwer lesbar,<br />
Zeitwörter wirken dynamischer.<br />
• Protokolle werden grundsätzlich in der Gegenwart abgefasst.<br />
• Die direkte Rede wird verwendet, um Beschlüsse und<br />
Anträge wiederzugeben, die indirekte Rede wird dagegen<br />
für Meinungen und Behauptungen verwendet.<br />
• Adjektive sollten nur äußerst sparsam eingesetzt werden,<br />
denn sie werten und genau dies sollte ein Protokoll<br />
nicht machen.<br />
• Abkürzungen sollten so wenig wie möglich benutzt<br />
werden. Fremdwörter sind ebenfalls so wenig wie<br />
möglich zu verwenden.<br />
Ein gutes Protokoll muss:<br />
• wahr sein<br />
• objektiv und sachlich sein<br />
• auf Tatsachen beruhen, nicht auf Gefühle und Meinungen<br />
• auch für Nichtbeteiligte problemlos verständlich sein<br />
• auf das Wesentliche beschränkt sein<br />
• logisch gegliedert und aufgebaut sein<br />
• in Länge und Ausgestaltung dem Zweck angepasst<br />
sein<br />
• in klarem, leichtverständlichem Deutsch abgefasst<br />
sein<br />
• ohne unnütze Floskeln und Stilblüten auskommen<br />
• auch optisch leserfreundlich gestaltet sein
18<br />
ORTSAUSSCHUSS:<br />
SO WIRD GEWÄHLT<br />
Wahlen<br />
SBJ-Ortsgruppe<br />
Um die Wahlen der Ortsausschüsse erfolgreich durchführen<br />
zu können, sollten sie gewissenhaft und gründlich<br />
vorbereitet werden.<br />
Termin:<br />
Es sollte ein zeitlich günstiger Termin gewählt werden,<br />
an dem keine Musikprobe, Feuerwehrprobe oder sonstige<br />
Veranstaltungen im Dorf stattfinden. Um die Versammlung<br />
ordnungsgemäß und ungestört abwickeln<br />
zu können, sollte diese in einem geschlossenen Raum<br />
durchgeführt werden.<br />
Die Einladung:<br />
Die Einladung zur Jahreshauptversammlung muss<br />
schriftlich und rechtzeitig (2 Wochen vorher) an alle<br />
Mitglieder versendet werden. Sie soll alle notwendigen<br />
Informationen wie z. B. Ort, Datum, Beginn und Tagesordnungspunkte<br />
beinhalten.<br />
Es empfiehlt sich auch frühzeitig an die schriftliche<br />
Einladung der Ehrengäste (Ortsbäuerin, Vertreter der<br />
Seniorenvereinigung auf Ortsebene, Bezirksobmann der<br />
Südtiroler Bauernjugend, Bezirksleiterin der Südtiroler<br />
Bauernjugend, Bezirksausschussmitglied der Südtiroler<br />
Bauernjugend, Bürgermeister, Pfarrer, Jugendasessor,<br />
usw.) zu denken! Der Ortsobmann des Bauernbundes<br />
ist Rechtsmitglied. Er sollte unbedingt anwesend sein.<br />
Vorschlag für eine Tagesordnung:<br />
• Begrüßung und Bericht durch den Ortsobmann und<br />
die Ortsleiterin<br />
• Verlesung des Tätigkeitsberichtes (evtl. mit Vorführung<br />
einer Power-Point-Präsentation)<br />
• Verlesung des Kassaberichtes durch den Kassier<br />
• Bericht der Kassarevisoren und Entlastung des<br />
Kassiers<br />
• Grußworte der Ehrengäste<br />
• Rücktritt des Ortsausschusses und der Kassarevisoren<br />
• Wahl der Vereinsorgane (Ortsausschuss und Kassarevisoren)<br />
• Bekanntgabe des Wahlergebnisses<br />
• Allfälliges<br />
Zu Punkt Allfälliges:<br />
Die Jahreshauptversammlung bietet unter diesem<br />
Punkt die Möglichkeit, mit den Mitgliedern verschiedene<br />
aktuelle Themen zu besprechen. Weiters können<br />
Vorschläge, Informationen, Tipps und Ideen für das<br />
Jahresprogramm gesammelt und besprochen werden.<br />
Damit der Zusammenhalt innerhalb der Ortsgruppe der<br />
Südtiroler Bauernjugend gefördert wird und sich neue<br />
Mitglieder sowie Funktionäre besser kennen lernen,<br />
kann zum Ausklang der Versammlung ein geselliger Teil<br />
organisiert werden (z. B. ein gemeinsames Essen). Ein<br />
derartiger Programmteil soll auch in der Einladung Platz<br />
finden.
19<br />
Wahlordnung auf Ortsebene<br />
Die Südtiroler Bauernjugend wählt alle zwei Jahre ihre<br />
Funktionäre in schriftlicher geheimer Wahl und konstituiert<br />
dementsprechend ihre Organe. Einer Wahl als<br />
OA-Mitglied können sich alle aktiven Mitglieder stellen,<br />
die das 30. Lebensjahr nicht vollendet haben. Vor jeder<br />
Neuwahl muss die MV die Anzahl der OA-Mitglieder<br />
festlegen, ebenso die Anzahl der Frauen und Männer,<br />
die den OA bilden. Außerdem muss vor der Neuwahl<br />
festgelegt werden, ob der OO, die OL und deren Stellvertreter<br />
direkt von der MV oder vom OA gewählt werden.<br />
Wenn die MV auch die Vorsitzenden wählt, ist die<br />
Wahl folgendermaßen durchzuführen:<br />
-Die Mitgliederversammlung wählt in einem ersten<br />
Wahlgang den Ortsausschuss.<br />
-Aus den Reihen der neugewählten OA-Mitglieder werden<br />
in einem zweiten Wahlgang OO und OL zugleich<br />
gewählt. OO oder OL muss volljährig sein.<br />
-Darauf erfolgt in einem dritten Wahlgang die Wahl<br />
des OO-Stellvertreters und der OL-Stellvertreterin, die<br />
ebenfalls zugleich gewählt werden. Es können in den<br />
einzelnen Wahlgängen so viele Vorzugsstimmen abgegeben<br />
werden, wie MG zu wählen sind. Die Aufgabenbereiche<br />
innerhalb des OA werden vom Ausschuss<br />
intern zugeteilt.<br />
Stimmengleichheit<br />
Erhalten zwei oder mehrere Kandidaten bei der OA-Wahl<br />
im ersten Wahlgang die gleiche Anzahl von Stimmen,<br />
so gilt der/die Jüngere als gewählt. Erhalten zwei oder<br />
mehrere Kandidaten bei der Wahl einer Funktion im<br />
zweiten oder dritten Wahlgang die gleiche Anzahl von<br />
Stimmen, so erfolgt eine Stichwahl. Bei erneuter Stimmengleichheit<br />
gilt der/die Jüngere als gewählt. Der BA<br />
wird von der Bezirksversammlung der Ortsgruppen seines<br />
Bezirkes gewählt und besteht aus mindestens 11<br />
und höchstens 17 Mitgliedern. Zur Wahl des Bezirksausschusses<br />
treten alle Ortsgruppen eines Bezirkes<br />
zusammen. Jede OG kann, je nach Mitgliederzahl, ihre<br />
Stimmrechte abgeben. Jede Ortsgruppe hat in der MV<br />
mindestens ein Stimmrecht und jeweils ein weiteres<br />
Stimmrecht je 20 Mitglieder, wobei die angebrochene<br />
Zahl als voll gilt. Die Landesführung (Landesobmann,<br />
Landesleiterin und je zwei Stellvertreter/innen) wird<br />
von der Mitgliederversammlung gewählt.<br />
Neuwahlen und Änderung rechtlicher Vertreter<br />
Die Neuwahlen auf Ortsebene bedeuten nicht nur eine<br />
meist personelle Veränderung der Ortsausschüsse<br />
sondern es sind damit auch eine Reihe von Verpflichtungen<br />
verbunden, die unmittelbar nach der Wahl zu<br />
erledigen sind. Das Rundschreiben, das immer vor<br />
den Wahlen verschickt wird, enthält alle Informationen<br />
zu den Wahlen auf Ortsebene. Insbesondere ist<br />
zu beachten, dass mit einem eventuellen Wechsel des<br />
rechtlichen Vertreters bei den Ortsausschusswahlen<br />
die Mitteilung dieser Änderung bei den lokalen Steuerämtern<br />
notwendig ist. Dies geschieht mit eigenen<br />
Formularblättern (Mod. AA7), die der neue rechtliche<br />
Vertreter innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Wahl<br />
ausgefüllt und in zweifacher Ausfertigung beim lokalen<br />
Steueramt abgegeben muss. Die Formblätter und die<br />
Anleitung zum Ausfüllen werden Ende September an<br />
alle Ortsobmänner und Ortsleiterinnen geschickt.
20<br />
RDEN WIE<br />
DIE PROFIS<br />
Um in einer Rede bei den Zuhörern den gewünschten Effekt<br />
zu erzielen, ist sowohl eine ausgeprägte Zuwendung<br />
an die Zuhörer notwendig, als auch eine inhaltlich attraktive<br />
Verpackung. Die besten Inhalte nützen nichts, wenn<br />
der Zuhörer sich nicht angesprochen fühlt und das Gefühl<br />
bekommt: „das geht mich nichts an“. Andererseits genügt<br />
es nicht, das Publikum für sich einzunehmen, und<br />
keine wirkliche Aussage in seiner Rede zu haben.<br />
Zuhörerorientiert<br />
Zuhörerorientiert spricht man dann, wenn die Hörer das<br />
Gefühl haben: “Der Redner redet für mich (zu mir)“. Durch<br />
Blickkontakt, Lächeln, Zugewandtheit kann man das erreichen.<br />
Aber auch die Inhalte müssen auf das Publikum<br />
abgestimmt sein. Am besten, man bezieht sich direkt auf<br />
die Hörerschaft. Der Zuhörer soll das Gefühl haben: „Das<br />
geht mich was an. Das betrifft mich.“<br />
TIPP<br />
Tipps für zuhörerorientiertes Sprechen:<br />
• Blickkontakt<br />
• Körpersprache<br />
• Gestik intensivieren<br />
• Beispiele und Vergleiche aus der Welt der Hörer bringen<br />
• Bedeutung für die Hörer klar darlegen<br />
Sachorientiert<br />
Sachorientiert spreche ich vor allem durch eine gute Verständlichkeit<br />
der Inhalte und eine klare Aussage. Es muss<br />
ein Ziel in der Rede zu merken sein, also etwas, wo ich<br />
die Hörer hinführe, wenn ich sie durch zuhörerorientiertes<br />
Sprechen auf meiner Seite habe. Ich bereite die Inhalte so<br />
auf, dass sie verständlich (Faktoren der Verständlichkeit),<br />
aussagekräftig sind und eine Bedeutung haben.<br />
Faktoren für Verständlichkeit<br />
Das Hauptproblem, das wir bei Reden immer wieder erleben<br />
ist, dass der Redner den Zuhörer überfordert. Besonders<br />
bei Fachreden ist es daher wichtig, auf die Verständlichkeit<br />
der Inhalte zu achten. Denn nur wer verstanden<br />
wird, hat auch eine Chance zu überzeugen. Dabei gilt es<br />
zu bedenken, dass der Zuhörer im Normalfall nicht so mit<br />
den Themen vertraut ist wie der Redner und deshalb bestimmte<br />
Faktoren für Verständlichkeit zu berücksichtigen<br />
sind.<br />
Dazu kommt, dass oft Bedingungen vorherrschen, die<br />
die Aufmerksamkeitsschwelle der Zuhörer zusätzlich reduziert,<br />
wie z.B. große räumliche Distanz zum Redner,<br />
ein hoher Nebengeräusch-Pegel oder Ablenkungen durch<br />
andere Personen.<br />
Auch auf der Beziehungsebene spielt die Verständlichkeit<br />
des Gesagten eine wichtige Rolle. Denn wenn wir jemanden<br />
nicht ganz verstehen, bringen wir dieser Person oft<br />
entweder keine oder eher negative Gefühle entgegen.
21<br />
Merkpunkte für eine Rede<br />
Vorbereitungsphase der Rede<br />
• Genau überlegen, wer das Zielpublikum ist und wie<br />
es denkt<br />
• Genau überlegen, was man sagen will! Welche Kernbotschaft<br />
will man dem Publikum mitgeben<br />
• Mit anderen Leuten über das Thema reden. Das gibt<br />
Sicherheit und bereitet auf mögliche Fragen vor.<br />
• Konkrete Beispiele in die Rede einbauen<br />
• So viel Material wie möglich sammeln, auch wenn<br />
nicht alles verwendet wird<br />
• Notizen machen, auch wenn diese nicht verwendet<br />
werden! Am besten eignet sich ein DIN A5 Blatt<br />
• Rede vor dem geistigen Auge ablaufen lassen oder<br />
jemanden vortragen<br />
• Die ersten Worte zur Eröffnung auswendig lernen<br />
• Rede kürzen (so lange wie nötig- so kurz wie möglich)!<br />
Auf wenige, aber schlagkräftige Gesichtspunkte<br />
konzentrieren<br />
Beginn der Rede<br />
• Warten vor Beginn der Rede bis Ruhe eintritt, und<br />
Blickkontakt zu den Zuhörern aufnehmen<br />
• Einen effektvollen, außergewöhnlichen Anfangssatz<br />
(Zitate, Geschichten, Headlines) nehmen; wie man<br />
startet, so liegt man im Rennen.<br />
• Keinesfalls mit Entschuldigungen und Abschwächungen<br />
(eventuell, vielleicht, könnte...) beginnen<br />
• Publikum als Freund sehen, dem etwas interessantes<br />
Vortragen wird<br />
• Zu Beginn eine freundlich gesonnene Person im Publikum<br />
für den Blickkontakt suchen und so Sicherheit<br />
holen<br />
• Besonders am Anfang lächeln. Das macht sympathisch<br />
und wirkt selbstbewusst<br />
• Laut und schwungvoll starten, um die Zuhörer wachzurütteln<br />
Hauptteil der Rede<br />
• Frei mit Unterstützung Ihrer Notizen Sprechen<br />
• Neugier bei den Zuhörern erwecken, indem die Kernaussage<br />
nicht sofort vorweggenommen wird<br />
• Stimme gezielt einsetzen! Sprechtempo, Lautstärke<br />
und Stimmlage variieren<br />
• Gezielte Pausen machen<br />
• Über eigene Erfahrungen berichten<br />
• Auf die speziellen Interessen Ihres Zielpublikums eingehen<br />
• Durch Vergleiche und Beispiele veranschaulichen<br />
• Geläufige Wörter verwenden! Wenn der Zuhörer nicht<br />
versteht, wird eine negative Haltung haben<br />
• Verschleiernde Redewendungen wie “man, würde<br />
sagen, würde meinen...” vermeiden<br />
• Natürlich aber nachdrücklich sprechen! Die Stimme<br />
sollte nicht nur gehört werden, sondern Dynamik und<br />
Selbstbewusstsein ausdrücken<br />
• Gestik nicht bewusst einschränken! Die Gestik Intensivieren,<br />
wenn Aufmerksamkeit gewonnen werden<br />
soll<br />
Schluss der Rede<br />
• Einen effektvollen Schluss formulieren. Der Schluss-<br />
Satz ist das, was im Kopf des Zuhörers bleibt<br />
• Eine Schlussmöglichkeit ist die kurze Zusammenfassung<br />
der wesentlichen Gesichtspunkte<br />
• Einen Appell aussprechen, wenn man die Teilnehmer<br />
zu konkretem Tun auffordern will<br />
• Nichtssagende Schlussformeln wie: “damit bin ich<br />
am Ende”, “kommen wir zum Schluss” vermeiden<br />
• Am Ende die Emotionen der Zuhörer ansprechen<br />
• Nicht von der Bühne flüchten! Den Schlussapplaus<br />
abwarten
22<br />
Umgang mit Störungen in der Rede<br />
TIPP<br />
Teilnehmer kommen zu spät<br />
Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Eine kurze Begrüßung<br />
durch Blickkontakt ist in der Regel ausreichend.<br />
Teilnehmer stellen unangenehme Fragen<br />
Ruhig und freundlich auf einen späteren Zeitpunkt verweisen!<br />
Man verspricht sich<br />
Kurz korrigieren, um Missverständnisse zu vermeiden –<br />
nicht entschuldigen<br />
Teilnehmer führen Seitengespräche<br />
Durch Blickkontakt die Aufmerksamkeit der Teilnehmer<br />
zurückgewinnen. Wenn das Gespräch die Präsentation<br />
stört, die Störung ansprechen - z.B. “Ist Ihre Frage für<br />
alle interessant? Sollten wir jetzt darüber sprechen?”<br />
Es kommen unsachliche Zwischenmeldungen der Teilnehmer<br />
Sachlich bleiben, auch wenn man sich angegriffen fühlt.<br />
Den Beitrag ernst nehmen und nachfragen was der Teilnehmer<br />
konkret damit meint.<br />
Rahmenbedingungen der Rede<br />
• Sich vor der Rede mit den Räumlichkeiten und den<br />
zur Verfügung stehenden Medien vertraut machen!<br />
Pannen mit den Medien können den besten Vortrag<br />
zerstören<br />
• Für gute Beleuchtung sorgen<br />
• Weg mit unnützen Gegenständen von der Rednerbühne<br />
• Vor Beginn der Rede für gute Luftverhältnisse sorgen.<br />
Nichts ermüdet mehr als schlechte Luft<br />
Die Körpersprache<br />
Der Stand<br />
Beim Stand ist vor allem die Breite der Beinstellung und<br />
der Grad der Flexibilität in den Knien aufschlussreich:<br />
• Eine breite Beinstellung signalisiert:<br />
• Revieranspruch<br />
• Einen festen Standpunkt<br />
• Großes Selbstvertrauen<br />
Eine schmale Beinstellung signalisiert:<br />
• Einen von außen fixierten Standpunkt (Militär)<br />
• Das Bedürfnis wenig Raum einzunehmen<br />
• Schlechte Balance<br />
Durchgedrückte Knie signalisieren:<br />
• Eine starre, festgefahrene Haltung<br />
• Einen unveränderlichen Standpunkt<br />
Beweglichkeit in den Knien signalisiert:<br />
• Beweglichkeit und Flexibilität in den Ansichten<br />
• Nachgiebigkeit<br />
Der Gang<br />
Beim Gang eines Menschen sagen vor allem die Schritt-<br />
Länge, der Auftritt und Fußstellung viel über die Person<br />
aus.<br />
Kleine Schritte signalisieren:<br />
• Hang zum Detail<br />
• Ordnungsliebe<br />
• Hohes Sicherheitsbedürfnis<br />
Große Schritte signalisieren:<br />
• Konzentration auf das Gesamte<br />
• Hang zum ganzheitlichen, strategischen Planen<br />
• Risikobereitschaft<br />
Ein fester Auftritt signalisiert:<br />
• Durchsetzungsfähigkeit<br />
• Entschlossenheit<br />
• Die Tendenz aufzufallen
23<br />
Ein leichter Auftritt signalisiert:<br />
• Zurückhaltung<br />
• Vorsichtigkeit<br />
• Zaghaftigkeit<br />
Nach vorne zeigende Fußspitzen signalisieren:<br />
• Zielstrebigkeit<br />
• Geradlinigkeit<br />
Nach außen zeigende Fußspitzen signalisieren:<br />
• Ablenkbarkeit<br />
• Verschwendung von Energie<br />
Das Sitzen<br />
Sitzen ist eine feste räumliche Position, die viel über das<br />
Territorialverhalten und die Beziehung der Beteiligten zueinander<br />
aussagt. Interessant dabei ist vor allem die Sitzordnung<br />
und die Sitz-art (Haltung).<br />
Frontale Sitzordnung signalisiert:<br />
• Konfrontationsbereitschaft<br />
• Konkurrenzsituation<br />
• Bereitschaft, sich dem anderen zu widmen<br />
Rechtwinkelige Sitzordnung signalisiert:<br />
• Entspannte Atmosphäre<br />
• Spielraum<br />
Zurückgelehntes Sitzen signalisiert:<br />
• Sich entfernen vom Gesagten<br />
• Position des Beobachters<br />
• Passive Erwartungshaltung<br />
Vorgelehntes Sitzen signalisiert:<br />
• Aktivität/ Bereitschaft zum Handeln<br />
• Orientierung auf das Gegenüber<br />
• Konfrontationsbereitschaft<br />
Volles Ausnützen der Sitzfläche signalisiert:<br />
• Selbstbewusstsein<br />
• Anspruch auf Territorium (und Zeit)<br />
• Beharrlichkeit<br />
Teilweises Ausnützen der Sitzfläche signalisiert:<br />
• Bereitschaft zu gehen<br />
• Angst, zuviel Zeit in Anspruch zu nehmen<br />
Sitzen mit überkreuzten Beinen signalisiert:<br />
• Abwehrhaltung (mit quergelegten Bein)<br />
• Versuch der Entspannung (mit übergeschlagenem<br />
Bein)<br />
Sitzen mit gestreckten Beinen signalisiert:<br />
• Anspruch auf Territorium<br />
• Entspannung<br />
Kopf und Hals<br />
Der Hals ist die verwundbarste Körperstelle des Menschen.<br />
Darum ist der Schutz des Halses eine wichtige<br />
körpersprachliche Reaktion auf Angst und Unsicherheit<br />
(Schulterzucken).<br />
Der Schutz des Halses kann auf drei Arten hergestellt<br />
werden:<br />
1. Die Schultern werden hochgezogen und somit die<br />
Hals-Seiten geschützt<br />
2. Der Kopf wird nach vorne geneigt und dadurch die<br />
Kehle geschützt<br />
3. Die Hand wird an den Hals oder Nacken gelegt<br />
Ein zur Seite geneigter Kopf signalisiert:<br />
• Vertrauen<br />
• Offenheit<br />
• Geborgenheit<br />
Ein angehobenes Kinn signalisiert:<br />
• Kampfbereitschaft<br />
• Imponiergehabe, Furchtlosigkeit<br />
• Herausforderung<br />
Ein steifer Hals signalisiert:<br />
• Informationssperre<br />
• Festgefahrene Ansichten<br />
Ein beweglicher Hals signalisiert:<br />
• Offenheit für neue Informationen<br />
• Aufgeschlossenheit
24<br />
Die Augen<br />
Der Ausdruck der Augen kommt durch die Intensität des<br />
Blickes, die Größe der Pupillen und die Bewegung der Augenmuskeln<br />
zustande.<br />
Große Pupillen signalisieren:<br />
• Begehren, Interesse<br />
• Positive Gefühle<br />
Kleine Pupillen signalisieren:<br />
• Feindseligkeit<br />
• Unbehagen, negative Gefühle<br />
Ein starrer Blick signalisiert:<br />
• Warnung<br />
• Kräftemessen<br />
Ein kurzer Blickkontakt signalisiert:<br />
• Wahrnehmung<br />
• Kampfverzicht<br />
Ein gesenkter Blick signalisiert:<br />
• Unterordnung<br />
• Scheu vor neuen Erfahrungen<br />
Zusammengekniffene Augen signalisieren:<br />
• Konzentration auf ein Detail<br />
• Zielfixierung, Ausblenden von Nebensächlichkeiten<br />
Geschlossene Augen signalisieren:<br />
• Rückzug vor zu vielen, zu intensiven Reizen<br />
• Ermüdung, Erschöpfung<br />
Gestik<br />
Die Arme und Hände sind die sensibelsten Werkzeuge<br />
und ausdrucksstärksten Glieder des Menschen. Die Oberarme,<br />
Unterarme und Hände setzen unmittelbar Gedanken<br />
und Gefühle in Gesten um und sind daher besonders<br />
aufschlussreich.<br />
Bewegliche Oberarme signalisieren:<br />
• Offene Emotion/ Wärme<br />
• Vertrauen<br />
• Bereitschaft zum Austausch/ Geben<br />
Angelegte, steife Oberarme signalisieren:<br />
• Selbst-Disziplin<br />
• Emotionale Blockade/ Kälte<br />
• Behalten statt geben und austauschen<br />
Verschränkte Arme signalisieren:<br />
• Defensive<br />
• Zurückhaltende Aktivität (beobachten, zuhören)<br />
• Sperren gegenüber neuen Informationen (mit geschütztem<br />
Hals)<br />
Herabhängende Arme signalisieren:<br />
• Handlungsunwilligkeit/ Passivität<br />
• Unwillen zu kommunizieren<br />
Nach rückwärts gezogene Arme signalisieren:<br />
• Passives Gewährenlassen<br />
• Wunsch, selber nichts zu tun<br />
• Nachdenken<br />
Die Offen Hand signalisiert:<br />
• Friedliche Gesinnung / Achtung vor dem Anderen<br />
• Offenheit-Vertrauenswürdigkeit<br />
• Bereitschaft zum Austausch (anbieten und nehmen)<br />
Die zugedeckte Hand (Handrücken nach vorne) signalisiert:<br />
• Verbergen<br />
• (Prinzipielle) Grenzen<br />
Weitere Gesten:<br />
• Wegschiebende Hände signalisieren: Sich distanzieren<br />
• Händereiben signalisiert: Wohlfühlen oder Handlungsbereitschaft<br />
• Die Pyramide signalisiert: Bereitschaft zur Einigung<br />
• Die Hände reiben den Nacken signalisiert: Unbehagen<br />
• Die Faust signalisiert: Kampfbereitschaft<br />
• Die Finger reiben das Ohrläppchen signalisiert: Beobachtungsschärfe<br />
erhöhen<br />
Quelle:<br />
Mag. Wolfgang Hagen<br />
Trainer und Berater der Firma Comment<br />
Kommunikations-Entwicklung
25<br />
DIE WELT DER MEDIEN:<br />
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit verfolgt sehr viele Ziele. Dementsprechend<br />
werden auch die Instrumente (siehe weiter<br />
unten) gewählt. Allgemein soll eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit:<br />
• Informationen über Ziele, Standpunkte, Meinungen,<br />
Aktivitäten, Leistungen, geplante Vorhaben usw. vermitteln<br />
• ein Unternehmen, einen Verband oder eine Organisation<br />
in der öffentlichen Meinung positionieren<br />
• Interesse und Aufmerksamkeit wecken<br />
• Vertrauen schaffen und ein positives Image aufbauen<br />
und pflegen<br />
• Kontakte mit Partnern pflegen<br />
• den Zusammenhalt fördern<br />
Zielgruppe<br />
Je nach dem Ziel der Botschaft, das man mit der Öffentlichkeitsarbeit<br />
erreichen will, ist die Zielgruppe entweder<br />
die gesamte Bevölkerung oder nur ein Teil derselben. Bei<br />
Nachrichten, die sich auf lokale Gegebenheiten beziehen<br />
bzw. nur lokale Bedeutung haben, ist die Zielgruppe die<br />
lokale Bevölkerung (Z. B. Gemeinde, Bezirk usw.). Daher<br />
werden diese Botschaft auch nur lokale Medien (Z. B.<br />
Bezirkszeitungen, lokale Radiostationen, Bezirksseiten<br />
der Tageszeitungen usw.) „transportieren“. Bei Themen<br />
von allgemeinem Interesse ist die Zielgruppe die gesamte<br />
Öffentlichkeit, die Nachricht sollte von den landesweiten<br />
großen Medien (z. B. Rai, Dolomiten, Alto Adige, RMI<br />
usw.) verbreitet werden.<br />
Grundprinzipien<br />
Die 9 Grundprinzipien der Öffentlichkeitsarbeit sind:<br />
• Überzeugung<br />
• Offenheit<br />
• Ehrlichkeit<br />
• Kontinuität<br />
• Professionalität<br />
• Systematik (Strategie)<br />
• Fairness<br />
• Sachlichkeit<br />
• Universalität<br />
Öffentlichkeitsarbeit muss auf einer Strategie beruhen<br />
und besteht in der Bereitschaft, die Öffentlichkeit zu<br />
informieren bzw. die eigenen Standpunkte mitzuteilen.<br />
Öffentlichkeitsarbeit ist langfristig angelegt und wirkt<br />
langfristig. Genauso kann Image nur langfristig gebildet<br />
werden.<br />
Instrumente und Maßnahmen<br />
Wer Öffentlichkeitsarbeit „macht“, kann sich einer Reihe<br />
von Instrumenten bedienen. Aufgabe des PR-Verantwortlichen<br />
ist es, jene Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit<br />
auszuwählen, die die Botschaft am besten kommunizieren<br />
und das Zielpublikum am besten erreichen.<br />
Die wichtigsten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit<br />
sind:<br />
• Pressemitteilung (siehe nachstehend)<br />
• Pressekonferenz (siehe nachstehend)<br />
• Pressegespräch (Pressefrühstück, Pressebrunch<br />
usw.)<br />
• Leserbriefe<br />
• Newsletter<br />
• Organisation von Veranstaltungen (Podiumsdiskussion,<br />
Feste, Stammtische usw.)<br />
• Publikationen (z. B. Geschäftsbericht)<br />
• Werbemittel (Broschüren, Flyer, Plakate)<br />
• Internetseite und Blogs<br />
• Social Media (Facebook, Instagram usw.)<br />
• Schaukasten (siehe nachstehend)<br />
• Sponsoring u.a.
26<br />
Pressemitteilung<br />
Das wichtigste Instrument der PR ist die Pressemitteilung.<br />
Sie eignet sich, Journalisten und somit Medien über<br />
wichtige, aktuelle Ereignisse bzw. Standpunkte mit Neuigkeitswert<br />
zu informieren. Bevor eine Pressemitteilung<br />
versendet wird, muss immer hinterfragt werden, ob eine<br />
Presseinformationen geeignet ist, die Botschaft zu transportieren<br />
und damit das Zielpublikum zu erreichen.<br />
Achtung: Manche Nachrichten sind keine Nachrichten,<br />
weil der Neuigkeitswert fehlt. In diesem Fall sollte auf<br />
eine Pressemitteilung verzichtet werden!<br />
Eine gute Pressemitteilung ist kurz und übersichtlich und<br />
stellt die zentrale Botschaft (in der Regel nur eine einzige<br />
Kernbotschaft) in den Mittelpunkt.<br />
Die Überschrift sollte kurz und knackig sein und Neugier<br />
wecken, aber keine „Werbebotschaft“ sein.<br />
Der Aufbau der Pressemitteilung folgt dem Pyramidenprinzip.<br />
In Vorspann bzw. im ersten Teil der Mitteilung<br />
sollten die wesentlichen Fragen (Was, Wie, Wann, Wo,<br />
Warum usw.) beantwortet werden. Ganz allgemein gilt:<br />
das Wesentliche zuerst, da Journalisten Pressemitteilungen<br />
gerne von hinten kürzen.<br />
Erst dann sollten die näheren Umstände, Hintergründe,<br />
Detailinformationen usw. beschrieben werden. Auf<br />
Fremdwörter sollte - wenn möglich – verzichtet werden.<br />
Zitate lockern die Pressemitteilung auf und unterstreichen<br />
die Botschaft. Sie sollen jedoch nicht klischeehaft sein.<br />
Allgemein sollte die Pressemitteilung nicht länger als<br />
2.500 – 3.000 Zeichen sein. Der Absender (z. B. Ortsgruppe,<br />
Ortsobmann, Ortsleiterin oder die bäuerlichen<br />
Organisationen zusammen) muss deutlich gekennzeichnet<br />
sein. Die Pressemitteilung sollte elektronisch (E-Mail)<br />
versendet werden.<br />
TIPP<br />
Ein detailliertes Medienverzeichnis gibt es unter<br />
http://www.provinz.bz.it/lpa/medienverzeichnis.asp.<br />
Hilfreich in der Pressarbeit sind gute Kontakte zu Journalisten.<br />
Daher ist die Kontaktpflege ein wesentlicher Erfolgsfaktor.<br />
Pressefoto<br />
Ein wesentliches Element von Pressemitteilungen ist das<br />
Pressefoto. Es sollte in ausreichender Auflösung (300 dpi)<br />
und Qualität als Anhang zusammen mit der Pressemitteilung<br />
an die Redaktionen versendet werden. Das Foto muss<br />
zum Thema passen. Zudem darf die Bildunterschrift (Erklärung<br />
zum Foto, Angabe der Personen auf den Fotos usw.)<br />
niemals fehlen.<br />
Welche Berichte fallen auf? Meist sind es Beiträge, bei<br />
denen ein gutes Foto platziert ist. Die Aufnahme vom<br />
Ausschuss ist selten ein gutes Foto, ebenfalls nicht der<br />
Festredner, dessen Gesicht durch Blumengestecke oder<br />
ein Mikrofon kaum zu sehen ist. Aktivitäten hingegen sind<br />
gefragt, interessante Ausschnitte sprechen an. Motive<br />
sollten sich in den Unterlagen eines Vereins finden, damit<br />
auch für den Versammlungsbericht ein gutes Bild zur Verfügung<br />
steht.<br />
Wen will ich erreichen?<br />
• Regional: Muss es ganz Südtirol wissen? Muss es Bezirk<br />
oder der Ort wissen?<br />
• Sozial: Muss es die ganze Bevölkerung wissen oder<br />
nur eine bestimmte Zielgruppe?<br />
• Zeit: Wie schnell muss es jemand wissen?<br />
Dementsprechend wähle ich die Form des Artikels und das<br />
kontaktierte Medium: Tagespresse, Wochenpresse, Monatspresse,<br />
Radio, TV (Programme, Tagesschau…).<br />
Welche Medien brauche ich dafür?<br />
• Es gibt den „Südtiroler Landwirt“, wo man nicht nur<br />
auf den SBJ-Seiten, sondern auch je nach Thema in<br />
anderen Teilen des Blattes einen Artikel unterbringen<br />
kann.<br />
• Dolomiten, Tageszeitung, Alto Adige (dt. Seite), Mattino,<br />
Rai-Tagesschau, Mittagsjournal, RMI (Nachrichten<br />
von sieben privaten Südtiroler Rundfunksendern).<br />
• Südtirolweit, aber auch auf Bezirksebene (gesamte<br />
Bevölkerung).
27<br />
Wenn technische Geräte benötigt werden (z. B. Laptop<br />
und Beamer für eine PowerPoint-Präsentation), sind diese<br />
frühzeitig zu organisieren und am Tag vorher auf ihre<br />
Funktionsfähigkeit zu testen. Nicht vergessen werden darf<br />
die Erstellung einer Pressemappe mit allen wichtigen Informationen.<br />
Diese wird nach der Pressekonferenz jenen Medienvertretern<br />
gegeben, die an der Pressekonferenz nicht<br />
teilgenommen haben.<br />
SBJ-Prospekte, Plakate mit SBJ-Logo, SBJ-Fahnen usw.<br />
sind nützliche Hilfsmittel. Diese Materialien informieren<br />
über die Südtiroler Bauernjugend und wecken durch ein<br />
einheitliches Erscheinungsbild Vertrauen.<br />
Wie erreiche ich die Medien am besten?<br />
• Persönlicher Kontakt<br />
• Telefon oder E-Mail<br />
• Einladungen<br />
• Nachträgliche Pressemitteilung über ein Ereignis<br />
Kontakte pflegen<br />
Gute Kontakte zu Medienleuten erleichtern die Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Wer die örtlichen Berichterstatter kennt,<br />
lässt diesen die Einladung zu wichtigen Terminen ebenso<br />
zukommen wie der Redaktion. Der Bericht findet auch<br />
leichter die Zeitung, wenn er über einen Mitarbeiter eingeht.<br />
Dann ist der Text bereits bearbeitet, muss nicht<br />
mehr gekürzt werden. Rücksprache mit den Redaktionen<br />
verhindert Enttäuschungen.<br />
Schaukasten<br />
Ein effektives PR-Instrument sind Schaukästen, sofern sie<br />
immer auf dem neuesten Stand sind und den Verband/<br />
Verein eindeutig kennzeichnen. Die Ankündigungen von<br />
Veranstaltungen, die bereits stattgefunden haben, werfen<br />
ein schlechtes Licht auf die Ortsgruppe. Zudem ist bei den<br />
Ankündigungen auf die Schriftgröße zu achten, da viele Informationen<br />
nur im Vorbeigehen wahrgenommen werden.<br />
Ein guter Schaukasten muss drei Funktionen erfüllen:<br />
1. Information: Neuigkeiten bekannt machen<br />
2. Werbung: Auf Veranstaltungen aufmerksam machen<br />
und einladen<br />
3. Imagepflege: Besondere, eigene Leistung hervorheben<br />
Der Schaukasten kann dem Bauernjugendmitglied von Nutzen<br />
sein. Wenn das Mitglied z.B. die Termine im Schaukasten<br />
angeschlagen findet, kann man sich seine Zeit besser<br />
einteilen. Außerdem müssen nicht wegen jeder Kleinigkeit<br />
Flugzettel und Rundschreiben angefertigt werden, um den<br />
Mitgliedern die Termine mitzuteilen<br />
Pressekonferenz<br />
Pressekonferenzen werden immer dann organisiert, wenn<br />
die Botschaft (Nachricht, Ereignis, Standpunkt usw.)<br />
nicht über eine einfache Pressemitteilung kommuniziert<br />
werden kann. Das ist immer dann der Fall, wenn die Botschaft<br />
kompliziert und erklärungsbedürftig ist. Klassische<br />
Beispiele für Pressekonferenzen sind die wöchentliche<br />
Pressekonferenz der Landesregierung oder die Bilanzpressekonferenzen<br />
großer Unternehmen. Allerdings sollte mit<br />
dem Instrument „Pressekonferenz“ sparsam umgegangen<br />
werden.<br />
Bevor die Planung der Pressekonferenz beginnt, muss<br />
geklärt werden, ob sich das Thema für eine Pressekonferenz<br />
eignet. Wenn ja, müssen zuerst der Ort der Pressekonferenz<br />
und die Teilnehmer ausgewählt werden. Mit<br />
allen Teilnehmern müssen der Ablauf und die Themen/<br />
Botschaften der Pressekonferenz besprochen werden.<br />
Dabei sollten alle Teilnehmer dieselbe Botschaft vermitteln.<br />
Etwa 10 Tage vor der Pressekonferenz sollten die<br />
Medien eingeladen werden. Sinnvoll ist es auch, am Tag<br />
vor der Pressekonferenz eine Erinnerung zu versenden.
28<br />
Die optische Gestaltung:<br />
Welche Schrift verwendet wird, hängt vom Thema und<br />
dem Kreis der Angesprochenen ab. Im Allgemeinen soll<br />
eine gut leserliche neutrale Schrift verwendet werden.<br />
Wir alle reagieren auf Farbe, Licht und Ton. Die farblich<br />
gute Zusammenstellung des Schaukastens ist daher sehr<br />
wichtig: nicht weiß oder grau in grau gestalten! Die Farbe<br />
soll ansprechen, darf aber nicht mehr auffallen als der<br />
eigentliche Inhalt des Plakates. Sie soll alles harmonisch<br />
verbinden. Farben wie Rot, Orange oder gelb regen die<br />
Aufmerksamkeit auf sich. Eher beruhigend wirken blau,<br />
grün, und grau. Auf einem Plakat soll man höchstens drei<br />
Farben verwenden, es soll nicht zu bunt werden.<br />
TIPP<br />
Hier eine Aufstellung welche Schriften in welcher Farbe<br />
auf welchem Grund am besten lesbar sind:<br />
• schwarze Schrift auf gelben Grund<br />
• grüne Schrift auf weißem Grund<br />
• rote Schrift auf weißem Grund<br />
• blaue Schrift auf weißem Grund<br />
• weiße Schrift auf blauen Grund<br />
Eine dunkle Farbe auf hellem Grund lässt sich immer besser<br />
lesen als eine helle Farbe auf dunklerem Grund.<br />
Der Tätigkeitsbericht<br />
Der Tätigkeitsbericht soll einen Einblick geben in die Organisation,<br />
Aufgaben, Zielsetzung, Vorhaben usw. nach<br />
dem Motto: wer sind wir, was wollen wir, was tun wir.<br />
Er soll so geschrieben sein, dass sich auch ein Außenstehender<br />
ein umfassendes Bild über die Ortsgruppe machen<br />
kann. Deshalb soll er je nach Bedarf stichwortartig oder<br />
ausführlich sein.<br />
Inhalte des Tätigkeitsberichts:<br />
• Vorstellung der betreffenden Organisation (SBJ-Ortsgruppe,<br />
SBJ-Bezirk usw.)<br />
• Mitgliederzahl und Mitgliederstruktur (z.B. wer sind<br />
die Mitglieder, Altersklasse usw.)<br />
• Besondere Schwerpunkte<br />
• Mitgliederzahl und erfüllte Aufgaben des Ortsausschusses<br />
• Veranstaltungen (Aus- und Weiterbildung, Wettbewerbe<br />
und Lehrfahrten)<br />
• Öffentlichkeitsarbeit<br />
Die Einladung<br />
Sie ist ein schriftlicher Aufruf zur Teilnahme an einer Veranstaltung<br />
oder Ähnlichem. Es soll unmissverständlich daraus<br />
hervorgehen wer, was, wann, wo organisiert. Eventuell<br />
kann die Art der Veranstaltung, Ort und Datum besonders<br />
hervorgehoben werden z.B. durch eine größere Schrift,<br />
fettgedruckt usw.<br />
Inhalte der Einladung:<br />
• Programm der Veranstaltung: Wenn in einigen Punkten<br />
angeführt wird, wie es abläuft, was gezeigt wird, was<br />
man lernen kann, so regt das zum Besuch noch mehr<br />
an, als wenn nur der Titel oder Thema in der Einladung<br />
ersichtlich ist.<br />
• Name des/der Redner/s, Kursleiters, Referenten: Wenn<br />
diese einen guten Namen haben, kommen unter Umständen<br />
auch mehr Leute<br />
• Tag der Veranstaltung<br />
• Ort der Veranstaltung<br />
• Beginn der Veranstaltung<br />
• Was ist allenfalls einzubringen: z.B. Papier, Schreibzeug,<br />
Werkzeug, andere schriftliche Unterlagen<br />
• Kosten: (falls nicht von Vornhinein klar ist, dass der<br />
Eintritt frei ist)<br />
• Beweggründe: Der Personenkreis der eingeladen werden<br />
soll, und die Begründung warum der Besuch von<br />
großem Vorteil ist, ist am Besten in einem oder zwei<br />
freundlichen Sätzen zu formulieren.<br />
Das Flugblatt<br />
Flugblätter werden händisch weitergegeben oder liegen<br />
zum Mitnehmen an verschiedenen Orten auf. Sinn und<br />
Zweck ist eine möglichst kostengünstige und weite Verbreitung<br />
einer Information, ohne bestimmte Zielgruppe
29<br />
Das Plakat<br />
Um Veranstaltungen gut zu bewerben ist die Plakatwerbung<br />
eine der wichtigsten Werbeformen für einen Verein, denn:<br />
und ohne auf Print- oder Funkmedien zurückzugreifen.<br />
Inhalte des Flugblatts:<br />
• Die Information soll möglichst kurz, übersichtlich und<br />
auf den ersten Blick erfassbar sein.<br />
• Grafische Gestaltung nach Belieben (auch mit Zeichnungen,<br />
Symbolen usw.)<br />
Das Rundschreiben<br />
Es dient in erster Linie dazu, Informationen an eine bestimmte<br />
Zielgruppe (z.B. Mitglieder der Ortsgruppe) schnell<br />
und gleichzeitig weiterzugeben. Das Rundschreiben wird<br />
meist per Post verschickt. Wenn alle Mitglieder eine E-Mailadresse<br />
haben, dann auch per E-Mail.<br />
Inhalte des Rundschreibens:<br />
• Alles, was die Empfänger des Rundschreibens wissen<br />
sollen<br />
• Eventuell anführen, wer für weitere Informationen zuständig<br />
ist<br />
• Plakate sind gern gesehen<br />
• Plakate gefallen<br />
• Plakate fallen auf<br />
• Plakate sind schlagkräftig<br />
• Plakate sind imposant<br />
• Plakate sind überall präsent<br />
• Plakate sind unübersehbar<br />
• Plakatwerbung ist kostengünstig<br />
Plakat ist nicht gleich Plakat<br />
Mit einem Plakat will der Verein möglichst viele Menschen<br />
ansprechen. Um dieses Ziel zu erreichen muss man ein paar<br />
Grundregeln beachten:<br />
Plakatgröße:<br />
Ein Plakat wirkt auf Entfernung! Deshalb ist es wichtig,<br />
dass die Plakatgröße der Entfernung angepasst wird. Ein<br />
DIN A3-Plakat in Augenhöhe auf eine Tür geklebt, die viele<br />
Menschen öffnen müssen, ist sicherlich wirkungsvoll. Ein<br />
DIN A3 Plakat das die Leute auf eine Entfernung von 10<br />
Metern nur im schnellen Vorüberfahren sehen, wirkt so, als<br />
ob eine Briefmarke aus ca. 30 Zentimeter Entfernung an<br />
jemanden vorbeihuscht. Am besten man testet selber aus<br />
welches Format gut wirkt.
30<br />
Inhalt:<br />
Ein Plakat ist plakativ! Deshalb kann es nicht komplexe<br />
Themen darstellen. Für die Betrachter des Plakats muss<br />
das Thema groß und klar ersichtlich sein. Deshalb soll ein<br />
ansprechendes Bild und ein Titel mit maximal fünf kurzen<br />
Wörtern verwendet werden.<br />
Bei Veranstaltungen und Aktionen gilt folgende Reihenfolge:<br />
• Thema<br />
• Zeit<br />
• Ort<br />
• Veranstalter<br />
• Anmeldung<br />
Übersicht:<br />
Der Blick des Betrachters darf nicht herumirren, um die<br />
wichtige Bildinformation zu finden. Das Plakat muss deshalb<br />
übersichtlich gestaltet werden und ein einfaches und<br />
leicht erkennbares Ordnungsraster enthalten. Am einfachsten<br />
ist es, die verschiedenen Elemente wie Thema, Zeit,<br />
Ort, Bild usw. parallel oder im rechten Winkel miteinander<br />
optisch zu verbinden.<br />
Bilder:<br />
Bilder sind für ein Plakat der Augenfänger Nummer eins!<br />
Deshalb sollte ein Bild wenigstens ein Viertel der Gesamtfläche<br />
des Plakats ausmachen. Das Bild kann aber auch auf<br />
die ganze Fläche verteilt werden und die Schrift auf das Bild<br />
gestellt werden. Es ist wichtig Bilder mit großflächigen und<br />
gut erkennbaren Elementen zu verwenden, denn sie sind<br />
auf Entfernung besser zu erkennen als differenzierte Auflösungen.<br />
Blau: Blau ist die Farbe des Himmels. Sie steht für Ruhe,<br />
Vertrauen, Pflichttreue, Schönheit und Sehnsucht.<br />
Grau: Sie ist die Farbe des wolkenverhangenen Himmels an<br />
einem trüben Tag. Sie ist die Farbe vollkommener Neutralität,<br />
Vorsicht, Zurückhaltung und Kompromissbereitschaft.<br />
Will man zum Beispiel auf ein Sommerfest hinweisen und<br />
eine starke Aufmerksamkeit erregen, dann sollten kräftige<br />
Rot- und Gelbtöne gewählt werden, denn diese Farben sagen<br />
Folgendes aus:<br />
Rot: Rot ist die Farbe des Feuers. Sie erregt Aufmerksamkeit,<br />
steht für Vitalität und Energie, Liebe und Leidenschaft.<br />
Gelb: Gelb ist die Farbe der Sonne. Sie vermittelt Licht, Heiterkeit<br />
und Freude. Sie steht auch für Wissen, Weisheit,<br />
Vernunft und Logik.<br />
TIPP<br />
SBJ-Plakate:<br />
Damit alle Ortsgruppen für Veranstaltungen effizient Werbung<br />
machen können, hat die Südtiroler Bauernjugend Plakate<br />
in zwei verschiedenen Größen (DIN A2 und DIN A3)<br />
drucken lassen.<br />
Diese Plakate sind im SBJ-Landessekretariat kostenlos erhältlich.<br />
Farben:<br />
Farben ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, wirken auf vielfältige<br />
Weise und üben somit einen großen Einfluss auf den<br />
Betrachter des Plakates aus.<br />
Gelb ist der Neid, Grün die Hoffnung, Lila der letzte Versuch,<br />
sagte man früher. Farben besitzen jedoch auch andere<br />
Qualitäten, z. B. hell, dunkel, warm, kalt, natürlich, künstlich,<br />
klar, gebrochen (mit weiß oder schwarz gemischt), rein<br />
oder gemischt.<br />
Um die Farben gezielt einzusetzen muss man sich zuerst<br />
folgende Fragen stellen:<br />
• Welche Aussage will ich treffen?<br />
• Welchen Eindruck will ich vermitteln?<br />
Will man zum Beispiel neue Mitglieder für eine Ortsgruppe<br />
gewinnen so muss man Seriosität und Sicherheit ausdrücken.<br />
Dies erreicht man indem man Grün- und Blautöne<br />
verwendet und sie mit Grau kombiniert. Diese Farben vermitteln<br />
Folgendes:<br />
Grün: Sie ist die Farbe der Wiesen und Wälder. Sie ist eine<br />
beruhigende Farbe. Sie steht für Großzügigkeit, Sicherheit,<br />
Harmonie, Hoffnung und Erneuerung des Lebens.
31<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
ORGANISIEREN<br />
Wer kennt das nicht: Diskussion im Ausschuss, eine Idee<br />
für eine neue Veranstaltung entsteht und eifrig wird drauf<br />
los organisiert. Steht man dann kurz vor der Veranstaltung,<br />
sind plötzlich noch viele kleinere und größere Sachen zu<br />
organisieren, an die man einfach nicht gedacht hat. Das<br />
kann dazu führen, dass die Veranstaltung nicht das Ergebnis<br />
bringt, das man sich wünscht. Mit dem richtigen Plan<br />
und den richtigen Schritten wird eine Veranstaltung zum<br />
Erfolg. Das möchte die Südtiroler Bauernjugend in diesem<br />
<strong>Funktionärsleitfaden</strong> näher beleuchten, denn eine Veranstaltung<br />
beginnt, bevor sie beginnt!<br />
1. Schritt: Klären der grundsätzlichen<br />
Fragen<br />
• Kapazität – Haben wir die nötigen Ressourcen und Helfer,<br />
die Veranstaltung zu organisieren?<br />
• Finanzen – Können wir das finanzielle Risiko tragen,<br />
falls die Veranstaltung nicht so laufen sollte wie geplant?<br />
• Partner – Braucht es Partner und wenn ja, kann man<br />
sich auf ihre Mithilfe verlassen?<br />
2. Schritt: Das Ziel<br />
Es ist wichtig, dass die Organisatoren sich Gedanken darüber<br />
machen, was man mit der Veranstaltung erreichen<br />
möchte. Folgende Fragen sind dafür sehr hilfreich:<br />
• Soll die Veranstaltung zur Imageverbesserung der Südtiroler<br />
Bauernjugend organisiert werden?<br />
• Soll es eine Mitgliederwerbung für die Südtiroler Bauernjugend<br />
sein?<br />
• Soll die Förderung von Geselligkeit, Kultur oder Sport<br />
im Vordergrund stehen?<br />
• Soll die Finanzlage der Südtiroler Bauernjugend verbessert<br />
werden?<br />
Sollen die Einnahmen der Anlass sein, ist es wenig sinnvoll,<br />
einen Informationsabend zu organisieren. Soll aber die<br />
Imageverbesserung im Vordergrund stehen, hat es wenig<br />
Sinn, einen Ausschank von Getränken zu organisieren. Sind<br />
sich die Organisatoren darüber im Klaren, welches Ziel erreicht<br />
werden soll, muss darüber gesprochen werden, wie<br />
es erreicht werden kann.<br />
Beispiel<br />
Die Ortsgruppe möchte neue Mitglieder anwerben. Hier<br />
liegt die Idee eines interessanten „Vorstellungsabends“<br />
nahe. Um diesen möglichst attraktiv zu gestalten, kann<br />
man sich lustige Gemeinschaftsspiele ausdenken, wo die<br />
Besten auch etwas gewinnen können.<br />
Gleichzeitig ist es wichtig den Verein vorzustellen und die<br />
positiven Eigenschaften herauszustreichen.<br />
TIPP<br />
Die Größe der Veranstaltung soll bereits im Vorfeld besprochen<br />
und abgeklärt werden. Das ist die Voraussetzung für<br />
alle weiteren Schritte.<br />
Um die Zielsetzung zu klären, können z.B. zwei Gruppen<br />
gebildet werden, die die Anliegen aufschreiben, die mit der<br />
Veranstaltung erreicht werden sollen. Im zweiten Schritt<br />
soll gemeinsam ein klar formuliertes Grundziel für die Veranstaltung<br />
definiert und dieses protokolliert werden. Dabei<br />
ist zu bedenken, dass das Ziel motivierend, aber unbedingt<br />
realisierbar sein muss.<br />
3. Schritt: Der Termin<br />
Beim Festlegen des Termins muss eine ausreichende Vorbereitungszeit<br />
eingeplant werden. Bei der Festsetzung des<br />
Termins gibt es zwei Arten:<br />
Bei der Vorwärtsterminierung ist klar wann mit der Organisation<br />
der Veranstaltung gestartet wird. Hier müssen sich<br />
die Organisatoren die Frage stellen: Wann können wir die<br />
Veranstaltung sicher durchführen, wenn wir mit der Organisation<br />
heute starten?
32<br />
Bei der Rückwärtsterminierung steht der Termin für die Veranstaltung<br />
bereits fest. Hier müssen sich die Organisatoren<br />
die Frage stellen: Wann müssen wir anfangen, damit wir<br />
die Veranstaltung zu diesem Termin durchführen können?<br />
Für ein Event mit gewisser Größenordnung, kann die Vorbereitungszeit<br />
auch etwa ein Jahr beanspruchen, besonders<br />
dann, wenn man sich zum ersten Mal an so etwas<br />
heranwagt. Für kleinere Veranstaltungen plant man je nach<br />
Anlass zwischen zwei und sechs Monaten.<br />
TIPP<br />
Genehmigungen, Sicherheitsdienste (Feuerwehr, Polizei,<br />
Rettungsdienst) Sponsoring- und andere Förderungsansuchen<br />
setzen oft längere Instanzenwege voraus. Deshalb ist<br />
es wichtig diese Formalitäten gleich anzugehen.<br />
Wichtig ist es auch, sowohl Termine im Ort, in der näheren<br />
Umgebung oder wichtige Termine südtirolweit zu beachten.<br />
Es soll auch an die Termine anderer Ortsgruppen, des<br />
Bezirkes oder des Landesverbandes der Südtiroler Bauernjugend<br />
gedacht werden. Eine Terminüberschneidung z. B.<br />
mit Veranstaltungen, die für die eigene Zielgruppe interessant<br />
sind, soll vermieden werden.<br />
Tipp: Termine des Ortes sind im Veranstaltungskalender der<br />
Gemeinde oder des Tourismusvereins, Bauernjugend-Termine<br />
auf www.sbj.it zu finden.<br />
4. Schritt: Der Austragungsort<br />
Bei der Wahl des Austragungsortes gilt es die Teilnehmeranzahl,<br />
die Ausstattung der Räumlichkeit, die passende<br />
Atmosphäre der Veranstaltung und die Jahreszeit zu beachten.<br />
Zudem ist es für die Organisatoren wichtig, klare<br />
Vorstellungen darüber zu haben, wie viel die Miete des<br />
Austragungsortes kosten darf und zu berücksichtigen, dass<br />
der Ort für alle leicht erreichbar ist. Die Räumlichkeiten sollen<br />
nicht zu klein sein, aber auch nicht zu groß. Die Teilnehmer<br />
dürfen sich nicht verloren vorkommen, denn dann hat<br />
die Veranstaltung, und sei sie auch noch so gut, gleich den<br />
unangenehmen Beigeschmack von wenig Interesse.<br />
TIPP<br />
Bei Veranstaltungen bei denen mit einer größeren Teilnehmerzahl<br />
gerechnet wird, unbedingt im Vorfeld die Parkmöglichkeiten<br />
abklären.<br />
5. Schritt: Die Finanzierung<br />
Die Finanzierungsplanung der Veranstaltung ist eine der<br />
wichtigsten Fragen. Gemeinsam müssen Kostenrahmen<br />
festgelegt und Einnahmequellen gesucht bzw. bewertet<br />
werden. Um auch in der Umsetzungsphase den Überblick<br />
nicht zu verlieren, ist es wichtig, Ausgaben zu definieren<br />
und die Kosten richtig einzuschätzen. Eine gute Möglichkeit<br />
um möglichst klare Vorstellungen über die Kosten zu<br />
erhalten ist es, in einer Excel-Tabelle die einzelnen Posten<br />
aufzulisten und dazu die Kosten zu schätzen. So kann<br />
festgestellt werden ob das bestehende Budget für die<br />
Veranstaltung ausreicht. Wichtig ist es dann während der<br />
Planungsphase alle Kosten, die man durchs einholen von<br />
Kostenvoranschlägen fix definieren kann, in einer Excel-<br />
Tabelle einzutragen. Dadurch wird der Finanzierungsplan<br />
immer klarer und das Organisationskomitee hat die Möglichkeit<br />
bei Veränderungen schnell zu reagieren. Eine Person<br />
(der Kassier) soll für Finanzen verantwortlich sein. In einer<br />
Sitzung wird der erstellte Finanzplan abgesegnet.<br />
TIPP<br />
Einer der häufigsten Fehler in der Finanzplanung ist es, kleine<br />
Rechnungen zu unterschätzen. Die Summe dieser „Kleinigkeiten“<br />
führt oft zu einer Kostenexplosion.<br />
Mögliches Vorgehen: Nach der TOP-DOWN Methode sich<br />
bei der Schätzung von den großen Kostenposten zu den<br />
kleinen durcharbeiten. Somit erhält man ein möglichst genaues<br />
Bild über die Kosten.<br />
Für einen ausgeglichenen Finanzplan ist neben der Kosten-<br />
auch eine Einnahmenabschätzung notwendig. Im<br />
Ausschuss muss nachgedacht werden, wie die Ausgaben<br />
abgedeckt werden können. Die Einnahmen müssen die<br />
Kosten der Veranstaltung decken.<br />
Punkte in einem Finanzierungsplan könnten folgende sein.<br />
Einfach daneben die (geschätzte) Summe schreiben und<br />
mit den Einnahmen vergleichen.<br />
Ausgaben:<br />
• Räumlichkeiten<br />
• Musik (Livegruppe oder DJ)<br />
• Werbung (Plakate, Einladungen, Flyer, Radiowerbung)<br />
• Getränke Einkauf<br />
• Essen Einkauf<br />
• Personalkosten (Koch, Sicherheitspersonal)<br />
• Technikkosten<br />
• S.I.A.E Gebühren<br />
• Steuern<br />
• Dekoration<br />
• Behördliche Gebühren (Stempelmarken)<br />
• Dokumentation (z.B. Fotos)<br />
• Reinigung, usw.<br />
Einnahmen:<br />
• Eintritt<br />
• Verkauf von Speisen und Getränk<br />
• Werbepartner<br />
• Beiträge<br />
• Spenden, usw.<br />
6. Schritt: Die Bewerbung<br />
Je nach Zielgruppe und Veranstaltung ist es sinnvoll entweder<br />
ein persönliches Einladungsschreiben oder eine allgemeine<br />
Ankündigung durch Plakate, Inserate oder Radiowerbung<br />
zu wählen.
33<br />
Werben kann man je nach Anlass und den finanziellen Möglichkeiten<br />
mit:<br />
• Handzettel verteilen und in Lokalen anschlagen<br />
• Plakate (auch über Plakatinstitute - Achtung es muss<br />
Plakatierungsgebühr bezahlt werden)<br />
• Rundschreiben an alle Mitglieder<br />
• Vorankündigung an die Tageszeitungen in Südtirol senden<br />
• Radiowerbung - vor allem, wenn die Veranstaltung öffentlichen<br />
Charakter hat<br />
• Dorfblatt/Dorfzeitung sowie Bezirksblatt<br />
• Südtiroler Landwirt – Veranstaltungen von SBJ-Ortsgruppen<br />
werden im Landwirt abgedruckt. Ein rechtzeitiger<br />
Anruf oder ein E-Mail genügen.<br />
• SBJ-Webseite – Dort werden alle Veranstaltungen der<br />
Ortsgruppen angekündigt<br />
TIPP<br />
Unter www.provinz.bz.it/lpa/medienverzeichnis.asp findet<br />
man den Kontakt zu allen Medien (Tageszeitungen, Radiosender,<br />
Gemeindeblätter, Bezirksblätter, usw.…) in Südtirol.<br />
Es ist wichtig auf die Redaktionstermine zu achten. Ein<br />
vorheriger Anruf in der Redaktion ist eine gute Möglichkeit,<br />
einen direkten Kontakt zu knüpfen und die Chancen für<br />
eine Veröffentlichung zu erhöhen.<br />
Einladung als Werbemöglichkeit<br />
Einladungen sind ein gutes Instrument um viele Gäste persönlich<br />
zu erreichen. Dabei müssen sich die Organisatoren<br />
im Klaren sein, dass der erste Eindruck der Einladung entscheidend<br />
ist. Sie sollte deshalb auffallend und informativ<br />
sein, nicht zu viel Text beinhalten und auf die Veranstaltung<br />
neugierig machen.<br />
Wochen vorher zugesendet werden. Auch ist es wichtig,<br />
sich bei der Post über die verschiedenen Möglichkeiten und<br />
Kosten zu informieren. So können Kosten gespart werden.<br />
7. Schritt: Die Verpflegung der Gäste<br />
Man sollte bedenken, dass das Essen dem Großteil der<br />
Teilnehmer, ob jung oder alt, zusagen sollte, am besten<br />
etwas Gängiges, nicht zu Ausgefallenes wählen. Besonders<br />
gut kommt es an, als Südtiroler Bauernjugend den<br />
Teilnehmern Spezialitäten aus der bäuerlichen Küche zu<br />
servieren. Es sollen dabei Lebensmittel gekauft werden die<br />
in unserem Land produziert werden, denn sie stehen für<br />
Qualität aus Südtirol. Zum Einkaufen sollte man möglichst<br />
nicht fort fahren, sondern bei den heimischen Anbietern<br />
im Dorf einkaufen. Dadurch sichern wir die Nahversorgung<br />
im ländlichen Raum. Als Südtiroler Bauernjugend sollten<br />
wir Lebensmitteleinkäufe bewusst saisonabhängig tätigen.<br />
Weiters sollten Produkte mit kurzen Transportwegen der<br />
Vorzug gegeben werden. Es ist auch empfehlenswert mit<br />
gutem Beispiel voran zu gehen und eventuell auch andere<br />
Vereine vor Ort anzuregen, bei den Veranstaltungen einheimische,<br />
landwirtschaftliche Produkte zu verwenden. Als<br />
Südtiroler Bauernjugend sollten wir einheimische bäuerliche<br />
Produkte kaufen und damit den wirtschaftlichen Erfolg<br />
unserer bäuerlichen Familienbetriebe, den Arbeitsplatz<br />
„Bauernhof“ und die Wertschöpfung im eigenen Land sichern!<br />
Auch bei Getränken sollen einheimische Produkte bevorzugt<br />
werden. Jugendlichen unter 18 Jahren wird kein Alkohol<br />
ausgeschenkt. Mischgetränke und „starker“ Alkohol<br />
sollen vermieden werden.<br />
TIPP<br />
TIPP<br />
Je größer die Veranstaltung ist, umso früher muss eine persönliche<br />
Einladung zur Vorankündigung verschickt werden.<br />
Je nach Größe spricht man hier von sechs Monate bis drei<br />
Wochen vorher. Terminerinnerungen sollen frühestens zwei<br />
Bei der Bestellung der Menge empfiehlt es sich um Erfahrungswerte<br />
beim Getränkelieferanten nachzufragen oder<br />
die Erfahrung von früheren Veranstaltungen mit einbeziehen.<br />
Die Regelungen betreffend Gratis-Ausschank und<br />
Selbstverpflegung der Helfer muss im Vorfeld vom Organisationskomitee<br />
beschlossen werden.
34<br />
8. Schritt: Organisatorisches<br />
Dekoration<br />
Die Dekoration muss dem Motto der Veranstaltung angepasst<br />
werden. So kann bei den Besuchern ein bleibender<br />
Eindruck erreicht werden.<br />
Tipp: Eine Fahne mit dem Aufdruck Südtiroler Bauernjugend<br />
oder eine Tirolerfahne machen Eindruck und können<br />
kostenlos im Landessekretariat der Südtiroler Bauernjugend<br />
ausgeliehen werden.<br />
Krisenmanagement<br />
Während der Veranstaltung können unvorhergesehene Ereignisse<br />
auftreten bei denen man schnell reagieren muss.<br />
Diese Entscheidungen sollen von einer Kerngruppe (Ortsobmann,<br />
Ortsleiterin, Stellvertreter, Kassier und Schriftführer)<br />
entschieden werden ohne dabei grundlegende Dienste auszusetzen:<br />
Eintritt, Musik, Sicherheitsdienst, Garderobe, usw.<br />
Tipp: Vor der Veranstaltung soll gemeinsam festlegt werden,<br />
wer diese Entscheidungen treffen darf und alle beteiligten Helfer<br />
sind darüber in Kenntnis zu setzen. So können Streitigkeiten<br />
während der Veranstaltung vermieden werden.<br />
Notfallutensilien<br />
Es ist ratsam auch an Dinge wie Zwischenstecker, Handy,<br />
Aufladegerät für die Kamera usw. zu denken.<br />
9. Schritt: Die Arbeitseinteilung<br />
Beschilderung<br />
Toiletten, Räume, Notausgänge, Parkplätze usw. sollen mit<br />
Schildern gut sichtbar gekennzeichnet werden. Bei kommerziellen<br />
Veranstaltungen müssen Preislisten erstellt werden.<br />
Der Schriftführer soll dafür sorgen, dass genügend<br />
Preislisten vor Ort sind. Die Preislisten sollen übersichtlich<br />
gestaltet sein und an gut sichtbaren Orten aufgehängt<br />
werden.<br />
Technik<br />
Videotechnik, Audiotechnik, Beleuchtung, Präsentationshilfsmittel<br />
und Anschlüsse sollen vorab von einem Ausschussmitglied,<br />
das sich mit Technik gut auskennt, getestet<br />
werden. Dabei sollen die Aufbauzeit und die Zeit zum<br />
Testen der Geräte am Veranstaltungsort mit eingerechnet<br />
werden. Kabel sollen sorgfältig verlegt werden, damit niemand<br />
stolpert und sich verletzt.<br />
TIPP<br />
Ortsgruppen, die sich kostenlos technische Geräte leihen<br />
möchten können, dies beim Amt für audiovisuelle Medien<br />
tun. Das Amt für audiovisuelle Medien befindet sich in der<br />
Andreas-Hofer-Straße 18, in Bozen - Tel. 0471 412915 -<br />
E-Mail: av-medien@provinz.bz.it<br />
Das Formular zum bestellen kann unter www.provinz.bz.it/<br />
kulturabteilung/technik.asp heruntergeladen werden. Auch<br />
im SBJ-Landessekretariat kann das Formular angefordert<br />
werden.<br />
Wechselgeld<br />
Der Kassier ist dafür zuständig, genug Wechselgeld zu<br />
organisieren. Anhand der Preisliste soll geschaut werden,<br />
welche Geldstücke es am meisten brauchen wird.<br />
Verantwortliche<br />
Die für die Veranstaltung hauptverantwortlichen Personen,<br />
meist Ortsobmann und Ortsleiterin, müssen allen bekannt<br />
sein. Sie müssen für die Helfer erreichbar oder anwesend<br />
sein. Sie sorgen für das Zusammenspiel aller Teilbereiche. Sie<br />
bewahren alle erforderlichen Unterlagen auf, koordinieren alle<br />
Arbeitsschritte und Abläufe.<br />
Helfer<br />
Die Aufgaben sollen vorab gemeinsam im Ausschuss besprochen<br />
und aufgeteilt werden. Ein Zeitplan für die Helfer ist<br />
für die Organisation sehr hilfreich. Diesen Zeitplan soll der<br />
Schriftführer in einer Übersicht auflisten und die Übersicht soll<br />
an die Helfer verteilt werden. Jedem Helfer muss bekannt sei,<br />
was er wie lange macht und wer ihn eventuell ablöst.<br />
TIPP<br />
Es ist sinnvoll für die Helfer eine Telefonliste zu erstellen, die<br />
alle wichtigen Telefonnummern der Verantwortlichen beinhaltet.<br />
Allen Helfern muss bewusst sein, dass jeder zum Erfolg der<br />
Veranstaltung beiträgt. Teamwork heißt auch Ergänzung, Ausgleich<br />
und Mithilfe wo es notwendig ist. Wenn jemand ausfällt,<br />
muss es einen Ersatz (Springer – ist nirgends eingeteilt<br />
und übernimmt Sachen, die nicht planbar sind) geben.<br />
TIPP<br />
Ein kurzes Briefing vor Beginn der Veranstaltung, bei dem<br />
nochmals das Ziel, dass mit der Veranstaltung erreicht werden<br />
soll und der Gemeinschaftssinn unterstrichen wird, kann sehr<br />
motivierend sein.<br />
10. Schritt: Die letzten Vorbereitungen<br />
Video und Fotografie<br />
Aufnahmen vor und während der Veranstaltung sind sehr<br />
wichtig für die Dokumentation der Tätigkeit und für die<br />
Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Kurz vor der Veranstaltung ist es wichtig folgende Checks zu<br />
machen:<br />
• Dekorations Check<br />
• Technik Check<br />
• Catering Check<br />
• Garderoben Check<br />
TIPP<br />
Eine Checkliste mit den oben genannten Punkten kann sehr<br />
hilfreich sein.
35<br />
11. Schritt: Während der Veranstaltung<br />
Während der Veranstaltung ist es für die Verantwortlichen<br />
sehr wichtig den Überblick zu behalten. Oft werden kleine<br />
Dinge wie Kontrolle der WC-Anlagen oder der Aschenbecher<br />
vergessen. Für die Organisatoren ist es wichtig während<br />
der Veranstaltung:<br />
• zu kontrollieren, dass die Beauftragten die Arbeiten<br />
auch ausführen<br />
• frühzeitig bei den einzelnen Verantwortlichen Informationen<br />
einzufordern, ob Nachbestellungen gemacht<br />
werden müssen<br />
• den Programmablauf zu überwachen<br />
• die Gäste zu betreuen<br />
12. Schritt: Nach der Veranstaltung<br />
Verlassen die letzten Gäste die Veranstaltung, ist die Veranstaltung<br />
noch nicht vorbei. Es ist wichtig auf bestimmte<br />
Dinge zu achten:<br />
• die Verantwortlichen sollen die Abräumarbeiten koordinieren<br />
• die Kassen müssen sofort eingesammelt werden, das<br />
Geld gezählt und evtl. in einen Nachttresor gegeben<br />
werden<br />
• teure Gegenstände sollen sofort weggeschlossen werden<br />
• Fundgegenstände sollen gesammelt werden;<br />
• bei der Übergabe der Räumlichkeiten an den Vermieter<br />
sollen eventuelle Schäden gemeinsam begutachtet<br />
werden<br />
Pressearbeit<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit ist nach der Veranstaltung genauso<br />
wichtig wie vor der Veranstaltung. Es kann eine Presseaussendung<br />
an verschiedene Medien gesendet werden.<br />
Auch ein Bericht für die Dorfzeitung oder das Bezirksblatt<br />
ist wichtig.<br />
13. Schritt: Die Nachbesprechung<br />
Für die Erfolgskontrolle ist eine Nachbesprechung der Veranstaltung<br />
sehr sinnvoll. Es ist wichtig, dass die Nachbesprechung<br />
bald nach der Veranstaltung abgehalten wird.<br />
Jedes Ausschussmitglied teilt seine positiven und negativen<br />
Eindrücke mit. Diese werden vom Schriftführer festgehalten<br />
und bei der Planung der nächsten Veranstaltung<br />
wieder vorgestellt. Weiters ist es wichtig, dass der Schriftführer<br />
alle Dokumente zur Veranstaltung (Protokolle, Rechnungen,<br />
Finanzierungsplan usw.) für eventuelle Folgeveranstaltungen<br />
übersichtlich und sorgfältig ablegt. So kann die<br />
zweite Auflage der Veranstaltung mit Hilfe der Unterlagen<br />
leichter geplant werden.<br />
Der Kassier soll bei der Nachbesprechung eine Abrechnung<br />
präsentieren. Der Kassier hat auch dafür Sorge zu tragen,<br />
dass alle Ausstände (Getränke-lieferant, Geschäfte, usw)<br />
beglichen werden. Weiters muss, wenn mit der Veranstaltung<br />
gewerbliche Einnahmen erzielt werden (mittels F24)<br />
Mehrwertssteuer eingezahlt werden.<br />
TIPP<br />
Folgende Fragen können für die Nachbesprechung verwendet<br />
werden:<br />
• Hat die Veranstaltung das Ziel erreicht?<br />
• Wie war der Eindruck bei den Besuchern/Teilnehmern?<br />
• Was hat nicht gut funktioniert?<br />
• Wo wurden Fehler gemacht, die beim nächsten Mal<br />
vermieden werden können?<br />
• Was ist besonders gut gelungen?<br />
• Wie war die Vorbereitung?<br />
• Wie hat der Ausschuss zusammengearbeitet?<br />
• Gab es organisatorische Zwischenfälle?<br />
• Was könnte man das nächste Mal anders/besser machen?<br />
Rechtliches und Versicherung<br />
Alle Informationen zu Steuerrechtlichen Fragen, S.I.A.E.<br />
usw. können dem Steuerleitfaden der Südtiroler Bauernjugend<br />
entnommen werden. Alle Informationen zur Versicherung<br />
der Südtiroler Bauernjugend, die auch für alle<br />
Ortsgruppen gilt, können dem SBJ-Versicherungsleitfaden<br />
entnommen werden.<br />
Versicherungs- und Steuerleitfaden ist im SBJ-Landessekretariat<br />
erhältlich.<br />
TIPP<br />
Bei besonderen Veranstaltungen kann auch ein Bericht mit<br />
Foto an das Landessekretariat der Südtiroler Bauernjugend<br />
geschickt werden. Der Bericht wird dann gerne auf den<br />
SBJ-Seiten im Südtiroler Landwirt abgedruckt und auf die<br />
SBJ-Internetseite www.sbj.it gestellt.
36<br />
DAS PERFEKTE<br />
FOTO<br />
Die Bildauflösung<br />
Ein Pixel ist nichts anderes als ein Bildpunkt, ein Megapixel<br />
sind eine Million Bildpunkte. Die Megapixel sagen also aus, mit<br />
wie vielen Millionen Pixeln eine Digitalkamera ein Bild auflöst.<br />
Wenn man nun ein Bild auf dem Monitor ganz nah heranzoomt,<br />
kommt man den geheimnisvollen Pixeln auf die Spur. Denn<br />
dieses Pixel, der einzelne Bildpunkt, ist nichts anderes als ein<br />
farbiges, kleines Quadrat. Je mehr dieser Bildpunkte auf einen<br />
Kamerachip passen, desto detaillierter das Bild. Höhere<br />
Pixelwerte bedeuten folglich nicht nur mehr Qualität, sondern<br />
sagen auch aus, wie groß das Bild vergrößert werden kann.<br />
Die Bildqualität<br />
Es gibt eine Qualität die in den Händen des Fotografen liegt.<br />
Und es gibt eine, die von den Rahmenbedingungen sowie der<br />
eingesetzten Technik bestimmt wird. Die Auflösung der Kamera,<br />
die Güte und Brennweite des Objektes sind einige dieser<br />
technischen Merkmale. Andere verstecken sich in Chips und<br />
Bits und Bytes tief im Inneren der Kamera.<br />
Die Schärfe<br />
Kameradisplays leisten heute schon wesentlich mehr als noch<br />
vor einigen Jahren. Dennoch liegt es in ihrer Natur, dass sie<br />
klein sind. Und damit nicht geeignet, die Schärfe eines Bildes<br />
zu prüfen. Hierfür bedarf es schon eines prüfenden Blickes<br />
am Monitor.<br />
Man kann ruhig zweimal hinschauen, denn Schärfe ist nicht<br />
gleich Schärfe. Da gibt es die Tiefenschärfe und die Tiefenunschärfe,<br />
die bereits beim Fotografieren beeinflussen und später<br />
auch mit der besten Bildbearbeitung nicht mehr weg gehen.<br />
Eine hohe Bildschärfe sagt, dass ein großer Bereich vor und<br />
hinter der scharf gestellten Fläche eine ebenfalls hohe Schärfe<br />
aufweist. Dies ist beispielsweise bei Sachfotos erwünscht, bei<br />
Gruppenfotos oder Aufnahmen aus der Totale, auf denen mehrere<br />
Menschen in verschiedenen Aufnahmeentfernungen zu sehen<br />
sind. Die hohe Tiefenschärfe wird durch das Fotografieren<br />
mit einer möglichst kleinen Blendenöffnung erreicht.<br />
Aber auch Fotos mit geringer Tiefenschärfe haben ihren Reiz.<br />
Am häufigsten kommt diese Technik in der Portraitfotografie<br />
zum Einsatz, wenn störende Hintergründe einfach in der Unschärfe<br />
verschwinden.<br />
TIPP<br />
Wenn man Menschen oder deren Gesichter fotografiert, dann<br />
soll man auf die Augen scharf stellen, andernfalls wird die Aufnahme<br />
vom Betrachter als zu scharf wahrgenommen.<br />
Die Bildqualität<br />
Körnigkeit/Bildrauschen<br />
Häufig ist auf Fotos das sogenannte Rauschen zu sehen – es<br />
macht den Eindruck, als sie das Bild grob gekörnt. Dieses Bildrauschen<br />
hat mehrere Ursachen – die beiden wichtigsten: Die<br />
Größe des Chips und der beim Fotografieren eingestellte ISO-<br />
Wert; günstigere Kameras ohne ISO-Vorwahl haben mitunter<br />
auch einen sogenannten Restlichtverstärker, der den gleichen<br />
Effekt bewirken kann. Häufige Verursacher des Bildrauschens<br />
sind kleine Sensoren mit einer großen Auflösung. Hier müssen<br />
auf kleinem Raum eine große Anzahl an Pixel untergebracht
37<br />
werden. Diese liegen dann sehr nahe beieinander und können<br />
sich infolgedessen gegenseitig stören – und damit das<br />
Bildrauschen verursachen bzw. verstärken.<br />
Wie bereits erwähnt, zählen hohe ISO-Werte bzw. Restlichtverstärker<br />
zu der anderen Gruppe der häufigsten<br />
Rauschverursacher. Aber warum? Bei schlechten Lichtverhältnissen<br />
wird eine Signalverstärkung durchgeführt, um<br />
aus der Kameraelektronik einen Optimum heraus zu holen.<br />
Dabei wird es für die Elektronik jedoch schwer, zwischen<br />
den verschiedenen Signalarten zu unterscheiden, wodurch<br />
bildrauschende Fehlsignale entstehen.<br />
Viel Theorie – in der Praxis bedeutet dies zweierlei:<br />
• Fotografieren soll man mit viel Licht und ISO-Werten<br />
um den Wert 100.<br />
• Beim Kauf einer Kamera soll man lieber auf das ein<br />
oder andere Megapixel verzichten und stattdessen auf<br />
eine hohe Qualität der Kamera achten<br />
Dunkle Gesichter<br />
Gerade in Lichtsituationen mit starken Helligkeitsunterschieden<br />
– z. B. Gegenlicht – kommt es oft vor, dass die<br />
Gesichter der Fotografierten unterbelichtet werden, da sich<br />
die Kamerabelichtung fälschlicherweise an der stärkeren<br />
Lichtquelle orientiert. In diesen Fällen hilft das Anblitzen<br />
des im Gegenlicht stehenden Motivs oder aber eine Belichtungseinstellung,<br />
die sich am Motiv und nicht am Hintergrund<br />
orientiert. Wenn trotzdem mal ein Belichtungsfehler<br />
dieser Art passiert ist, lässt er sich bis zu einem gewissen<br />
Grad durch Bildbearbeitungsprogramme korrigieren.<br />
Weiße Bildstellen<br />
Da, wo Licht auf ein Bild trifft, wird es logischerweise hell.<br />
Da, wo sehr viel Licht auftrifft, wird es weiß. Dies können<br />
die Sonne sein, Lichtreflexe, eine künstliche Lichtquelle<br />
oder auch die Wolken. Hier sollte im Bildbearbeitungsprogramm<br />
nachgebessert werden. Hier ist am Besten soweit<br />
abzudunkeln, dass wenigstens eine minimale Farbdeckung<br />
von 5% erreicht wird. Dies ist notwendig, damit das Bild<br />
vor den weißen Stellen nicht ausfranst.<br />
Die Bildausrichtung<br />
In viele Fotos ließen sich Ausrichtungslinien einzeichnen.<br />
Das ist in keiner Weise so merkwürdig, wie es klingt.<br />
Nimmt man beispielsweise ein Foto, auf dem ein Horizont<br />
zu sehen ist. Wenn der Horizont auf dem Bild nicht waagrecht<br />
erscheint, so kommt dem Betrachter das Bild unweigerlich<br />
schief vor. Gleiches gilt für Linien, die man sich<br />
senkrecht denken kann. Ein Hohes Gebäude, ein Hydrant<br />
oder Fahnenmast beispielsweise sollten für das Sehverhalten<br />
unseres Auges gerade ausgerichtet sein. Bei aller Geradlinigkeit:<br />
dieses optische Gesetz kann man aber auch<br />
mit Absicht verkehren und hiermit interessante Effekte<br />
schaffen.<br />
Wer kennt das nicht – ein gelungenes Portraitfoto, an dem<br />
alles stimmt. Oder sagen wir besser: fast alles. Denn die<br />
Augen des Fotografierten reflektieren unwirklich und unschön<br />
rot. Ursache: die Netzhaut ist rot. Wird sie direkt<br />
angeblitzt (von einem Blitzgerät in gleicher Achse beispielsweise)<br />
reflektiert sie das Licht rot. Die Lösung: ein<br />
Blitzgerät verwenden, das so weit wie möglich von der<br />
optischen Achse Objektiv/Augen entfernt ist. Oder indirekt<br />
Blitzen – an die Decke zum Beispiel.<br />
Tipps zum Digitalkamerakauf<br />
Zunächst gilt es heraus zu finden, für welchen Einsatzzweck<br />
die Kamera überwiegend gebraucht wird. Während<br />
für Landschaftsaufnahmen beispielsweise ein guter Weitwinkelbereich<br />
wichtig ist, sollte bei der Sportfotografie auf<br />
eine kurze Auslöseverzögerung sowie auf einen ordentlichen<br />
Telebereich geachtet werden. Bei Partyfotos benö-
38<br />
tigt man eine Kamera, die auch bei wenig Licht noch gute<br />
Ergebnisse bringt. Einstellbare ISO-Werte sind hier ebenso<br />
wichtig wie ein geringes Rauschen bei dürftigen Lichtverhältnisse<br />
und höheren ISO-Zahlen. Bei Tierbildern steht<br />
eindeutig ein großer Zoom Bereich an erster Stelle. Wanderer,<br />
Bergsteiger, Camper und alle sonstigen Outdoorabenteurer<br />
finden spezielle Modelle, die durch Features wie<br />
Stoßfestigkeit oder Wasserdichtheit, nicht zuletzt durch<br />
geringe Größe und kleines Gewicht, outdoortauglich sind.<br />
Für die meisten Anwender jedoch zählt, dass die Kamera<br />
auf jeden Fall universell einsetzbar ist. Hier gibt es grundsätzlich<br />
5 wesentliche Punkte, die bei der Auswahl beachtet<br />
werden sollten:<br />
Megapixel<br />
Megapixel sind gut. Aber nicht alles. Viele schielen bei der<br />
Auswahl ihrer Kamera ausschließlich auf die Pixel, weil sie<br />
diese mit Bildschärfe verwechseln. Tatsächlich bestimmt<br />
die Anzahl der Pixel lediglich die Ausgabengröße eines<br />
Bildes. So könnte man beispielsweise mit einer 12 Megapixelkamera<br />
Bilder aufnehmen, die sich in Größen von<br />
60x40 cm und mehr ausbelichten ließen. Aber mal ehrlich<br />
– wer macht das? Und wer braucht das? Für ein normales<br />
10x15 cm Bild ohne Ausschnittsvergrößerungen reicht<br />
schon eine 2 Megapixel Kamera.<br />
Suchergröße<br />
Die Qualität des Suchers bestimmt, wie gut das Bildfeld<br />
abgedeckt wird. Beim Kauf daher einen Blick durch den<br />
Sucher werfen. Es sollte groß und hell genug sein.<br />
Farbdisplay<br />
Das Display der Kamera sollte mindestens 2“, besser 2,5“<br />
groß sein. Schließlich will man ja nicht nur erkennen was<br />
man fotografiert hat, sondern anschließend auch eine erste<br />
große Auswahl zwischen gelungen und sicher nicht<br />
gelungen Fotos treffen. Doch nicht nur die Größe zählt.<br />
Auch eine gute Pixelauflösung, genügend Helligkeit und<br />
Kontrastvermögen steigern den Sehkomfort erheblich. Hat<br />
das Display ca. 200.000 Pixel zählt es auf jeden Fall zu<br />
den Besseren. Wenn sie im Geschäft ihre Wunschkamera<br />
testen, dann gehen sie ruhig einmal raus vor die Tür mit<br />
ihr. Denn ein Display ist erst dann richtig gut, wenn man<br />
auch bei Tageslicht alles noch gut erkennt.<br />
ISO-Wert<br />
Die richtige Belichtung beeinflusst das Ergebnis des Fotos<br />
natürlich erheblich. Und daher spielen auch die ISO-Werte<br />
eine Rolle. Die ISO-Werte bezeichnen die Lichtempfindlichkeit<br />
des Kamera-Bildsensors. Je lichtempfindlicher diese<br />
ist, desto weniger Licht ist für akzeptable Fotos notwendig.<br />
Gängig sind ISO-Werte zwischen 50 und 1.600. 50 ISO<br />
würde man zum Beispiel an einem extrem hellen Sommertag<br />
und an sonnigen Tagen im Schnee einstellen. Ein<br />
trüber, bewölkter Wintertag würde so etwa 400 ISO erfordern<br />
und ein Foto bei Kerzenlicht erfordert dann die 1.600.<br />
Aber Achtung – viele Kameras neigen beim erhöhen des<br />
ISO-Wertes zum Rauschen. Kameras meiden, die diesen<br />
Wert automatisch regeln und sich vor dem Kauf unbedingt<br />
von der Bildqualität bei höheren ISO-Werten überzeugen.<br />
Geschwindigkeit<br />
Wenn man Sportfotografien mit einer Kamera machen<br />
möchte oder den ein oder andern Schnappschuss, dann<br />
sollte die Kamera zum Auslösen nicht länger als 0,5 Sekunden<br />
benötigen. Dies ist die sogenannte Auslöseverzögerung.<br />
Brennweite<br />
Je nachdem, was man zu fotografieren beabsichtig, sollte<br />
man die Brennweite wählen. Einfach gesagt beschreibt die<br />
Brennweite, ob der Blick durch die Kamera wie ganz weit<br />
weg und wie nah dran wirkt. Ob sie also aus 3 Metern Abstand<br />
eine ganze Fußballmannschaft aufnehmen können<br />
(Weitwinkel) oder ob sie aus 1 Meter Abstand der Fliege in<br />
die Augen sehen können (Tele). Die Brennweitenbereiche<br />
gängiger Kameras liegen so in dem Bereich von 28 mm bis<br />
130 mm und reichen für die meisten Aufnahmesituationen<br />
völlig aus.
39<br />
somit unspannend wahr.<br />
So ist Fotos schon erheblich geholfen, wenn die Köpfe etwas<br />
oberhalb der Mitte platziert werden. Je mehr man sich<br />
von der Mitte entfernt, desto ungewohnter im positiven<br />
Sinne der Anblick. Den Kopf mal ganz nach links setzten<br />
und näher ran gehen. Man sieht wie so die Fotos an Statik<br />
verlieren und an Dynamik gewinnen.<br />
Fotografieren<br />
Motive aus mehreren Perspektiven zeigen, mal in der Totale<br />
und mal von ganz nah. Man wird überrascht sein, welchen<br />
Effekt Details haben können. Mit einer geschickten Auswahl<br />
kann man nicht nur ganze Geschichten erzählen –<br />
man kann auch bestimmte Teile davon betonen. Ein Freund<br />
feiert seinen 40. Geburtstag und der gedeckte Kaffeetisch<br />
wird fotografiert. Der Fotograf sollte sich ein vielsagenden<br />
Detail ins Visier nehmen – beispielsweise die „40“ aus<br />
Zuckerguss. Oder eine Hochzeit. Das Brautpaar ist sicher<br />
dankbar, wenn später nicht nur Gruppenbilder zu sehen<br />
sind, sondern auch die kleinen „großen“ Dinge – wie beispielsweise<br />
die Eheringe auf dem Samtkissen. Nur Mut.<br />
Ran gehen. Das Motiv von vielen und eben auch den naheliegenden<br />
Seiten entdecken.<br />
Rücken mit Tücken<br />
Ich habe doch keine Augen im Hinterkopf, heißt es manchmal<br />
so schön in anderem Zusammenhang. Das ist bei<br />
unserer Spezies nicht nur zutreffend, sondern auch der<br />
Grund warum man Menschen von vorne fotografieren soll.<br />
Die Augen sind der Fixpunkt- des Gesichtes, des gesamten<br />
Menschen. Aber auch Mimik und Gestik, Lach- oder<br />
Sorgenfalten sind beredete Geschichtenerzähler. Also<br />
menschlichen Motiven von vorne nähern – frontal oder<br />
schräg sind gängige Blickwinkel. Aber auch von den Seiten,<br />
von unten wie von oben können interessante Motive<br />
entstehen. Einfach alles ausprobieren.<br />
Im Mittelpunkt<br />
Kaum ein Portrait ist langweiliger als jenes, das den menschlichen<br />
Kopf in die geometrische Bildmitte stellt. Dies zum<br />
einen, weil den Betrachter meist nicht interessiert was sich<br />
über dem Kopf befindet. Zum anderen ist weder der Kopf<br />
noch der menschliche Körper symmetrisch. Auch existiert<br />
kein wirklicher Mittelpunkt am menschlichen Körper. Zumindest<br />
nicht in der Mitte. Unser Blick hat gelernt, dass<br />
Natürliches häufig ungleichmäßig und gleichmäßiges häufig<br />
unnatürlich ist. Symmetrie und penibel genaue Anordnungen<br />
nehmen wir daher als hingestellt unnatürlich und<br />
Format<br />
Hochformat oder quer? Das hängt sicher zum großen Teil<br />
auch vom Motiv ab. Der Schiefe Turm von Pisa wird sich<br />
im Hochformat sicher wohler fühlen, während Landschaften<br />
einfach im Querformat zu Hause sind. Unabhängig von<br />
solchen Beispielen sollten wir unseren Blick mal kreisen<br />
lassen. Im täglichen Umfeld unserer Gewohnheiten. Geben<br />
sie einem Kind ein Blatt zum Malen – wie wird es das<br />
Blatt ausrichten – hoch oder quer? Einfach umschauen. Im<br />
Büro. Im Wohnzimmern. Welches Format hat der Computermonitor.<br />
Welches der Fernseher? Das Navi? Sie ahnen<br />
es schon: Wann immer es möglich ist, wird das Querformat<br />
von der Mehrzahl aller Menschen als das harmonische<br />
empfunden, das unserer Sehbedürfnisse besser befriedigt.<br />
Perspektive<br />
Wer sich auf gleicher Augenhöhe befindet hat gute Chancen<br />
nicht unter- und nicht überschätzt zu werden. Ernst<br />
genommen und objektiv betrachtet zu werden. Es ist uns<br />
nicht immer klar – aber die Perspektive, der Ort, von dem<br />
aus wir sehen, entscheidet erheblich über unsere Wahrnehmung.<br />
Menschen in Augenhöhe wirken natürlich und<br />
normal. Menschen oder Gegenstände von unten aufgenommen<br />
wirken groß; von oben aufgenommen wirken sie<br />
klein. Auf diese Weise verfügt man über ein gutes Instrument,<br />
mit dem man den Charakter der Fotos steuern<br />
kann – teils sogar hin zu wirklich verblüffenden Effekten.<br />
Beispielsweise wenn ein Baby aus der Froschperspektive<br />
dargestellt wird. Gerade kleine, kompakte Digitalkameras<br />
machen da jeden Streich mit. Sie können hochgehalten<br />
oder flach auf den Boden gelegt werden. Sie können an<br />
ein Karussell gebunden oder auf die Karosserie des Autos<br />
geklebt werden. Sie können auf Zeitauslösung programmiert<br />
und kurz vor der Auslösung in die Luft geschmissen<br />
werden – und das so oft bis ein brauchbares Bild entsteht.<br />
Auch hier bestimmt die Phantasie was möglich ist.<br />
Digitale Bilderflut<br />
Bilder aussortieren<br />
Oft schießt man von einer Szene mehrere Bilder. Man kann<br />
sich ja später die besten aussuchen. Die Erfahrung zeigt,<br />
dass dies dann oft vergessen wird. Am besten man gewöhnt<br />
sich an diese unangenehmen Arbeiten nicht zu verschieben,<br />
sondern zeitnah auszuführen. Die optimale Vorgehensweise:<br />
ganz klar erkennbaren Ausschuss schon auf<br />
der Kamera löschen. Die übrigen Bilder dann gleich nach<br />
der Übertragung auf den PC sichten und die doppelten,
40<br />
schlechten und fehlbelichteten sofort löschen. Das befreit<br />
von Ballast, der die Festplatte überfüllt.<br />
Bilder eindeutig kennzeichnen<br />
Die digitale Fotografie bringt Vorteile mit sich. Bilder können<br />
platzsparend auf dem PC gespeichert werden. Unmengen<br />
von gefüllten Fotoabzügen gehören der Vergangenheit<br />
an. Hier ist es wichtig, dass Fotos immer in eindeutig gekennzeichneten<br />
Ordnern gesichert werden. Damit diese<br />
dann auch schnell gefunden werden können. Sinnvoll ist es<br />
dabei auch mit Datum zu arbeiten.<br />
Hier ein Beispiel: <strong>2019</strong>-01-10 Bauernjugendausflug Zillertal<br />
Diese sogenannte amerikanische Schreibweise macht einen<br />
Sinn. Denn so sortiert der Computer die Ordner automatisch<br />
chronologisch. Enthalten Bilder dasselbe Datum,<br />
dann werden sie alphabetisch sortiert. Die Fotodaten gewinnen<br />
dadurch deutlich an Übersichtlichkeit.<br />
Speichermedien (CD, Software, DVD-Recorder)<br />
Technische Hilfsmittel und Optionen zur Archivierung der<br />
Fotos gibt es genügend. Von der CD über die Festplatte des<br />
Computers bis hin zu eigener Bildarchivierungssoftware ist<br />
alles möglich.<br />
Dennoch muss man eines beachten: die Haltbarkeit.<br />
CD´s halten im Schnitt 10 bis 30 Jahre. Eine sehr ungenaue<br />
Angabe. Es kann aber auch sein, dass sie Aufgrund<br />
von Beschädigung nur einen Monat hält.<br />
Bilddatenbanken sind zur Bildsicherung ebenfalls keine Methode<br />
mit absoluter Sicherheitsgarantie. Das Ablegen auf<br />
der Computerfestplatte ist zwar sehr bequem und auch die<br />
zahlreichen Funktionen der Bildverwaltungssoftware sind<br />
nicht zu verachten. Aber: Die Festplatte des heimischen<br />
Computers ist stärker in Gebrauch als viele andere Speichermedien.<br />
Und hat daher nur eine begrenzte Lebensdauer.<br />
TIPP<br />
Licht am Morgen<br />
Ein kleiner Tipp für Langschläfer: Das Licht am Morgen gilt<br />
unter Fotografen als das Beste. Die dicke Luftschicht, die<br />
unsere Erde umhüllt, filtert morgens blaues Licht. So lassen<br />
Gelb, Orange und Rot alles in warmen Farbtönen erscheinen.<br />
Das Dateiformat<br />
Fotos und Bilder werden vorwiegend in JPEG-Format gespeichert.<br />
Andere Formate wie BMP oder TIF benötigen viel<br />
mehr Speicherplatz, führen aber zu keiner Qualitätsverbesserung.<br />
Nie mehr wackelig auf den Beinen<br />
Manche Fotos kann man nur einmal schießen. Umso schlimmer,<br />
wenn man gerade dieses verwackelt. Ein Tipp: das Gewicht<br />
der Kamera mit der linken Hand halten. Den Arm an<br />
den Körper drücken. Die rechte Hand ist lediglich dazu da,<br />
den Auslöser zu betätigen. Die natürliche Körperspannung<br />
zur Stabilisierung nützen.<br />
Scharf gestellt<br />
In der Makrofotografie ist es wichtig, dass die Fokussierung<br />
stimmt. Deshalb ist es hier sinnvoll, diese manuell einzustellen.<br />
Zum millimetergenauen Scharfstellen sollte die auf<br />
einem Stativ befindliche Kamera vor- und zurückbewegt<br />
werden. So kann die optimale Schärfe bestimmt werden.<br />
Fokussieren eines beweglichen Objektes<br />
Um ein sich bewegendes Objekt scharf zu fotografieren,<br />
verwendet man am besten die manuelle Fokussierung. Auf<br />
einen Punkt fokussieren, von dem man weiß, dass das bewegliche<br />
Objekt diesen passieren wird. Wenn das Objekt<br />
diesen Punkt passiert, im richtigen Moment abdrücken. Dabei<br />
darauf achten, dass manche Kameras eine Auslöseverzögerung<br />
gibt. Das ist die Zeit zwischen dem Betätigen des<br />
Auslösers und dem Öffnen des Verschlusses. Diese kann<br />
schon mal einige zehntel Sekunden betragen.<br />
Der Digitalzoom<br />
Wenn man an wirklich gelungenen Digitalbildern hoher Qualität<br />
interessiert ist, dann sollte man auf den Digitalzoom<br />
verzichten. Er verschlechtert die Auflösung der Bilder, weil<br />
die Bildinhalte künstlich hochgerechnet werden. Mit den
41<br />
Bei einer höheren Brennweite ist der Schärfebereich kleiner.<br />
So hebt sich die scharf gestellte Gesichtsebene angenehm<br />
vom unscharfen Hintergrund ab. Sofern es Kamera<br />
bzw. Objektiv also zulassen, soll man ruhig mit einem starken<br />
Tele fotografieren. 200mm sind hier kein Problem.<br />
Wenn man die natürlichste Perspektive für Portraitfotos<br />
sucht, soll man in Augenhöhe fotografieren. Wenn man die<br />
ganze Person aufnehmen möchte, soll man die Kamera auf<br />
Brusthöhe halten.<br />
Überlappungen vermeiden<br />
Man soll vermeiden, dass sich auf Fotos Motive überlappen,<br />
dies führt zu einem chaotischen Bildaufbau. Bei einem<br />
Portraitbild wirkt eine Straßenlaterne im Hintergrund<br />
schnell so, als ob sie aus dem Kopf wächst. Bitte vermeiden.<br />
Bildbearbeitungsprogrammen am PC kann man beliebig<br />
zoomen und die Qualität bleibt erhalten.<br />
Übung macht den Meister<br />
Anfangs ist es oft schwer, beim Fotografieren den richtigen<br />
Bildaufbau zu gestalten. Hier gilt das Motto: Üben,<br />
üben und üben – denn nur dies macht den Meister. Zum<br />
Beispiel mehrmals eine Vase vor einem kahlen Hintergrund<br />
fotografieren und die Vase dabei immer an verschiedenen<br />
Stellen positionieren. Bzw. die Entfernung zur Vase verändern.<br />
Man wir sehen: Im Laufe der Zeit entwickelt man ein<br />
besseres Gefühl, wie man Motive ins bessere Licht rückt.<br />
Frosch oder Vogel<br />
Die am häufigsten verwendete Perspektive ist die Vogelperspektive.<br />
Aber man kann es auch mal umgekehrt machen.<br />
Das Motiv von unten fotografieren. Das gibt besonders<br />
bei Objekten, bei denen der Betrachter weiß, dass sie<br />
eigentlich sehr klein sind, eindrucksvolle Bilder. Eine Blume<br />
oder ein Pilz eignen sich dafür sehr gut.<br />
Der rote Blickfang<br />
Den Bildern fehlt das gewisse Etwas? Man kann es einfach<br />
mal mit einem Farbtupfer probieren. Rot eignet sich hier<br />
besonders gut. Ein knallrotes Auto in einer faden, grauen<br />
Landschaft zieht neugierige Blicke auf sich und sorgt für<br />
spannende Akzente.<br />
Tiere fotografieren<br />
Wenn Tiere fotografiert werden, ist es wichtig, dass man<br />
den Tieren immer auf Augenhöhe begegnet. Das gilt für<br />
Pferd und Hamster gleichermaßen. So hat man Freude mit<br />
den Tierfotos, denn sie wirken viel eindrucksvoller.<br />
Portraitfotos<br />
Hier existieren zwei wesentliche Einstellungen, die im Übrigen<br />
auch das Portraitprogramm nachempfindet:<br />
• Mit möglichst großer Blende fotografieren.<br />
• Mit möglichst großer Brennweite fotografieren.<br />
Wasserspiegelungen<br />
Landschaftsmotive können um einen interessanten Effekt<br />
bereichert werden, indem man auch natürliche Spiegelung<br />
im Wasser mit in den Bildausschnitt nimmt.<br />
Kinderbilder<br />
Beim Knipsen von Kinderbildern am besten in die Hocke<br />
gehen. So begegnet man sich auf Augenhöhe. Von oben<br />
wirken sie unnatürlich und bedrückend.<br />
Der richtige Moment<br />
Der Bruchteil einer Sekunde kann über gute oder schlechte<br />
Qualität entscheiden. In vielen Situationen ist es ratsam<br />
den Knopf schon halb gedrückt zu halten und auf den richtigen<br />
Moment zu warten. So können Schärfe und Belichtung<br />
bereits eingestellt werden. Man gewinnt so wertvolle<br />
Sekunden.<br />
Sonnenlicht und Gesicht<br />
Am besten wirken in der Sonne geschossene Bilder von<br />
Gesichtern, wenn das Sonnenlicht schräg von vorne auf<br />
das Gesicht trifft. Strahlt das Licht direkt von vorn, sind<br />
fast keine Schatten im Gesicht zu sehen und es wirkt<br />
flach. Außerdem wirken geblendete Personen nicht gerade<br />
entspannt.<br />
Das Umfeld einbeziehen<br />
Eine Person nicht einfach vor einen Hintergrund stellen.<br />
Stets versuchen einen Zusammenhang zwischen Person<br />
und Hintergrund herzustellen. Beispielsweise dadurch,<br />
wenn jemand in einer Blumenwiese fotografiert wird, sollte<br />
er ein paar Blumen in den Händen halten.<br />
Ruhige Hand<br />
Viele Kameras haben einen optischen Bildstabilisator. Dieser<br />
erkennt Bewegungen in der Hand und gleicht sie so<br />
aus, dass ein Bild ohne Verwackelungen entsteht.<br />
Landschaftsaufnahmen<br />
Für Landschaftsaufnahmen ein Weitwinkelobjektiv ver-
42<br />
wenden um den Vordergrund zu betonen. So wird die Illusion<br />
von Raum geschaffen.<br />
Die Methode mit dem Sand<br />
Wenn man Lichtstrahlen fotografieren will, gibt es einen<br />
simplen Trick: einen Freund zu Hilfe nehmen, der vor der<br />
Kamera in der Nähe des Lichtes ein paar Handvoll Sand in<br />
die Luft wirft und dann schnell aus dem Bild verschwindet.<br />
Nach wenigen Sekunden wenn sich der Sand setzt,<br />
werden die Lichtstrahlen klar und deutlich sichtbar. Dann<br />
einfach auslösen.<br />
Dezenten Hintergrund verwenden<br />
Für Motive immer einen einfachen Hintergrund verwenden.<br />
Ein Muster lenkt ab und macht Unruhe. Ein dezenter Hintergrund<br />
betont das Motiv.<br />
Blitzbereich beachten<br />
Immer prüfen ob das Motiv im Blitzbereich liegt. Bei den<br />
meisten Kameras liegt dieser Bereich bei nur 3 Metern,<br />
also bei ca. 4 Schritten. Ist das Motiv weiter entfernt,<br />
kann es zu dunkel werden.<br />
Die Himmelsgrenze<br />
Wie man den Horizont gut in die Bildkomposition einbaut:<br />
Wenn die wichtigsten Motive mit der Erde verbunden sind,<br />
dann ist es sinnvoll den Horizont bei etwa ein Drittel unterhalb<br />
des oberen Bildrandes zu legen; wenn man eine<br />
beeindruckende Himmelsansicht zeigen will soll man den<br />
Horizont bei etwa ein Drittel oberhalb des unteren Bildrandes<br />
legen.<br />
Möglichst wenig Licht verlieren<br />
Bei wenig Licht sollte man in der Weitwinkeleinstellung<br />
fotografieren. So geht am wenigsten Licht verloren. Teleeinstellungen<br />
von Zoomoptiken hingegen schlucken Licht.<br />
Portraitaufnahmen in Innenräumen<br />
In Innenräumen Portraitaufnahmen immer in der Nähe des<br />
Fensters machen. Hier ist das Licht weicher und es wirkt<br />
natürlicher.<br />
Schlagschatten durch Blitzlicht<br />
Wird bei einer Portraitaufnahme frontal vor dem Motiv ausgelöst,<br />
so kann dies zu störenden Schlagschatten führen.<br />
Man kann dies zwar über ein Bildbearbeitungsprogramm<br />
korrigieren, dies ist allerdings zeitaufwendig. Lieber den<br />
Abstand zum Objekt vergrößern und die Zoomfunktion<br />
verwenden. An die Decke blitzen. So wird ein weiches und<br />
stark gestreutes Licht erzeugt. Dies reduziert die Schlagschatten.<br />
Spiegelflächen<br />
Durch Glasfassaden lassen sich zwei Gebäude miteinander<br />
kombinieren. Idealerweise wird ein älterer Baustiel in<br />
einem neuern gespiegelt.<br />
Düstere Fotos<br />
Düstere Gewitterwolken oder Dämmerlicht können Landschaften<br />
dramatisch wirken lassen und super Bilder ergeben.<br />
Belichtung möglichst kurz halten bei großer Blendenöffnung<br />
(kleine Blendenzahl). Darüber hinaus bei dieser Art<br />
von Fotos einen hohen ISO-Wert einstellen am besten 800<br />
oder 1.600.<br />
Der romantische Sonnenuntergang<br />
Für ein solches Bild muss man sich genug Zeit nehmen.<br />
Damit man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Am besten<br />
ein Stativ mitnehmen, dann gibt es auch mal eine Pause<br />
für die Augen. Eine lange Brennweite ist besonders wichtig.<br />
Das Tier steht Modell<br />
Tiere verstehen den Menschen nicht? Wenn man gute Tierfotos<br />
machen will, sollte man umdenken. Tiere verstehen<br />
sehr wohl – sie verstehen es die Körpersprache der Menschen<br />
zu deuten. Eine tiefe Kopfhaltung wirkt oft negativ<br />
und vermittelt Angriffslust. Bitte stets auf Augenhöhe mit<br />
dem Tier bleiben.<br />
Quelle:<br />
QuiCompany – Athesia Druck GmbH, Brixen
43<br />
MIT WEITERBILDUNG<br />
EINEN SPRUNG VORAUS<br />
Die SBB-Weiterbildungsgenossenschaft unterstützt die<br />
Weiterbildungstätigkeit auf Ortsebene beratend aber auch<br />
finanziell.<br />
Um diese Unterstützung in Anspruch nehmen zu können,<br />
muss die Ortsgruppe mindestens 14 Tage vor Kursbeginn<br />
ein Finanzierungsansuchen mit den wichtigsten Kursdaten<br />
an die Weiterbildungsgenossenschaft stellen. Die Formulare<br />
erhält die Ortsgruppe bei der Weiterbildungsgenossenschaft<br />
oder im SBJ-Landessekretariat. Die Ortsgruppe erhält<br />
eine Rückmeldung via E-Mail, ob das Ansuchen genehmigt<br />
wurde oder nicht. Nach Kursende kann der Referent 30<br />
Euro pro Weiterbildungsstunde (eine Weiterbildungsstunde<br />
entspricht 45 Minuten) der Weiterbildungsgenossenschaft<br />
in Rechnung stellen. Voraussetzung für diese Förderung<br />
ist, dass der Kurs mit einer Mindestteilnehmerzahl von acht<br />
Personen stattgefunden hat und mittels Meldeformular und<br />
Teilnehmerliste gemeldet wird.<br />
Falls das zwischen Ortsgruppe und Referent vereinbarte<br />
Honorar über die Finanzierung der Weiterbildungsgenossenschaft<br />
hinausgeht, verrechnet der Referent den restlichen<br />
Betrag an die Ortsgruppe.<br />
Weiterbildungsbroschüre<br />
Jedes Jahr veröffentlicht die SBB-Weiterbildungsgenossenschaft<br />
in Zusammenarbeit mit dem BRING und dem Beratungsring<br />
für Obst- und Weinbau eine Broschüre mit einem<br />
umfassenden Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen für<br />
die ländliche Bevölkerung Südtirols und alle Interessierten. Die<br />
Broschüre ist im Südtiroler Bauernbund erhältlich oder kann<br />
unter www.sbb.it herunter geladen werden.<br />
Weiterbildung für Ortsobmänner und Ortsleiterinnen<br />
Ortsobmänner und Ortsleiterinnen haben die Möglichkeit die<br />
Veranstaltungen der SBB-Weiterbildungsgenossenschaft bis zu<br />
einer Gebühr von 50 Euro kostenlos zu besuchen. Beträgt die<br />
Gebühr mehr als 50 Euro, so muss die Hälfte der Kursgebühr<br />
bezahlt werden. Auch die Stellvertreter der jeweiligen Vorsitzenden<br />
können diese Vergünstigung in Anspruch nehmen. Die<br />
Anmeldung bei der SBB-Weiterbildungsgenossenschaft muss<br />
jedoch über den Ortsobmann bzw. die Ortsleiterin erfolgen.<br />
Lehrfahrten und Ähnliches fallen nicht unter diese Regelung.<br />
Informationen:<br />
SBB-Weiterbildungsgenossenschaft, Tel. 0471 999 335,<br />
weiterbildung@sbb.it
44