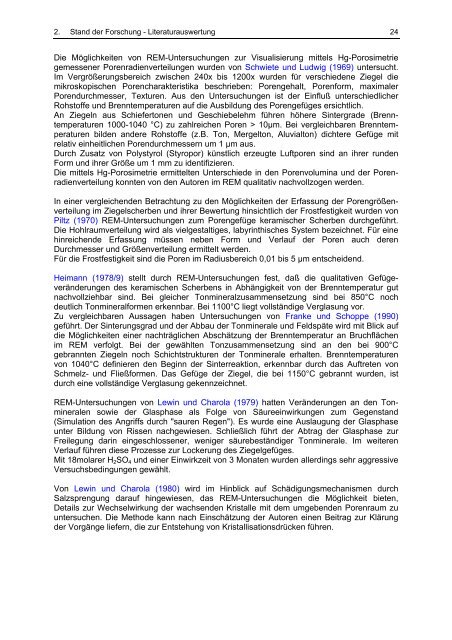Dissertation - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Dissertation - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Dissertation - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Stand der Forschung - Literaturauswertung 24<br />
Die Möglichkeiten von REM-Untersuchungen zur Visualisierung mittels Hg-Porosimetrie<br />
gemessener Porenradienverteilungen wurden von Schwiete und Ludwig (1969) untersucht.<br />
Im Vergrößerungsbereich zwischen 240x bis 1200x wurden für verschiedene Ziegel die<br />
mikroskopischen Porencharakteristika beschrieben: Porengehalt, Porenform, maximaler<br />
Porendurchmesser, Texturen. Aus den Untersuchungen ist der Einfluß unterschiedlicher<br />
Rohstoffe und Brenntemperaturen auf die Ausbildung des Porengefüges ersichtlich.<br />
An Ziegeln aus Schiefertonen und Geschiebelehm führen höhere Sintergrade (Brenntemperaturen<br />
1000-1040 °C) zu zahlreichen Poren > 10µm. Bei vergleichbaren Brenntemperaturen<br />
bilden andere Rohstoffe (z.B. Ton, Mergelton, Aluvialton) dichtere Gefüge mit<br />
relativ einheitlichen Porendurchmessern um 1 µm aus.<br />
Durch Zusatz von Polystyrol (Styropor) künstlich erzeugte Luftporen sind an ihrer runden<br />
Form und ihrer Größe um 1 mm zu identifizieren.<br />
Die mittels Hg-Porosimetrie ermittelten Unterschiede in den Porenvolumina und der Porenradienverteilung<br />
konnten von den Autoren im REM qualitativ nachvollzogen werden.<br />
In einer vergleichenden Betrachtung zu den Möglichkeiten der Erfassung der Porengrößenverteilung<br />
im Ziegelscherben und ihrer Bewertung hinsichtlich der Frostfestigkeit wurden von<br />
Piltz (1970) REM-Untersuchungen zum Porengefüge keramischer Scherben durchgeführt.<br />
Die Hohlraumverteilung wird als vielgestaltiges, labyrinthisches System bezeichnet. Für eine<br />
hinreichende Erfassung müssen neben Form und Verlauf der Poren auch deren<br />
Durchmesser und Größenverteilung ermittelt werden.<br />
Für die Frostfestigkeit sind die Poren im Radiusbereich 0,01 bis 5 µm entscheidend.<br />
Heimann (1978/9) stellt durch REM-Untersuchungen fest, daß die qualitativen Gefügeveränderungen<br />
des keramischen Scherbens in Abhängigkeit von der Brenntemperatur gut<br />
nachvollziehbar sind. Bei gleicher Tonmineralzusammensetzung sind bei 850°C noch<br />
deutlich Tonmineralformen erkennbar. Bei 1100°C liegt vollständige Verglasung vor.<br />
Zu vergleichbaren Aussagen haben Untersuchungen von Franke und Schoppe (1990)<br />
geführt. Der Sinterungsgrad und der Abbau der Tonminerale und Feldspäte wird mit Blick auf<br />
die Möglichkeiten einer nachträglichen Abschätzung der Brenntemperatur an Bruchflächen<br />
im REM verfolgt. Bei der gewählten Tonzusammensetzung sind an den bei 900°C<br />
gebrannten Ziegeln noch Schichtstrukturen der Tonminerale erhalten. Brenntemperaturen<br />
von 1040°C definieren den Beginn der Sinterreaktion, erkennbar durch das Auftreten von<br />
Schmelz- und Fließformen. Das Gefüge der Ziegel, die bei 1150°C gebrannt wurden, ist<br />
durch eine vollständige Verglasung gekennzeichnet.<br />
REM-Untersuchungen von Lewin und Charola (1979) hatten Veränderungen an den Tonmineralen<br />
sowie der Glasphase als Folge von Säureeinwirkungen zum Gegenstand<br />
(Simulation des Angriffs durch "sauren Regen"). Es wurde eine Auslaugung der Glasphase<br />
unter Bildung von Rissen nachgewiesen. Schließlich führt der Abtrag der Glasphase zur<br />
Freilegung darin eingeschlossener, weniger säurebeständiger Tonminerale. Im weiteren<br />
Verlauf führen diese Prozesse zur Lockerung des Ziegelgefüges.<br />
Mit 18molarer H2SO4 und einer Einwirkzeit von 3 Monaten wurden allerdings sehr aggressive<br />
Versuchsbedingungen gewählt.<br />
Von Lewin und Charola (1980) wird im Hinblick auf Schädigungsmechanismen durch<br />
Salzsprengung darauf hingewiesen, das REM-Untersuchungen die Möglichkeit bieten,<br />
Details zur Wechselwirkung der wachsenden Kristalle mit dem umgebenden Porenraum zu<br />
untersuchen. Die Methode kann nach Einschätzung der Autoren einen Beitrag zur Klärung<br />
der Vorgänge liefern, die zur Entstehung von Kristallisationsdrücken führen.