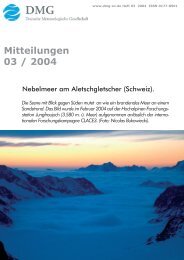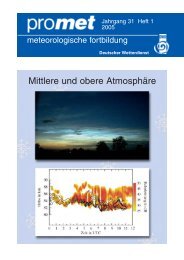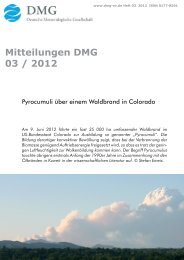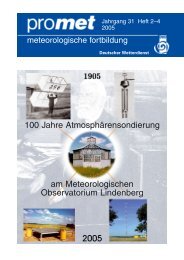Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...
Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...
Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sichern. So musste er sich im Alter von 40 Jahren<br />
entscheiden, in welcher dieser Wissenschaften er<br />
künftig etwas leisten wollte. Er entschied sich für die<br />
Meteorologie und ging 1885 an die Friedrich-Universität<br />
Halle-Wittenberg, um dort mit einer Arbeit über<br />
„die Gewitter in Mitteldeutschland“ als Dr. phil. zu<br />
promovieren und anschließend mit einer Studie über<br />
„die Nachtfröste im Mai“ zu habilitieren. Im Herbstsemester<br />
1885 hielt er in Halle bereits Vorlesungen<br />
über Klimatologie, Meteorologie, Instrumente und<br />
außergewöhnliche Wetterphänomene. Aber schon<br />
im Frühjahr 1886 folgte er dem Ruf<br />
an das reorganisierte <strong>Meteorologische</strong><br />
Institut nach Berlin, wo er<br />
für Gewitter und außerordentliche<br />
atmosphärische Vorkommnisse zuständig<br />
war.<br />
Mit dem Aspirations-Psychrometer,<br />
einem meteorologischen Instrument<br />
zur exakten Bestimmung der<br />
trockenen und feuchten Temperatur,<br />
gelang es Aßmann um 1890,<br />
das grundlegende Problem der fehlerfreien<br />
Temperatur- und Feuchtemessung<br />
in der Meteorologie zu<br />
lösen. Die Entwicklung dieses Gerätes,<br />
die nicht zu seinen Dienstaufgaben<br />
gehörte, erfolgte nicht im<br />
Selbstlauf sondern in einem wahrhaft existenziellen<br />
Kampf um die Anerkennung als Meteorologe gegen<br />
den entschiedenen Widerstand des damaligen Papstes<br />
der Temperaturmessung Heinrich Wild. Dieser<br />
behauptete 1889, dass die Aßmannsche Methode zur<br />
Bestimmung der Lufttemperatur nicht zum Ziele führen<br />
kann. Zum Gegenbeweis waren umfangreiche<br />
Experimente notwendig. Da das <strong>Meteorologische</strong><br />
Institut über kein entsprechendes Messfeld verfügte,<br />
mietete Aßmann eine Wohnung mit anliegendem<br />
großen Garten, in dem die Thermometerhütten für<br />
die Vergleichsmessungen aufgestellt wurden. Diese<br />
Entwicklung erforderte außerordentliche persönliche<br />
Opfer und wurde auch noch durch eine Krankheit<br />
überschattet. Schließlich ging Aßmann gestärkt<br />
aus diesem Überlebenskampf hervor. Sein in den<br />
mechanischen Werkstätten der angesehenen Firma<br />
Fuess gebautes Aspirations-Psychrometer zeigte, in<br />
hochpolierten Metallröhren eingeschlossen und von<br />
einem künstlich erzeugten Luftstrom umspült, in vollem<br />
Sonnenschein praktisch die gleiche Temperatur<br />
wie im Schatten. Aßmann sah von einer Patentierung<br />
des von ihm erfundenen Instrumentes ab, weil nur<br />
eine geringe Stückzahl benötigter Instrumente erwartet<br />
wurde. Hierin hatte er sich allerdings gründlich<br />
geirrt. Dreißig Jahre später wurden bereits 2750<br />
Instrumente verschiedener Ausführung rund um die<br />
Welt eingesetzt. Das Aßmannsche Aspirations-Psychrometer<br />
wurde in der Meteorologie zum Standard-<br />
Instrument für die Temperaturmessung.<br />
forum<br />
Es war Aßmanns Herzenssache<br />
persönlich für<br />
die Genauigkeit seines Instrumentes<br />
zu garantieren.<br />
So führte seine Tochter<br />
Helene viele Jahre lang<br />
die Prüfung und Eichung<br />
eigenhändig durch. Noch<br />
ein Jahrhundert später<br />
konnte durch einen groß<br />
angelegten internationalen<br />
Vergleich von 16 Aspirations-Psychrometern<br />
verschiedener Hersteller<br />
die hohe Messgenauigkeit<br />
bestätigt werden.<br />
Aßmann fand bald ein boldt und dem Aßmannschen<br />
neues Einsatzgebiet für das Aspirations-Psychrometer (links<br />
Aspirations-Psychrometer: am Ausleger).<br />
die Berliner wissenschaftlichen<br />
Luftfahrten. Während vorher die Meteorologie<br />
auf Messungen in Erdbodennähe beschränkt geblieben<br />
war, ging es nun mit Freiballonen hinauf in die freie<br />
Atmosphäre. Dafür wurden ihm von Kaiser Wilhelm<br />
II. Mittel von insgesamt 102,4 TM zur Verfügung gestellt.<br />
Als der Ballon Humboldt am 26. April 1893 nach<br />
der Landung explodierte, wurde dies sofort dem Kaiser<br />
telegraphiert, der sich gerade in Rom aufhielt und von<br />
dort seine Unterstützung für den Bau des neuen Ballons<br />
Phönix zusagte. Mit 6 vorbereitenden Ballonfahrten<br />
von 1888 bis 1891, den sogenannten 40 Hauptfahrten<br />
von 1893 bis 1894 sowie 29 ergänzenden Fahrten von<br />
1895 bis 1899 lag ein großer Schatz von hochwertigen<br />
Messdaten vor. Sie zeigten deutlich, dass die bis dahin<br />
angenommenen Vorstellungen über die Schichtung der<br />
Atmosphäre falsch waren, weil ihnen Messungen zugrunde<br />
lagen, die durch Sonnenstrahlungen verfälscht<br />
waren.<br />
Mit den Berliner wissenschaftlichen Luftfahrten erschloss<br />
Aßmann der Meteorologie die dritte Dimension.<br />
Er organisierte auch bereits 1893/94 die ersten<br />
internationalen Simultanfahrten. Die außerordentliche<br />
Bedeutung dieses Schrittes führte später dazu, dass Aßmann<br />
als Vater der Aerologie, der Wissenschaft von<br />
der freien Atmosphäre, angesehen wurde.<br />
Die Freiballonfahrten blieben aufgrund des hohen<br />
logistischen Aufwandes auf die Untersuchung von<br />
Einzelfällen beschränkt. Aßmann wollte jedoch kontinuierliche<br />
Messungen aus der freien Atmosphäre bereitstellen,<br />
um damit die Wettervorhersagen wesentlich<br />
zu verbessern. Dazu gründete er am 1. April 1900 in<br />
Berlin-Tegel ein Aeronautisches Observatorium, in<br />
dem er die Technik der Drachen und Fesselballone<br />
für die Anwendung in der Meteorologie weiterentwickelte.<br />
Trotz vieler unvorhergesehener Schwierigkeiten<br />
gelang es ihm 19<strong>04</strong> im Durchschnitt täglich eine<br />
Sondierung durchzuführen und Höhen über 4000 m zu<br />
erreichen.<br />
Abb.: Wissenschaftliche Luftfahrt<br />
mit dem Freiballon Hum-<br />
<strong>Mitteilungen</strong> <strong>03</strong>/<strong>04</strong> <strong>2005</strong><br />
11