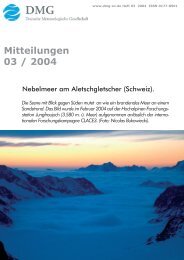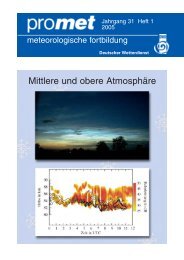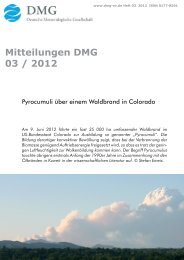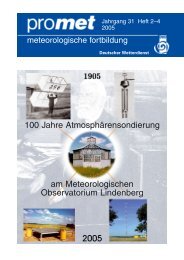Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...
Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...
Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erleichtert die pleistozäne marine<br />
Paläogeographie das Verständnis von<br />
Dansgaard-Oeschger-Ereignissen?<br />
Wolf Tietze<br />
Das allgemeine und im Laufe des 20. Jahrhunderts<br />
stetig zunehmende Interesse am Gang des Klimas<br />
der Erde sowie sich mit der Zeit verbessernde Forschungsmöglichkeiten<br />
haben viele neue Befunde<br />
erbracht, darunter auch manche, die nicht ohne weiteres<br />
erklärlich wirken. Zum Beispiel hat man aus<br />
dem Inlandeis sowohl von Grönland als auch der<br />
Antarktis Eisbohrkerne aus Teufen bis über 3000 m<br />
bergen können und damit Eis gewonnen, das in seinen<br />
untersten Schichten bis ca. 500000 Jahre alt ist.<br />
Analysen solcher Eisbohrkerne weisen unerwartet<br />
kurzfristige und zugleich drastische Klimaschwankungen<br />
aus – um mehrere °C binnen weniger Jahre,<br />
allenfalls Jahrzehnte. Diese Ergebnisse stimmen<br />
überein mit Befunden von Bohrkernen aus Tiefseeböden,<br />
von Lößprofilen sowie von lakustrischen Sedimenten<br />
aus beliebigen Erdzonen, so dass an dem<br />
globalen Charakter derartiger Klimaschwankungen<br />
nicht zu zweifeln ist. Nicht wenige der Proben haben<br />
sich sogar zeitlich koordinieren lassen. Fast alle<br />
entstammen den pleistozänen Eiszeiten. Für die Zeit<br />
danach fanden sich jedoch keine Merkmale für solche<br />
heftigen, schnellen Klimaschwankungen, für die<br />
sich die Bezeichnung „Dansgaard-Oeschger-Ereignisse“<br />
eingebürgert hat nach den beiden Forschern<br />
Willi Dansgaard (Dänemark) und Hans Oeschger<br />
(Schweiz), die sich ganz besonders mit diesem Phänomen<br />
befasst haben.<br />
Jedes neue Phänomen hat die Frage nach seiner<br />
Ursache im Gefolge. Die Vorstellung, das Klima<br />
könnte sich sehr schnell und spürbar verändern, fällt<br />
offensichtlich schwer. Wie in anderen ähnlichen Situationen<br />
werden auch in diesem Fall außerirdische,<br />
kosmische Ursachen für denkbar gehalten. Statt dessen<br />
sei der Blick auf die Paläogeographie der pleistozänen<br />
Eiszeiten geworfen, aus denen ja die Befunde<br />
stammen. Vielleicht findet sich hier eine Erklärung.<br />
Noch vor 20000 Jahren war Nordamerika südwärts<br />
bis über den 50. Breitenkreis hinweg von bis über<br />
3 km mächtigem Inlandeis bedeckt. Ostwärts reichte<br />
forum<br />
diese Eismasse über Grönland hinaus bis zum Europäischen<br />
Nordmeer, westwärts teilweise über das Bering-<br />
Meer bis nach Sibirien. Europa trug ein eigenes großes<br />
Inlandeis, zeitweise ähnlich dem sibirischen aus mehreren<br />
Teilstücken bestehend. Auch die Hochgebirge<br />
waren tief vergletschert, sogar auf der Südhalbkugel.<br />
Dort war vor allem das Eis der Antarktis viel mächtiger<br />
und ausgedehnter als heute. Die in dem Gletschereis<br />
gebundenen Wassermassen hatten zum Ausgleich<br />
eine eustatische Absenkung des Meeresspiegels um<br />
mehr als 100 m zur Folge. Während diese Meeresspiegelabsenkung<br />
global ziemlich gleichmäßig erfolgte,<br />
zeigte die gleichzeitige isostatische Absenkung der<br />
Landoberfläche infolge der Eisauflast regional große<br />
Unterschiede – maximal bis über 800 m. Im einzelnen<br />
ist hierzu noch viel Forschung nötig.<br />
Die Inlandeise unterlagen während langer Zeitabschnitte<br />
einem hochpolaren Klima ähnlich wie heute<br />
die Antarktis. In diesen Phasen reichte die Wärme der<br />
Atmosphäre nicht, das Gletschereis in nennenswerter<br />
Menge zum Schmelzen zu bringen. Folglich breitete<br />
es sich in breiter Front seewärts über die Küsten hinaus<br />
aus. Auf See schwamm es auf und bildete einen Eisschelf<br />
und wurde zu Schelfeis, das heißt: Es schmolz<br />
nicht durch die Wärme der Luft, sondern von unten<br />
durch den Wärmestrom vom Meerwasser zum Eis bis<br />
zu einem Ausgleich, der erreicht wurde, nachdem sich<br />
genügend Schmelzwasser unter dem Eis gesammelt<br />
hatte, um den Wärmefluss zum Eis bis zur Bedeutungslosigkeit<br />
zu behindern. Dieser Ausgleich erklärt die<br />
auffallend gleichmäßige Mächtigkeit aller Schelfeise<br />
gegenwärtig in der Antarktis (200 m).<br />
Selbstverständlich unterliegen die aufschwimmende<br />
Teile der Eisschelfe auch immer dem jeweiligen Tidenhub.<br />
Das hat zur Folge, dass überall, wo das Eis auf<br />
dem Untergrund aufliegt, also an der submarin-subglazialen<br />
Uferlinie des Festlandes wie ebenso der vom<br />
Schelfeis umschlossenen Inseln im Zeittakt und in der<br />
Höhenspanne des Tidenhubs ein rigoroser Frostwechsel<br />
herrscht: Alle sechs Stunden von der Meerwassertemperatur<br />
(bei Flut) zur Temperatur des Eises von ca.<br />
–20°C (bei Ebbe) – so gegenwärtig in der Antarktis.<br />
<strong>Mitteilungen</strong> <strong>03</strong>/<strong>04</strong> <strong>2005</strong><br />
17