Aus dem Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin
Aus dem Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin
Aus dem Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.4 Ätiologie der S. suis-Zoonose<br />
Schrifttum<br />
Die Verarbeitung von rohem Schweinefleisch ist ein herausragender Risikofaktor <strong>für</strong> das<br />
Auftreten einer S. suis-Infektion beim Menschen. Dieser Sachverhalt wurde bereits 1979 von<br />
PEEL hervorgehoben. <strong>Aus</strong> den Zusammenstellungen von LÜTTICKEN et al. (1986),<br />
ARENDS und ZANEN (1988) sowie KAY et al. (1995) geht hervor, dass der überwiegende<br />
Anteil von S. suis-Erkrankungen bei Menschen aufgetreten ist, die beruflich in der<br />
Schweinefleischverarbeitung beschäftigt waren (vorwiegend Metzger). Auch in aktuellen<br />
Fällen bestehen im Vorbericht meistens Hinweise auf die Verarbeitung von Schweinefleisch<br />
(TARRADAS et al., 2001; KOPIC et al., 2003; MAZOKOPAKIS et al., 2005). In vier<br />
Fallberichten wird die Infektion in Zusammenhang mit <strong>dem</strong> Aufbrechen und Zerwirken von<br />
Wildschweinen gestellt (BONMARCHAND et al., 1985; GREBE et al., 1997; HALABY et<br />
al. 2000; ROSENKRANZ et al., 2003).<br />
Während beim Schwein der obere Respirationstrakt eine wichtige Eintrittspforte <strong>für</strong> S. suis<br />
darstellt, gelangt der Erreger beim Menschen wohl vor allem durch Schnittverletzungen der<br />
Haut in tieferes Gewebe bzw. in den Kreislauf. Bei 13 von 44 humanen S. suis-Erkrankungen<br />
wurde im Vorbericht eine offene Verletzung der Haut (meistens ein Messerschnitt) angegeben<br />
(LÜTTICKEN et al., 1986). Auch KAY et al. (1995) berichten in vier von 21 Fällen in der<br />
Anamnese von deutlichen Hautverletzungen. ROSENKRANZ et al. (2003) beschreiben eine<br />
S. suis-Meningitis bei einem Jäger, die als Komplikation einer purulenten Gingivitis auftrat.<br />
Die Inokkulation des Zahnfleisches mit S. suis erfolgte wahrscheinlich durch einen<br />
kontaminierten Zahnstocher.<br />
Die Charakterisierung des Erregers beschränkt sich in den publizierten Fallberichten häufig<br />
auf die Identifikation. In älteren Arbeiten wird der Erreger oft als Streptococcus der<br />
Lancefield Gruppe R (oder im Zusammenhang mit einer Kreuzreaktion als Gruppe D)<br />
beschrieben (CHATTOPADHYAY, 1979; QUEISSER et al., 1982; HIGGINS u.<br />
GOTTSCHALK, 1990). Das Gruppe R-Antigen ist ein Polysaccharid, das als Bestandteil der<br />
Kapsel von S. suis auftreten kann (ELLIOTT u. TAI, 1978; HIGGINS u. GOTTSCHALK,<br />
1990). Nach GOTTSCHALK und SEGURA (2004) ist dieser Bestandteil nur bei Serotyp 1, 2<br />
und 15 anzutreffen. In aktuelleren Untersuchungen (TAMBYAH et al., 1997;<br />
ROSENKRANZ et al., 2003; SUANKRATAY et al., 2004) kommen vor allem kommerzielle<br />
miniaturisierte Testsysteme zum Einsatz, die eine biochemische Differenzierung nutzen (z. B.<br />
ID 32 Strep von bioMérieux, Frankreich oder API 20 Strep). Einige Arbeiten beinhalten eine<br />
17


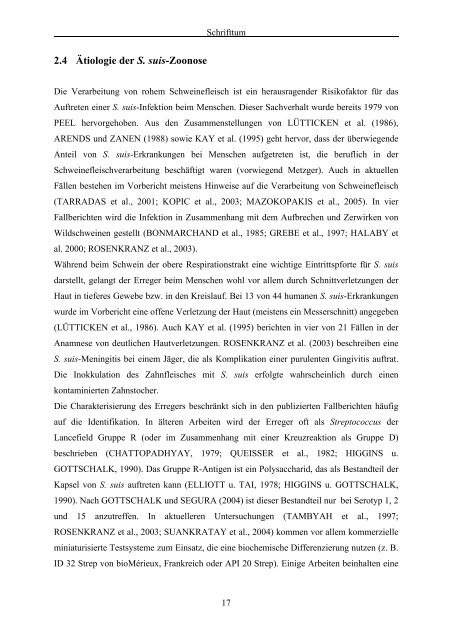



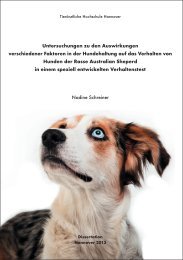



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






