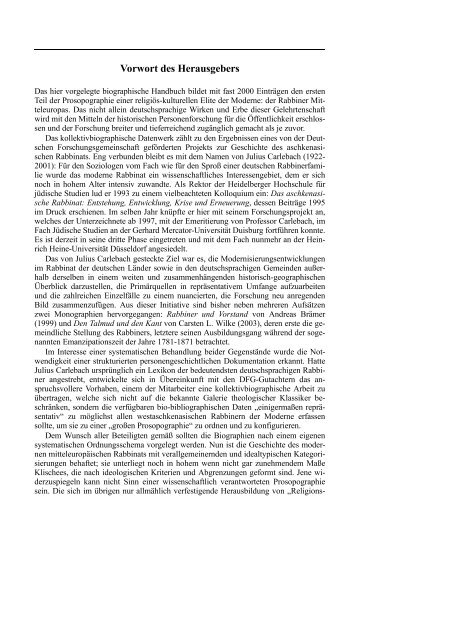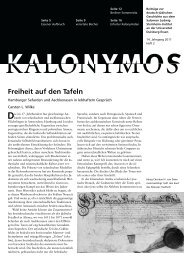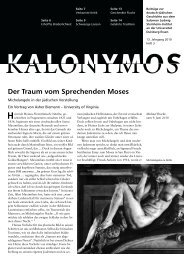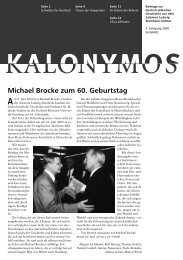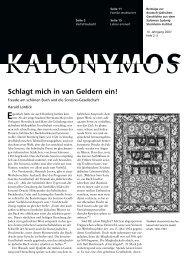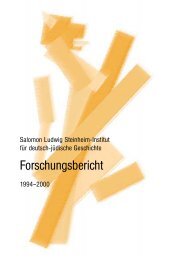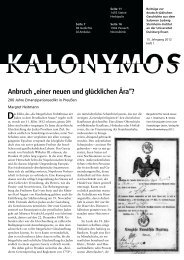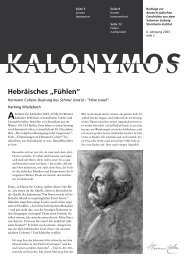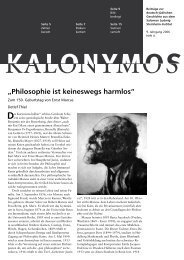Biographisches Handbuch der Rabbiner - Salomon Ludwig ...
Biographisches Handbuch der Rabbiner - Salomon Ludwig ...
Biographisches Handbuch der Rabbiner - Salomon Ludwig ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorwort des Herausgebers<br />
Vorwort des Herausgebers XI<br />
Das hier vorgelegte biographische <strong>Handbuch</strong> bildet mit fast 2000 Einträgen den ersten<br />
Teil <strong>der</strong> Prosopographie einer religiös-kulturellen Elite <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne: <strong>der</strong> <strong>Rabbiner</strong> Mitteleuropas.<br />
Das nicht allein deutschsprachige Wirken und Erbe dieser Gelehrtenschaft<br />
wird mit den Mitteln <strong>der</strong> historischen Personenforschung für die Öffentlichkeit erschlossen<br />
und <strong>der</strong> Forschung breiter und tieferreichend zugänglich gemacht als je zuvor.<br />
Das kollektivbiographische Datenwerk zählt zu den Ergebnissen eines von <strong>der</strong> Deutschen<br />
Forschungsgemeinschaft geför<strong>der</strong>ten Projekts zur Geschichte des aschkenasischen<br />
Rabbinats. Eng verbunden bleibt es mit dem Namen von Julius Carlebach (1922-<br />
2001): Für den Soziologen vom Fach wie für den Sproß einer deutschen <strong>Rabbiner</strong>familie<br />
wurde das mo<strong>der</strong>ne Rabbinat ein wissenschaftliches Interessengebiet, dem er sich<br />
noch in hohem Alter intensiv zuwandte. Als Rektor <strong>der</strong> Heidelberger Hochschule für<br />
jüdische Studien lud er 1993 zu einem vielbeachteten Kolloquium ein: Das aschkenasische<br />
Rabbinat: Entstehung, Entwicklung, Krise und Erneuerung, dessen Beiträge 1995<br />
im Druck erschienen. Im selben Jahr knüpfte er hier mit seinem Forschungsprojekt an,<br />
welches <strong>der</strong> Unterzeichnete ab 1997, mit <strong>der</strong> Emeritierung von Professor Carlebach, im<br />
Fach Jüdische Studien an <strong>der</strong> Gerhard Mercator-Universität Duisburg fortführen konnte.<br />
Es ist <strong>der</strong>zeit in seine dritte Phase eingetreten und mit dem Fach nunmehr an <strong>der</strong> Heinrich<br />
Heine-Universität Düsseldorf angesiedelt.<br />
Das von Julius Carlebach gesteckte Ziel war es, die Mo<strong>der</strong>nisierungsentwicklungen<br />
im Rabbinat <strong>der</strong> deutschen Län<strong>der</strong> sowie in den deutschsprachigen Gemeinden außerhalb<br />
<strong>der</strong>selben in einem weiten und zusammenhängenden historisch-geographischen<br />
Überblick darzustellen, die Primärquellen in repräsentativem Umfange aufzuarbeiten<br />
und die zahlreichen Einzelfälle zu einem nuancierten, die Forschung neu anregenden<br />
Bild zusammenzufügen. Aus dieser Initiative sind bisher neben mehreren Aufsätzen<br />
zwei Monographien hervorgegangen: <strong>Rabbiner</strong> und Vorstand von Andreas Brämer<br />
(1999) und Den Talmud und den Kant von Carsten L. Wilke (2003), <strong>der</strong>en erste die gemeindliche<br />
Stellung des <strong>Rabbiner</strong>s, letztere seinen Ausbildungsgang während <strong>der</strong> sogenannten<br />
Emanzipationszeit <strong>der</strong> Jahre 1781-1871 betrachtet.<br />
Im Interesse einer systematischen Behandlung bei<strong>der</strong> Gegenstände wurde die Notwendigkeit<br />
einer strukturierten personengeschichtlichen Dokumentation erkannt. Hatte<br />
Julius Carlebach ursprünglich ein Lexikon <strong>der</strong> bedeutendsten deutschsprachigen <strong>Rabbiner</strong><br />
angestrebt, entwickelte sich in Übereinkunft mit den DFG-Gutachtern das anspruchsvollere<br />
Vorhaben, einem <strong>der</strong> Mitarbeiter eine kollektivbiographische Arbeit zu<br />
übertragen, welche sich nicht auf die bekannte Galerie theologischer Klassiker beschränken,<br />
son<strong>der</strong>n die verfügbaren bio-bibliographischen Daten „einigermaßen repräsentativ“<br />
zu möglichst allen westaschkenasischen <strong>Rabbiner</strong>n <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne erfassen<br />
sollte, um sie zu einer „großen Prosopographie“ zu ordnen und zu konfigurieren.<br />
Dem Wunsch aller Beteiligten gemäß sollten die Biographien nach einem eigenen<br />
systematischen Ordnungsschema vorgelegt werden. Nun ist die Geschichte des mo<strong>der</strong>nen<br />
mitteleuropäischen Rabbinats mit verallgemeinernden und idealtypischen Kategorisierungen<br />
behaftet; sie unterliegt noch in hohem wenn nicht gar zunehmendem Maße<br />
Klischees, die nach ideologischen Kriterien und Abgrenzungen geformt sind. Jene wi<strong>der</strong>zuspiegeln<br />
kann nicht Sinn einer wissenschaftlich verantworteten Prosopographie<br />
sein. Die sich im übrigen nur allmählich verfestigende Herausbildung von „Religions-