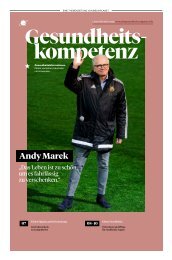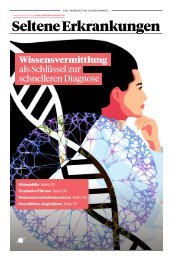Krebsratgeber
Egal, ob man als Ärztin oder Arzt beim Diagnosegespräch die richtigen Worte finden muss, oder als Patient:in beim Gespräch mit Freunden, Familie, Kindern, Arbeitskolleg:innen, oder auch als nicht Betroffene:r (darf ich einen Menschen mit Glatze fragen, ob er Krebs hat?) – Über Krebs zu sprechen ist schwierig. Diese Kampagne hilft dabei, das Gespräch zu beginnen und zu vertiefen.
Egal, ob man als Ärztin oder Arzt beim Diagnosegespräch die richtigen Worte finden muss, oder als Patient:in beim Gespräch mit Freunden, Familie, Kindern, Arbeitskolleg:innen, oder auch als nicht Betroffene:r (darf ich einen Menschen mit Glatze fragen, ob er Krebs hat?) – Über Krebs zu sprechen ist schwierig. Diese Kampagne hilft dabei, das Gespräch zu beginnen und zu vertiefen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
EINE THEMENZEITUNG VON MEDIAPLANET<br />
In dieser Ausgabe: Persönliche Geschichten<br />
von Ärzt:innen und Betroffenen zu verschiedenen Krebsarten<br />
Lesen Sie mehr auf www.krebsratgeber.at<br />
<strong>Krebsratgeber</strong><br />
FOTO: MANFRED WEIS<br />
TABU BRECHEN:<br />
ÜBER KREBS<br />
SPRECHEN<br />
Rational<br />
Krebs ist kompliziert.<br />
Wie spricht man<br />
richtig darüber?<br />
Emotional<br />
Die eigenen Gefühle<br />
in Worte zu fassen<br />
fällt oft schwer.<br />
Warum ist das so?
2 Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at<br />
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
IN DIESER AUSGABE<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
04<br />
Univ.-Prof. Dr. Christian Marth<br />
Der Leiter der Universitätsklinik<br />
für Gynäkologie und Geburtshilfe<br />
an der MedUni Innsbruck über das<br />
Endometrium-Karzinom und warum<br />
Zuhören ein Teil der Therapie ist<br />
FOTO:CDC-JL3EEMWRNK4-UNSPLASH<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
05<br />
Univ.-Prof. Dr.<br />
Shahrokh F. Shariat<br />
Der Gründer der Initiative STOP<br />
Blasenkrebs über die Diagnose<br />
Blasenkrebs und die Krebslandschaft<br />
Österreich<br />
Patient Advocacy oder:<br />
Was dem Gesundheitssystem<br />
noch fehlt<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
Das österreichische Gesundheitssystem verfügt über<br />
einen sehr guten, niederschwelligen Zugang zur<br />
Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig gibt es an vielen<br />
Stellen massiven Anpassungs- und Aufholbedarf –<br />
gerade im Feld der Patient:innenvertretung.<br />
10<br />
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe<br />
Der Vorstand der ÖGHO über seine<br />
Erfahrungen mit Kommunikation<br />
und Krebs und warum sie so<br />
herausfordernd sein kann<br />
IMPRESSUM<br />
Industry Manager Health: Paul Pirkelbauer<br />
Lektorat: Sophie Müller, MA<br />
Grafik & Layout: Daniela Fruhwirth<br />
Managing Director: Bob Roemké<br />
Medieninhaber: Mediaplanet GmbH,<br />
Bösendorferstraße 4/23,<br />
1010 Wien, ATU 64759844 · FN 322799f FG Wien<br />
Impressum: https://mediaplanet.com/at/<br />
impressum/<br />
Distribution: Der Standard Verlagsgesellschaft<br />
m.b.H.<br />
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei<br />
Ges.m.b.H. & Co.KG<br />
Kontakt bei Mediaplanet:<br />
Tel: 01 236 34 38 0<br />
E-Mail: hello-austria@mediaplanet.com<br />
ET: 24.06.2022<br />
Bleiben Sie in Kontakt:<br />
@Mediaplanet Austria<br />
@austriamediaplanet<br />
Schaut man sich die Statistik an, ist<br />
Österreich auf medizinischer Ebene<br />
weltweit in der ersten Liga vertreten.<br />
So glauben wir. Das bedeutet nicht,<br />
dass wir hierzulande in einer medizinischen<br />
Idylle leben. Die Ergebnisse im<br />
Bereich der onkologischen Versorgung<br />
befinden sich im europäischen Mittelfeld.<br />
Ein fragmentiertes Gesundheitssystem<br />
und fehlende Daten über den Ausgang der<br />
Behandlungen lassen große Versorgungslücken<br />
offen. Und: Es fehlt die Patient:innensicht.<br />
Mehr als ein paar qualifizierte Stimmen<br />
rufen derzeit simultan nach einem Kulturwandel<br />
und Paradigmenwechsel. Warum?<br />
Weil das Gesundheitssystem immer noch<br />
nicht weiß, was Patient Advocacy ist.<br />
Ganz allgemein bezeichnet Patient<br />
Advocacy (Patient:innenvertretung<br />
durch qualifizierte Patient:innenstimmen)<br />
Bestrebungen, die Interessen von<br />
Patient:innen zu stärken und ihre Realitäten<br />
besser sichtbar zu machen. Patient<br />
Advocates können auf lokaler oder nationaler<br />
Ebene tätig sein. Sie unterstützen<br />
erkrankte Menschen, schärfen das öffentliche<br />
Bewusstsein für die Krankheit, treiben<br />
die Forschung voran, verbessern die<br />
Qualität der Versorgung oder beschäftigen<br />
sich mit legislativen und regulatorischen<br />
Fragen. Dabei werden der Mehrwert der<br />
patient:innenzentrierten Behandlung,<br />
die Vorteile der frühzeitigen Einbindung<br />
in die Forschung und die Pluspunkte von<br />
qualifizierten Erfahrungsberichten erklärt,<br />
gefördert und gefordert. Es geht um Transparenz<br />
und Patient:innenorientierung;<br />
darum, Aspekte der Lebensqualität in die<br />
Versorgung einzubeziehen. Typischerweise<br />
handelt es sich bei Patient Advocates um<br />
(ehemalige) Patient:innen oder deren Angehörige.<br />
Es kann jedoch auch vorkommen,<br />
dass medizinisches Fachpersonal in diese<br />
Rolle schlüpft.<br />
Mut ist Veränderung – nur früher.<br />
In der österreichischen Praxis haben<br />
Patient Advocates in Forschung und Entwicklung<br />
sowie gesundheitspolitischen<br />
Gremien (noch) keinen echten Platz, denn<br />
hierzulande wird aufgrund aktueller<br />
Gesetzestexte nicht zwischen Laienpatient:innen<br />
und professionellen Patient:innenvertretungen<br />
unterschieden. Auch<br />
fehlen Erfahrung, Wissen und Verständnis<br />
der einzelnen Stakeholder:innen, wann<br />
und wie professionelle Patient:innenstimmen<br />
in verschiedene Themen eingebunden<br />
werden können. Es wird also primär über<br />
und nicht mit Patient:innen gesprochen<br />
und entschieden.<br />
Der Grund: Es gibt keine offizielle<br />
Berufsbezeichnung. Trotz Qualifikation<br />
wird Patient Advocates immer noch der<br />
Lai:innenstatus zugeschrieben. Die Lösung<br />
liegt in der Innovation und im mutigen<br />
Handeln der relevanten Stakeholder:innen.<br />
Kulturwandel und Paradigmenwechsel<br />
sollen durch die Etablierung des Berufsbilds<br />
„Patient Advocate“ möglich sein.<br />
Mehr dazu wissen die Patient Advocates<br />
Martina Hagspiel (InfluCancer) und Anita<br />
Kienesberger (Childhood Cancer Europe,<br />
kurz CCI Europe). Ziel ist es, dass qualifizierte<br />
Patient:innenstimmen besagten<br />
Lai:innenstatus verlieren.<br />
Wenn du weit gehen willst, dann<br />
gehe mit anderen gemeinsam<br />
Martina Hagspiel und Anita Kienesberger<br />
vertreten Patient:innen mit onkologischen
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at 3<br />
Erkrankungen, also Krebs – aus unterschiedlichen<br />
Gründen. Martina hatte<br />
Brustkrebs, Anita blickt auf 20 Jahre<br />
Geschäftsführung der Österreichischen<br />
Kinderkrebshilfe zurück. Heute sind sie als<br />
Patient Advocates tätig, arbeiten Seite an<br />
Seite in der in 2021 gegründeten Allianz der<br />
onkologischen Patient:innenorganisationen.<br />
Ihr Fokus liegt auf einer verbesserten<br />
Versorgung von Patient:innen und deren<br />
Angehörigen in Österreich. Unter anderem<br />
soll mit dem Universitätslehrgang „Patient<br />
Advocacy – Management in Patient:innenorganisationen“<br />
eine richtungsweisende<br />
Weiterbildung entstehen. So können nicht<br />
nur die Kompetenzen der österreichischen<br />
Patient:innenvertretung drastisch verbessert<br />
werden, sondern durch die neue<br />
Ausbildung werden auch objektivierbare<br />
Rahmenbedingungen für das neue Berufsbild<br />
Patient Advocate geschaffen.<br />
So wie Martina und Anita ihren Beruf<br />
als Patient Advocate ausüben, basiert die<br />
Arbeit vor allem auf der Kommunikation<br />
zwischen unterschiedlichsten Stakeholdern<br />
und Stakeholderinnen. Beide sind mit ihren<br />
Organisationen länderübergreifend tätig;<br />
Martina mit der Patient:innenorganisation<br />
InfluCancer, die sich für den öffentlichen<br />
Umgang mit Krebs einsetzt. Die Ziele<br />
sind klar: Es geht um Selbstwirksamkeit,<br />
Mündigkeit, das Aufbrechen von Tabus<br />
und angstfreien Umgang mit Krebs. „Wir<br />
brauchen ein grundsätzliches Verständnis<br />
dafür, dass optimale Versorgung nur dann<br />
gelingt, wenn der Kulturwandel Patient:innen<br />
nicht nur mitgestalten lässt, sondern<br />
ihnen auch eine Stimme gibt.“<br />
„Patient:innen brauchen einen Platz am<br />
Verhandlungstisch“, weiß Anita Kienesberger.<br />
Als Vorsitzende von CCI Europe verfolgt<br />
sie die Vision, ehemals an Krebs erkrankten<br />
Kindern und Jugendlichen (Survivors) und<br />
deren Eltern, den Zugang zu bestmöglichen<br />
Behandlungsmethoden zu erleichtern, die<br />
Erforschung von neuen Medikamenten<br />
voranzutreiben und eine flächendeckende<br />
Nachsorge für Survivors zu implementieren.<br />
„Mit uns statt über uns“<br />
lautet die Forderung<br />
Patient Advocacy steht in Österreich erst<br />
am Anfang und hat noch einen langen Weg<br />
FOTO: SHUTTERSTOCK<br />
zur Systemrelevanz vor sich. Dank der<br />
gesundheitspolitischen Arbeit einiger sehr<br />
aktiver Patient Advocates und aufgrund von<br />
Zusammenschlüssen wie die Allianz der<br />
onkologischen Patient:innenorganisationen<br />
wird deutlich, dass es an der Zeit ist, der<br />
stark unterrepräsentierten Gruppe der<br />
Patient:innen einen Fixplatz am Verhandlungstisch<br />
zu bieten und sie in die Diskussionsrunden<br />
der Gesundheitspolitik und<br />
darüber hinaus einzuladen.<br />
Anita Kienesberger<br />
Patient Advocate<br />
Martina Hagspiel<br />
Patient Advocate<br />
FOTO:CCI EUROPE<br />
FOTO: CARO STRASNIK<br />
Weiterführende Links: www.influCancer.com,<br />
www.ccieurope.eu, www.dieallianz.org<br />
Entgeltliche Einschaltung<br />
Kommunikation ist das<br />
Um und Auf<br />
Kommunikationsexpertin Birgit Hladschik-Kermer erklärt, warum<br />
Kommunikation zwischen Medizinerinnen und Medizinern und<br />
Patient:innen so wichtig ist und was es für ihr Gelingen braucht.<br />
Univ. Ass. Dr. Mag.,<br />
MME Birgit Hladschik-Kermer,<br />
Psychotherapeutin,<br />
Expertin für Supervision<br />
& Gesundheitskommunikation<br />
AT-6785, 05/2022<br />
FOTO: RAFAELA PRÖLL<br />
Wie wichtig ist Kommunikation?<br />
Sie ist das Um und Auf. Ohne sie kommen<br />
Ärztinnen und Ärzte nicht an die wichtigen<br />
Informationen. Ohne Anamnese gibt es<br />
keine Diagnose. Ärztinnen und Ärzte und<br />
auch Menschen in anderen Gesundheitsberufen<br />
verfügen über ein enormes Fachwissen.<br />
Aber das nützt natürlich nichts,<br />
wenn sie Informationen nicht so vermitteln<br />
können, dass Patient:innen alles nachvollziehen,<br />
sich merken und umsetzen können.<br />
Aus Studien weiß man, dass nach ca. der<br />
Hälfte aller Gespräche Ärztinnen und<br />
Ärzte und deren Patient:innen nicht in der<br />
Diagnose übereinstimmen. Hier ist natürlich<br />
vorprogrammiert, dass die Umsetzung<br />
einer Behandlung nicht optimal funktionieren<br />
kann. Beide Seiten haben hier<br />
eigene Vorstellungen von Diagnose und<br />
Therapie. Darum ist es so wichtig, zu einem<br />
gemeinsamen Verständnis der Dinge zu<br />
kommen, um am selben Strang zu ziehen.<br />
Wie macht man das?<br />
Zum Beispiel indem Informationen und<br />
Ablauf eines Gesprächs entsprechend aufbereitet<br />
werden: „Ich habe die Ergebnisse<br />
der letzten Untersuchung für Sie. Als erstes<br />
würde ich Ihnen diese gern mitteilen und<br />
danach über deren Bedeutung für Sie sprechen<br />
und darüber, wie wir weitermachen.<br />
Ist das in Ordnung für Sie?“ Es ist wichtig,<br />
die Zustimmung einzuholen, denn wenn<br />
der/die Patient:in „Ja“ sagt, habe ich die<br />
volle Aufmerksamkeit. Im Gespräch selbst<br />
sollte man auf eine verständliche Sprache<br />
mit kurzen Sätzen achten. Wichtig sind<br />
auch Pausen, um den Patient:innen die<br />
Chance zu geben, das Gehörte zu verarbeiten.<br />
Dies gilt insbesondere dann, wenn es<br />
Nicht zuletzt stehen heute<br />
vermehrt individualisierbare<br />
und personalisierbare<br />
Therapiemöglichkeiten zur<br />
Verfügung.<br />
Univ.-Prof. Dr. Edgar Petru<br />
sich um belastende Nachrichten handelt.<br />
Man kann Patient:innen auch dazu<br />
ermutigen, das Gehörte für sich nochmal<br />
zusammenzufassen um zu sehen, ob sie die<br />
Informationen auch verstanden haben. Für<br />
ein erfolgreiches Gespräch ist es aber auch<br />
wichtig aktiv zuzuhören, aufmerksam zu<br />
bleiben und die Patient:innen aussprechen<br />
zu lassen.<br />
Was können Patient:innen<br />
selbst beitragen?<br />
Es ist zwar prinzipiell die Kernaufgabe der<br />
Mediziner:innen, Informationen verständlich<br />
aufzubereiten; natürlich kann man<br />
sich aber auch als Patient:in auf ein<br />
Gespräch vorbereiten, indem vorab<br />
überlegt wird, welche und wie viele<br />
Informationen benötigt werden.<br />
Text Werner Sturmberger<br />
Univ.-Prof. Dr.<br />
Edgar Petru<br />
Stellvertretender<br />
Klinikvorstand<br />
Univ.-Klinik für<br />
Frauenheilkunde und<br />
Geburtshilfe<br />
Klinische Abteilung<br />
für Gynäkologie<br />
Medizinische<br />
Universität Graz<br />
Lesen Sie das gesamte<br />
Interview mit Prof.<br />
Petru unter:www.<br />
krebsratgeber.at/<br />
expertise/metastasierter-brustkrebsaus-arztlicher-perspektive-woraufkommt-es-an/<br />
FOTO:PRIVAT
4 Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at<br />
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
EXPERTISE<br />
Endometriumkarzinom:<br />
Zuhören ist Teil der Therapie<br />
Der Krebs der Gebärmutterschleimhaut gilt als eine der häufigsten<br />
bösartigen Erkrankungen. Dennoch fällt es vielen PatientInnen schwer<br />
darüber zu reden, erklärt der Gynäkologe Christian Marth.<br />
Text Werner Sturmberger<br />
FOTO: UNSPLASH<br />
Wie entsteht das Endometriumkarzinom?<br />
Östrogen und Gelbkörperhormon regen das<br />
Wachstum der Gebärmutterschleimhaut<br />
während des Zyklus an. Bei der Monatsblutung<br />
wird die oberste Schicht der Schleimhaut<br />
wieder abgestoßen. Nach dem Wechsel<br />
aber auch bei einer Hormontherapie oder<br />
bei Übergewicht kann es dazu kommen, dass<br />
Östrogene überwiegen, was das Wachstum<br />
und damit<br />
eine mögliche<br />
Entartung der Schleimhaut anregt. Ein<br />
solche Entartung kann in weiterer Folge über<br />
Vorstufen zum Entstehen eines Endometriumkarzinoms<br />
führen. Neben Übergewicht,<br />
Diabetes sowie der erblichen Vorbelastung<br />
ist es vor allem das fortgeschrittene Alter,<br />
das einen bekannten Risikofaktor, an diesem<br />
Tumor zu erkranken, darstellt. Jährlich sind<br />
zwischen 900 und 1.000 Frauen betroffen.<br />
Damit ist es der häufigste gynäkologische<br />
Beckentumor. Für 180 Frauen pro Jahr<br />
verläuft dieser immer noch tödlich. Gesamt<br />
betrachtet bedeutet das aber, dass über 80<br />
Prozent aller Patient:innen geheilt werden<br />
können.<br />
Wie entdeckt man den Tumor?<br />
Thomas Mann hat die Erkrankung in seinem<br />
Roman „Die Betrogene“ sehr gut beschrieben.<br />
Darin geht es um eine Witwe, die sich in<br />
einen jüngeren Mann verliebt. Sie leidet<br />
darunter, dass sie ihm keine Kinder mehr<br />
schenken kann. Als sie eines Tages<br />
eine Blutung entdeckt, hält sie das für<br />
ein Wiedereinsetzen ihrer Periode.<br />
Tatsächlich handelt es sich dabei<br />
aber um ein Endometriumkarzinom,<br />
an dem sie letztlich verstirbt.<br />
Treten nach dem Wechsel<br />
Blutungen auf, sollte man das<br />
darum immer abklären lassen.<br />
Oftmals handelt es sich um<br />
gutartige Veränderungen der<br />
Gebärmutterschleimhaut –<br />
aber eben nicht immer. Der<br />
Tumor wird jedoch meist früh<br />
entdeckt, was sich positiv auf<br />
die Heilungsrate auswirkt.<br />
Wenngleich seltener, kann<br />
die Erkrankung ebenso bereits<br />
vor dem Wechsel auftreten und<br />
sich durch eine unregelmäßige<br />
Blutung bemerkbar machen. Die<br />
Unregelmäßigkeit sorgt dafür, dass<br />
viele Frauen dies ohnehin abklären<br />
lassen, weshalb die Erkrankung auch<br />
in jungen Jahren oft rasch entdeckt wird.<br />
Gerade wenn es in der Familie viele Fälle<br />
von Darmkrebs gibt, sollte man die Möglichkeit<br />
eines Endometriumkarzinoms im<br />
Hinterkopf behalten.<br />
Wie erleben Patient:innen die Diagnose?<br />
Es ist immer sehr unterschiedlich, wie<br />
Patient:innen reagieren – abhängig vom<br />
Alter, vom Schweregerad der Erkrankung und<br />
nicht zuletzt von der individuellen Resilienz,<br />
die Patient:innen mitbringen. Ich hatte<br />
heute eine Patientin, der die Gebärmutter<br />
entnommen wird. Die Dame ist etwa 70 Jahre<br />
alt und freut sich, dass sie geheilt nach Hause<br />
gehen kann. Das ist aber natürlich nicht<br />
immer so. Vor allem bei Frauen im gebärfähigen<br />
Alter ist die Diagnose natürlich von<br />
ganz anderer Bedeutung. Hier versucht man<br />
deshalb oft, die Gebärmutter therapeutisch<br />
zu erhalten, um den Kinderwunsch nach<br />
wie vor ermöglichen zu können. Klar ist: Die<br />
Wünsche der Patientin/des Patienten stehen<br />
immer Zentrum.<br />
Wie schwierig ist es,<br />
über die Erkrankung zu sprechen?<br />
Ich habe noch die Zeit miterlebt, da hat man<br />
gar nicht von Krebs, sondern nur von einer<br />
„Veränderung der Gebärmutter“ gesprochen –<br />
und auch nur mit den Angehörigen und nicht<br />
mit der Patientin/dem Patienten selbst. Das<br />
hat sich natürlich mittlerweile vollkommen<br />
geändert. Dennoch ist es nach wie vor nicht<br />
so leicht, als Betroffene:r darüber zu sprechen.<br />
Wie bei allen gynäkologisch relevanten<br />
Organen handelt es sich auch hier um ein<br />
sehr intimes Thema – vor allem, wenn die<br />
Erkrankung sehr früh auftritt. Zuhören und<br />
die Person erzählen lassen sind darum ganz<br />
wichtig. Es geht auch darum, persönliche und<br />
nicht nur unmittelbar medizinische Fragen<br />
zu stellen, um zu erfahren, wie sozial eingebettet<br />
jemand ist und wieviel Unterstützung<br />
das soziale Umfeld bieten kann.<br />
Welche Rolle kommt Angehörigen<br />
und Freund:innen zu?<br />
Ich habe schon erlebt, dass eine Patientin ihre<br />
Angehörigen bis zum Schluss im Dunkeln<br />
über die Erkrankung gelassen hat. Das ist<br />
natürlich ihr gutes Recht, weil sie so ihr<br />
Umfeld schützen wollte. Natürlich empfehlen<br />
wir aber, Ängste und Sorge mit Menschen, die<br />
einem nahe stehen, zu teilen. Wir Ärzte und<br />
Ärztinnen können nicht allein dabei helfen,<br />
die Erkrankung zu bewältigen. Der Kontakt<br />
ist ja immer nur punktuell im Rahmen von<br />
Terminen möglich. Darum braucht es<br />
Menschen, die auch sonst ein offenes Ohr<br />
haben. Gibt es diese Unterstützung aus dem<br />
privaten Umfeld nicht oder reicht sie schlichtweg<br />
nicht aus, kann es auch ratsam sein, sich<br />
an die Krebshilfe oder entsprechende<br />
Selbsthilfegruppen zu wenden.<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
Univ.-Prof. Dr.<br />
Christian Marth,<br />
Leiter der Universitätsklinik<br />
für Gynäkologie<br />
und Geburtshilfe<br />
an der MedUni<br />
Innsbruck<br />
Diese Kampagne wurde unterstützt von Eisai GmbH.<br />
Bei dieser Logoplatzierung handelt es sich<br />
um eine entgeltliche Einschaltung.
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at 5<br />
EXPERTISE<br />
Univ.-Prof. Dr.<br />
Shahrokh F. Shariat<br />
Leiter der Universitätsklinik<br />
für Urologie<br />
am AKH Wien<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
Über Blasenkrebs<br />
sprechen –<br />
aber richtig<br />
Ein Interview mit dem international<br />
anerkannten Blasenkrebs-Experten<br />
Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat über<br />
verständliche Kommunikation, Quantensprünge<br />
in der Medizin und das Tabuthema Tod.<br />
Text Magdalena Reiter-Reitbauer<br />
Sie haben 2019 die Initiative STOP<br />
Blasenkrebs gegründet. Was war die<br />
Intention zur Gründung und warum<br />
braucht es diese Initiative?<br />
Blasenkrebs ist eine sehr komplexe Erkrankung,<br />
die nicht nur von klinischen Parametern<br />
beeinflusst wird, sondern auch davon,<br />
wie Patient:innen ihre Erkrankung wahrnehmen<br />
und welche Auswirkungen Blasenkrebs<br />
auf ihr Leben, deren Familien und<br />
deren soziale Umgebung hat. Da es damals<br />
keine Selbsthilfegruppe für Blasenkrebs gab,<br />
wollten wir deshalb mit STOP Blasenkrebs<br />
einen Ratgeber schaffen, der Patient:innen<br />
empowert ihre Krankheit zu verstehen, um<br />
so zu mündigen und informierten Partnerinnen<br />
und Partnern zu werden. Mit unserer<br />
Initiative möchten wir das Bewusstsein für<br />
die Erkrankung stärken, gerade auch hinsichtlich<br />
früher Anzeichen. Denn wir wissen:<br />
Den besten Effekt auf eine Erkrankung<br />
– vor allem auf Karzinome – haben nicht<br />
ultrateure Medikamente in Spätphasen,<br />
sondern Prävention und Früherkennung.<br />
Eine weitere wichtige Komponente für die<br />
Gründung von STOP Blasenkrebs war die<br />
Tatsache, dass es noch zu wenig Investition<br />
in die Forschung von Blasenkrebs gibt.<br />
Leider hat Blasenkrebs eine hohe Rezidivrate<br />
und ist in der Behandlung der teuerste<br />
Tumor pro Patient:in. Das hat nicht nur auf<br />
die persönliche Situation der Patient:innen<br />
Auswirkungen, sondern auch einen sozioökonomischen<br />
Effekt. Wir brauchen daher<br />
bessere Forschung und mehr Awareness für<br />
Blasenkrebs.<br />
Was braucht es, damit Sie als Experte<br />
mit Betroffenen gut sprechen können?<br />
Und welche Informationen brauchen<br />
Betroffene, um gut mit ihrer Situation<br />
umgehen zu können?<br />
Das ist eine schwierige Frage. Es braucht<br />
eine spezifische Kommunikation abhängig<br />
von Alter, Geschlecht und Lebenssituation<br />
der Patient:innen. Dafür gibt es nicht das<br />
eine Rezept. Mit jüngeren Patient:innen<br />
müssen wir anders sprechen als mit 70- bis<br />
80-jährigen, bei denen vielleicht auch<br />
andere Begleiterkrankungen vorliegen.<br />
Zusätzlich müssen wir darauf eingehen, wie<br />
sehr Patient:innen involviert sein wollen.<br />
Es gibt Patient:innen, die genau verstehen<br />
möchten, was ihre Erkrankung ist und dafür<br />
vielleicht sogar wissenschaftliche Artikel<br />
lesen wollen. Und es gibt andere Patient:innen,<br />
die sich nicht so sehr mit ihrer Erkrankung<br />
befassen möchten. Wir müssen aber<br />
auch Informationen zur Frühdiagnose in<br />
einer verständlichen Sprache zur Verfügung<br />
stellen – auf den diversen Plattformen und<br />
auch in den Medien. Wichtig für uns ist, dass<br />
wir sehr früh mit der Bewusstseinsbildung<br />
für die Prävention von Blasenkrebs beginnen<br />
und gut kommunizieren können, dass<br />
bestimmte Karzinogene, wie insbesondere<br />
Rauchen, vermieden werden sollten. Wir<br />
brauchen eine gezielte Strategie, um gerade<br />
auch jüngere Generationen anzusprechen –<br />
und dafür braucht es sicherlich Social Media.<br />
Stichwort Diagnose: Was hat sich in Hinblick<br />
auf die Diagnosestellung – gerade<br />
auch im technologischen Bereich – in den<br />
letzten Jahren verändert?<br />
Wir stehen am Beginn eines Quantensprungs.<br />
Die Wahrnehmung von Blasenkrebs<br />
hat sich verändert und damit sind auch die<br />
Investitionen in die Erkennung der Krankheit<br />
andere. Wir haben heute einerseits viele<br />
neue Medikamente und andererseits neue<br />
Technologien zur Diagnosestellung zur Verfügung.<br />
Ich forsche außerdem seit 20 Jahren<br />
an Biomarkern, um Tumore frühzeitig zu<br />
diagnostizieren und prognostizieren. Über<br />
den Harn könnte in Zukunft mittels eines<br />
den Corona-Gurgeltests ähnlichen Systems<br />
ein Screening durchgeführt werden, das den<br />
gesamten Prozess der Früherkennung verändern<br />
würde. Das wäre für unser Gesundheitssystem<br />
ökonomisch sehr sinnvoll, weil es uns<br />
erlauben würde, die richtigen Patient:innen<br />
zur richtigen Zeit zum/zur richtigen Arzt/<br />
Ärztin zu schicken. Ein solches Screening<br />
würde die Überlebenschancen von Patient:innen<br />
deutlich erhöhen.<br />
Sie genießen als Arzt und Forscher nicht<br />
nur in Österreich sondern auch international<br />
ein hohes Renommee. Was könnten<br />
wir hier in Österreich noch lernen?<br />
Jedes Land, jede Gesellschaft, ja sogar jede<br />
sozioökonomische Subgruppe in einem Land<br />
hat eigene Herausforderungen. Ich glaube<br />
nicht, dass das Gesundheitssystem in Österreich<br />
schlechter ist als in anderen Ländern;<br />
aber ich glaube auch nicht, dass wir besser<br />
sind. Im Vergleich zu den USA haben wir hier<br />
in Österreich zwar kein Problem hinsichtlich<br />
des Zugangs zu Behandlungen, aber dafür im<br />
Outcome. Wir sind noch nicht so qualitätsund<br />
ergebnisorientiert, wie es sich unsere<br />
Patient:innen vielleicht wünschen würden.<br />
Darüber hinaus haben wir nach wie vor viel<br />
zu wenige Psychoonkolog:innen in unseren<br />
Krankenhäusern.<br />
Was würden Sie sich<br />
persönlich wünschen?<br />
Viele Patient:innen kommen zu mir und<br />
wissen nicht, wo und wie sie zu vertrauenswürdigen<br />
Informationen kommen können.<br />
Schließlich stehen ja so viele auch nicht<br />
validierte Informationen im Internet. Wir<br />
müssen also nicht nur in die Forschung im<br />
klinischen, medizinischen Bereich investieren,<br />
sondern auch in die adäquate Kommunikation.<br />
Patient:innen müssen mit<br />
hochqualitativen Informationen zuverlässig<br />
versorgt werden. Ich würde mir wünschen,<br />
dass in der Gesellschaft endlich das Tabu<br />
rund um Krankheiten und den Tod durchbrochen<br />
wird. In ihrer Ausbildung müssen<br />
Ärzte und Ärztinnen lernen, wie man richtig<br />
mit Patient:innen kommuniziert; wie man<br />
zum Beispiel schlechte Nachrichten überbringt<br />
und auch mit dem Thema Tod<br />
umzugehen hat. Die Kommunikation über<br />
dieses Thema ist in unserer Gesellschaft<br />
nach wie vor ein großes Tabu. Wir müssen<br />
Krankheit und Gesundheit ganz anders<br />
wahrnehmen und den Wandel hin zu<br />
proaktivem und präventivem Denken<br />
schaffen. Das müssen wir verändern, wenn<br />
wir erfolgreich gesund sein wollen.<br />
Blasenkrebs hat unsere<br />
volle Aufmerksamkeit<br />
Photocure GmbH, Marc-Chagall-Straße 2, 40477 Düsseldorf, Deutschland – www.photocure.com
6 Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at<br />
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
COVERSTORY<br />
FOTO: PRIVAT<br />
Alexander Greiner<br />
Krebssurvivor, geboren 1980, wuchs<br />
im niederösterreichischen Mostviertel<br />
auf. Bevor er zu schreiben begonnen<br />
hat, war er Unternehmensberater<br />
und gönnte sich eine berufliche<br />
„Auszeit“ als Barista. Er bezeichnet<br />
sich selbst als Schüler der Glückseligkeit,<br />
lacht viel, liebt Bewegung und<br />
die Natur und trägt bunte Socken.<br />
Alexander Greiner lebt in Wien und<br />
engagiert sich bei der Initiative „Loose<br />
Tie“ der Österreichischen Krebshilfe<br />
zur Enttabuisierung von männerspezifischen<br />
Krebserkrankungen.<br />
Kommunikation<br />
und Krebs<br />
Autor, Journalist und Krebs-Aktivist<br />
Alexander Greiner erzählt im<br />
Gespräch über die Bedeutung der<br />
Kommunikation hinsichtlich des<br />
Themas Krebs und das neue Projekt<br />
„Herrenzimmer“.<br />
Text Lukas Wieringer<br />
Warum ist richtige Kommunikation beim<br />
Thema Krebs so wichtig, Alexander?<br />
In der Zeit, in der ich mich bislang mit Krebskommunikation<br />
beschäftigt habe, ist mir insbesondere<br />
bei Männern eines aufgefallen: Sehr viele Betroffene<br />
praktizieren nach wie vor das althergebrachte<br />
Tabuisieren nach dem Motto „Über Krankheiten<br />
spricht man nicht, jede:r muss das mit sich selbst<br />
ausmachen, wenn ich mich nicht damit beschäftige,<br />
passiert auch nichts“. Ich denke, diese Herangehensweise<br />
fällt größtenteils auch unter falsch<br />
verstandenes Held:innentum. Spannend ist aber,<br />
dass viele Betroffene beginnen nachzudenken und<br />
zu reden, nachdem sie mich kennengelernt haben.<br />
Ich glaube, es ist ganz wichtig einfach darüber zu
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at 7<br />
reden, keine falsche Scheu an den Tag zu legen.<br />
Richtig und wichtig ist, Krebs aus der Tabuzone zu<br />
holen.<br />
Besteht die Scheu zu sagen, dass man selbst<br />
von Krebs betroffen ist, immer noch?<br />
Oh ja, ganz klar! Wir erzählen zwar freimütig, dass<br />
wir von der Kletterwand gestürzt sind und uns den<br />
Knöchel verletzt haben – aber über Krebs sprechen<br />
wir nicht. Und das passt für mich nicht zusammen.<br />
Krebs ist eine Erkrankung wie jede andere, die uns<br />
alle treffen kann und viele von uns treffen wird.<br />
Jede zweite Person wird in Zukunft mit Krebs zu<br />
tun haben. Entweder als direkt Betroffene:r oder<br />
als nahe:r Angehörige:r. Bis 2030 wird die Zahl der<br />
Krebspatient:innen laut Statistik Austria auf etwa<br />
40 Prozent der Gesamtbevölkerung ansteigen.<br />
Schon das zeigt, dass Krebs kein Nischenthema ist.<br />
Wie bist du Krebs-Aktivist geworden?<br />
Ich erkrankte 2015 an Hodenkrebs. Anfangs kam<br />
es mir nur komisch vor, dass beim Radfahren in<br />
der Hose irgendetwas nicht so ist wie sonst immer.<br />
Natürlich habe auch ich nicht regelmäßig meine<br />
Hoden abgetastet, wie das eigentlich jeder Mann<br />
über 20 Jahren einmal im Monat machen sollte.<br />
Mein Urologe hat dann schnell erkannt, dass ich<br />
Krebs habe. Und schon ging es Schlag auf Schlag.<br />
Keine 36 Stunden nachdem ich eine Anomalie<br />
ertastet hatte, wurde ich schon operiert. Und<br />
danach dachte ich, die Sache ist wieder erledigt.<br />
Ich hatte keine Metastasen, meine Blutwerte waren<br />
gut, somit war ich wieder gesund. Bloß ist der Krebs<br />
zwei Jahre später mit Knochenmetastasen in der<br />
Schulter zurückgekommen.<br />
Wie ging es dir damit?<br />
Diese Diagnose hat mir so richtig den Boden<br />
unter den Füßen weggezogen. Da habe ich schnell<br />
gemerkt, dass ich mit dieser alten Variante des<br />
Wegschiebens – „Ist ja eh alles wieder gut.“ – nicht<br />
weitermachen kann; dass das auf Dauer einfach<br />
nicht funktioniert. Und somit war meine Motivation<br />
geweckt. Ich wollte wissen, was es überhaupt<br />
bedeutet, Krebs zu haben. Ich habe begonnen, mich<br />
intensiv mit dem Thema Krebs und vor allem mit<br />
der Kommunikation darüber zu beschäftigen. 2019<br />
erschien mein Buch und seither rede ich in der<br />
Öffentlichkeit darüber.<br />
Und im Zuge dessen hast du erst gemerkt,<br />
welches Tabuthema Krebs gerade bei Männern<br />
noch ist?<br />
Genau. Offenbar wird es nach wie vor als Eingeständnis<br />
gesehen, dass Mann nicht immer stark<br />
und unverletzlich ist – Krankheit wird immer noch<br />
mit Schwäche gleichgesetzt. Und wenn es dann,<br />
wie in meinem Fall, auch noch unter die Gürtellinie<br />
geht, wird’s besonders schwierig. Vom Prostatakrebs,<br />
dem häufigsten Krebs bei Männern, geht es<br />
da ja über den Hodenkrebs hin zu Penis- und Analkrebs.<br />
Man kann sich denken, wie schwer Mann<br />
darüber spricht. Vor allem mit Frauen, aber auch<br />
am Stammtisch oder mit männlichen Kollegen.<br />
Daher ist es besonders wichtig, als gutes Beispiel<br />
voranzugehen.<br />
Wie bringt man Betroffene dazu,<br />
über ihre Krankheit zu sprechen?<br />
Wichtig ist es, ein Vorbild zu sein. Sie müssen<br />
sehen, dass niemandem ein Stein aus der Krone<br />
fällt, wenn man über eine Krebserkrankung spricht.<br />
Wenn andere Betroffene sehen, dass sich niemand<br />
über mich lustig macht, fassen sie vielleicht auch<br />
den Mut, über die eigene Erkrankung zu sprechen.<br />
Und da kommen wir zum neuen Projekt<br />
„Herrenzimmer“.<br />
Erzähl uns bitte mehr über das Projekt,<br />
Alexander!<br />
Das „Herrenzimmer“ ist ein relativ neues Projekt,<br />
bei dem sich einmal im Monat krebserkrankte<br />
Männer virtuell zu einem Gespräch treffen.<br />
Gestartet wurde es im November letzten Jahres von<br />
der Krebshilfe Österreich, Martina Löwe hat das<br />
Format entwickelt. Beim „Herrenzimmer“ geht es<br />
darum, sich dem Thema Krebs möglichst niederschwellig<br />
annähern zu können. Jeden Monat ist ein<br />
anderer Experte mit dabei, der im Gespräch mit den<br />
Teilnehmern für Fragen zur Verfügung steht.<br />
Abschließend glaube ich, ist es das Wichtigste zu<br />
kommunizieren, dass Mann nicht immer der starke<br />
Kämpfer sein muss, der keinen Schmerz kennt.<br />
www.krebshilfe.net/herrenzimmer<br />
BUCH TIPP<br />
Alexander Greiner<br />
Als ich dem Tod in die Eier trat<br />
Format 13,5 x 21,5 cm<br />
224 Seiten Hardcover, Schutzumschlag<br />
ISBn 978-3-218-01188-4 € (A, d) 22,–<br />
K & S Auch als e-Book erhältlich<br />
Niemandem fällt ein<br />
Stein aus der Krone,<br />
wenn man über eine<br />
Krebserkrankung spricht.<br />
Alexander Greiner<br />
Entgeltliche Einschaltung<br />
Mag. Christoph<br />
Slupetzky,<br />
Patient Advocacy<br />
Lead<br />
Janssen Austria<br />
Dr. Holger Bartz,<br />
Medical Director<br />
Janssen Austria<br />
AT_EM-99659<br />
FOTO: KLAUS RANGER<br />
FOTO: LENA GRIPSHOEFER<br />
Sie haben eine Krebsdiagnose erhalten und<br />
fragen sich: Wie viel Zeit bleibt mir? Muss<br />
ich operiert werden? Wie kann ich meine<br />
Lebensqualität erhalten? Gleich vorweg:<br />
Für viele Krebsarten gibt es effektive Behandlungsmöglichkeiten.<br />
Janssen Austria setzt alles<br />
daran, für jeden Patienten die passende Behandlung<br />
zu entwickeln und mit Hilfestellungen rund<br />
um das Leben mit Krebs zu versorgen. Sensible,<br />
offene Kommunikation innerhalb des Teams<br />
„Patient-Angehörige-Medizinisches Fachpersonal“<br />
ist dafür Voraussetzung.<br />
„Es ist 5 vor 12 und der Patient wartet“<br />
Bei Janssen forschen tausende Experten weltweit,<br />
um einige der schwersten Krankheiten zu<br />
heilen oder zu lindern. Dazu zählen Lungenkrebs,<br />
Prostatakrebs und Blutkrebsformen wie Multiples<br />
Myelom oder Chronisch Lymphatische Leukämie.<br />
„Das Motto unseres Gründers Paul Janssen ist<br />
unser Auftrag: ‚Es ist 5 vor 12 und der Patient wartet’.<br />
Wir investieren jährlich weltweit elf Milliarden<br />
Euro, um die bestmögliche Behandlung für<br />
Patienten und ihre individuellen Krankheitsverläufe<br />
zu entwickeln“, erklärt Ramez Mohsen-Fawzi,<br />
Managing Director von Janssen Austria. Dieser<br />
Ansatz der Präzisionsmedizin berücksichtigt<br />
Lebensstil und Umfeld jedes Einzelnen ebenso wie<br />
biologische und naturwissenschaftliche Aspekte.<br />
„Wir wollen die richtige Medizin zur richtigen<br />
Zeit für den richtigen Patienten anbieten, um die<br />
Zukunftsaussichten Betroffener nachhaltig zu verbessern“,<br />
so Holger Bartz, Medical Director.<br />
Reden wir offen über Krebs<br />
Dazu braucht es ein offenes Ohr für die Bedürfnisse,<br />
Wünsche und Sorgen der Patienten. „Wir hören<br />
Patienten ganz genau zu und helfen außerdem<br />
Ärzten und Pflegenden dabei, sensibel zu kommunizieren.<br />
Aus dem Dialog wissen wir, dass<br />
Betroffene vor allem möglichst lange und gut<br />
weiterleben wollen. Nutzen Sie daher gezielt alle<br />
Möglichkeiten, um besser mit der Erkrankung<br />
umzugehen“, betont Christoph Slupetzky, Patient<br />
Engagement and Advocacy Lead. Janssen<br />
unterstützt aktiv Patienten und ihre Angehörigen<br />
mit Ratgebern und arbeitet eng mit Experten und<br />
Patientenorganisation zusammen, um diese<br />
laufend zu erweitern.<br />
Patienten,<br />
Ärzte, Forscher:<br />
Reden wir über<br />
Krebs<br />
Mit Forschung zu effektiven<br />
Behandlungsmöglichkeiten<br />
und Ratgebern für Betroffene<br />
ist Janssen Austria ein starker<br />
Partner in der Onkologie.<br />
Tipps für bessere<br />
Kommunikation<br />
mit Krebs<br />
Lernen Sie Ihre Krankheit<br />
kennen und verstehen<br />
Informieren Sie sich über<br />
Ursachen, Symptome, Formen<br />
und Behandlungsoptionen<br />
Begegnen Sie Ihrer<br />
Diagnose im Team – mit<br />
Angehörigen, Ärzten,<br />
Pflegenden und Patientenorganisationen<br />
Nehmen Sie die Hilfe Ihrer<br />
Bezugspersonen an<br />
Setzen Sie auf professionelle<br />
Unterstützung von speziell ausgebildeten<br />
Psychoonkologen an<br />
FOTO: MONKEYBUSINESSIMAGES
8 Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at<br />
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
INSIGHT<br />
FOTO: SHUTTERSTOCK<br />
Keine Götter<br />
und Göttinnen<br />
in Weiß<br />
Wie kommuniziert man Patient:innen, dass sie an einem<br />
unheilbaren Gehirntumor leiden? Die Neuroonkologin Dr.<br />
Martha Nowosielski erzählt, worauf es in der Kommunikation<br />
zwischen Arzt/Ärztin und Patient:in heute ankommt.<br />
Priv. Doz. Dr.<br />
Martha<br />
Nowosielski, PhD<br />
Medizinische<br />
Universität Innsbruck<br />
Department für<br />
Neurologie<br />
Text Magdalena<br />
Reiter-Reitbauer<br />
FOTO: PRIVAT<br />
Das Glioblastom ist einer der<br />
häufigsten Gehirntumore bei<br />
Erwachsenen. Können Sie die<br />
Erkrankung erklären?<br />
Genau, das Glioblastom ist einer<br />
der häufigsten primären Gehirntumore<br />
im Erwachsenenalter.<br />
Primär bedeutet, dass der Tumor<br />
aus den Gehirnzellen entstanden<br />
ist und im Vergleich zu Gehirnmetastasen<br />
nicht aus einem anderen<br />
Organ gestreut hat. In Österreich<br />
liegt die Zahl der Neuerkrankungen<br />
bei vier pro 100.000<br />
Einwohnern.<br />
Was ist ein Glioblastom genau?<br />
Ist Gehirntumor gleich<br />
Gehirntumor?<br />
Ein Glioblastom beschreibt den<br />
bösartigsten Tumor, der von den<br />
Stützzellen des zentralen Nervensystems<br />
ausgeht. Diese Malignität<br />
(Bösartigkeit) ist einerseits auf<br />
ein schnelles, andererseits auch<br />
auf ein infiltratives Wachstum<br />
zurückzuführen. Auch wenn<br />
man in der Magnetresonanztomographie<br />
– das diagnostische<br />
Werkzeug um einen Gehirntumor<br />
festzustellen – einen lediglich ein<br />
Zentimeter großen Tumorknoten<br />
sieht, weiß man mittlerweile, dass<br />
Tumorzellen bereits im ganzen<br />
Gehirn verstreut zu finden sind.<br />
Das macht die Behandlung so<br />
schwer, weil man im Gehirn nicht<br />
so einfach ohne Funktionseinbuße<br />
operieren kann. Zudem<br />
konnten mittlerweile anhand von<br />
molekularen Markern unterschiedliche<br />
Subtypen identifiziert<br />
und die Glioblastome neu klassifiziert<br />
werden.<br />
Welche Therapiemöglichkeiten<br />
gibt es ungeachtet dessen?<br />
Durch Kenntnis der molekularen<br />
Marker kann die Therapie<br />
zunehmend individualisiert und<br />
die Prognose besser vorhergesagt<br />
werden. Prinzipiell gibt es mehrere<br />
Stützpfeiler, auf denen die<br />
Behandlung basiert. Zunächst<br />
sollte der Tumor so radikal wie<br />
– funktionserhaltend – möglich<br />
reseziert werden. Danach folgen<br />
Strahlen- und Chemotherapie, weil<br />
diese Tumore eben sehr infiltrativ<br />
wachsen. Abgesehen davon gibt<br />
es noch lokale Therapieformen<br />
mit elektrischen Wechselfeldern<br />
(sog. „tumor treating fields“), die<br />
man bei ausgewählten Patienten<br />
anwenden kann.<br />
Wie teilt man Patient:innen<br />
diese Diagnose mit? Welche Erfahrungen<br />
haben Sie gemacht?<br />
Für diese Aufklärungsgespräche<br />
muss man gut vorbereitet sein. Es<br />
ist ein Gespräch mit schwierig zu<br />
kommunizierendem Inhalt, das<br />
stufenweise, oft auch unter Einbeziehung<br />
der Angehörigen, und vorzugsweise<br />
zusammen mit einem<br />
Psychoonkologen stattfinden<br />
sollte. Patienten sollen zum einen<br />
verstehen, dass sie eine unheilbare<br />
Erkrankung haben, zum anderem<br />
sollen sie aber nicht die Hoffnung<br />
und den Mut verlieren, die zur<br />
Verfügung stehenden Therapieoptionen<br />
in Anspruch zu nehmen.<br />
Mit welchen Fragen kommen<br />
Patient:innen zu Ihnen?<br />
Der Wissensstand der Patienten<br />
hat sich in den letzten Jahren und<br />
Jahrzehnten stark gewandelt. Zu<br />
Beginn meiner Arbeit waren sie<br />
nicht so gut informiert wie heute.<br />
Durch den Zugang zum Internet<br />
haben Patienten bereits ein<br />
bestimmtes Wissen und kommen<br />
mit ihren eigenen Wertvorstellungen<br />
und Wünschen zu uns Ärzten.<br />
Diesen Umstand gilt es einfach<br />
anzunehmen. Wir Ärzte sind heute<br />
nicht mehr die Götter in Weiß,<br />
sondern stellen unseren Patienten<br />
im Rahmen des Shared Decision<br />
Making – also der partizipativen<br />
Entscheidungsfindung – alle<br />
Informationen zur Verfügung, auf<br />
denen aufbauend gemeinsam eine<br />
Therapieentscheidung getroffen<br />
wird.<br />
Wie nehmen Patient:innen die<br />
Diagnose Gehirntumor wahr –<br />
gerade im Vergleich zu anderen<br />
Krebserkrankungen?<br />
Viele Patienten haben Angst, dass<br />
sich die Persönlichkeit verändert<br />
und der Tumor das eigene Denken<br />
und Fühlen beeinflussen wird.<br />
Was können Sie als Ärztin tun,<br />
damit Patient:innen trotz ihrer<br />
Erkrankung eine möglichst gute<br />
Lebensqualität beibehalten<br />
können?<br />
Es muss gesagt werden, dass sich<br />
in den letzten zwei Jahrzehnten<br />
die Lebensqualität unter den<br />
einzelnen Therapien deutlich<br />
gebessert hat. Die Präzision der<br />
Strahlentherapie, zum Beispiel,<br />
erlaubt eine bessere Schonung<br />
von Nachbarstrukturen im Gehirn<br />
und begleitende Therapien<br />
verbessern die Verträglichkeit<br />
von Chemotherapien. Durch<br />
neurorehabilitative Maßnahmen<br />
kann die Selbständigkeit erhöht<br />
und dadurch die Lebensqualität<br />
verbessert werden. Zudem<br />
bedeutet Lebensqualität für jeden<br />
Menschen etwas anders. Es ist<br />
wichtig, dass wir dies als Ärzte<br />
den Patienten gleich zu Beginn<br />
gut kommunizieren. Je besser die<br />
Arzt-Patienten-Kommunikation<br />
funktioniert, desto besser kann<br />
der Patient auch die Therapien<br />
mitmachen. Die Diagnose Krebs<br />
ist in unserer Gesellschaft nach<br />
wie vor leider etwas sehr Stigmatisierendes.<br />
Viele Patienten fragen<br />
mich, ob man die Erkrankung<br />
hätte verhindern können. Hier<br />
lautet die Antwort: leider nein.<br />
Wird es in Zukunft einfacher<br />
werden, Gehirntumore zu<br />
behandeln?<br />
In den letzten 20 Jahren hat sich<br />
das Wissen um das Glioblastom<br />
quasi verdoppelt. Eine Kollegin<br />
aus der Neuropathologie hat im<br />
Zuge der aktuellen Hirntumor-<br />
Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation<br />
Folgendes<br />
herausgefunden: Die erste<br />
schriftliche Auflage dieser<br />
Klassifikation aus 1956 wog 360 g;<br />
die aus 2021 bereits 1.650 g. Dieser<br />
Wissenszuwachs ist also sogar<br />
messbar! Es gibt viele neue,<br />
zielgerichtete Therapieoptionen<br />
und auch Medikamente. Außerdem<br />
entstehen neue Studiendesigns,<br />
sodass das Glioblastom in<br />
Zukunft sicherlich deutlich besser<br />
zu behandeln sein wird.<br />
physik im einsatz<br />
gegen krebs<br />
©2022 Novocure GmbH. Alle Rechte vorbehalten. In der Europäischen Union ist Novocure<br />
eingetragene Marke der Novocure GmbH. AT-OPT-00011. v1.0. Juni 2022.<br />
>24.000 behandelte<br />
Patient:innen weltweit<br />
3 CE-zertifizierte<br />
Indikationen<br />
4 Indikationen<br />
in der späten<br />
Entwicklungsphase<br />
Weitere Informationen auf<br />
www.novocure.at
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at 9<br />
INSPIRATION<br />
KOMMUNIKATION UND KREBS –<br />
Man kann nicht nicht<br />
kommunizieren<br />
(Paul Watzlawick)<br />
Eine Krebsdiagnose trifft Menschen meist völlig<br />
unerwartet und unvorbereitet mitten im Leben – und<br />
löst starke Gefühle der Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit<br />
und Hoffnungslosigkeit aus. Nicht nur Betroffene sind<br />
sprachlos und geschockt, auch die Familie gerät in eine<br />
Ausnahmesituation, denn „keiner erkrankt alleine“.<br />
Sprichst du<br />
„Krebs“?<br />
Krebs ist eine sehr komplexe<br />
und vielfältige Erkrankung. Die<br />
Kommunikation darüber wird noch<br />
erschwert durch den vorherrschenden<br />
Krebsjargon. Hier ein Überblick über<br />
wichtige Begriffe:<br />
Krebs<br />
Die Bezeichnung umfasst bösartige Tumoren, die verdrängend<br />
in gesundes Gewebe einwachsen (Karzinom, Sarkom)<br />
und maligne Erkrankung des blutbildenden Systems (Leukämie,<br />
Lymphom).<br />
Maligne/benigne<br />
Bösartig/gutartig<br />
Mag. Karin Isak<br />
Klinische Psychologin,<br />
Schwerpunkt<br />
Psychoonkologie<br />
Beratungsstellenleiterin<br />
der Österreichischen<br />
Krebshilfe<br />
Wien Mitglied<br />
des Präsidiums der<br />
Österreichischen<br />
Krebshilfe<br />
FOTO: PRIVAT<br />
Kommunikation bestimmt<br />
unser Leben und das<br />
unserer Mitmenschen.<br />
Wir teilen uns ununterbrochen<br />
und überall allen mit.<br />
Kommunikation kann nützen –<br />
oder behindern.<br />
Eine hilfreiche Kommunikation,<br />
Zuwendung und Empathie ändern<br />
nicht die Diagnose, jedoch die<br />
augenblickliche Lage. Eine von<br />
Verständnis geprägte Beziehung<br />
zwischen Patient:innen und dem<br />
gesamten Behandlungsteam<br />
schafft Vertrauen, bietet in der<br />
Krise Sicherheit und Halt und<br />
trägt wesentlich zur Verbesserung<br />
der Lebensqualität bei.<br />
Kommunikation<br />
innerhalb der Familie<br />
Auch das gesamte Familiensystem<br />
ist durch die Krebsdiagnose (heraus)gefordert.<br />
Aufgaben müssen<br />
umverteilt, Rollen getauscht,<br />
Kinder gut versorgt werden.<br />
Familienmitglieder schonen sich<br />
nun häufig gegenseitig, keine:r<br />
möchte den/die andere:n belasten<br />
– doch dieses Verhalten gepaart<br />
mit Sprachlosigkeit führt häufig<br />
zu Missverständnissen. Daher ist<br />
es wichtig, aufeinander zuzugehen<br />
und das Gespräch zu suchen.<br />
Kinder müssen altersentsprechend<br />
mit viel Verständnis und<br />
Einfühlungsvermögen aufgeklärt<br />
werden, denn sie spüren, dass<br />
etwas Wichtiges in der Familie<br />
nicht stimmt und sind verunsichert.<br />
Je früher sie die Wahrheit<br />
erfahren, desto besser.<br />
Als Angehörige:r achten Sie<br />
gut auf Ihre Grenzen und überfordern<br />
sich nicht. Die Frage „Was<br />
brauchst du von mir?“ kann sehr<br />
nützlich sein.<br />
Kommunikation des Behandlungsteams<br />
mit den Betroffenen<br />
Für eine gute Diagnosevermittlung<br />
und Erklärung von<br />
Behandlungen braucht es Zeit und<br />
Empathie. „Es geht nicht um das<br />
unartikulierte Intellektualisieren,<br />
sondern um die Fähigkeit zu<br />
fühlen“ (C. Rogers).<br />
Ein offenes Gespräch und die<br />
Zuwendung zum/zur Erkrankten<br />
vermindert Unsicherheit, Angst,<br />
Isolation und Einsamkeit und<br />
bringt spürbare Erleichterung für<br />
den Patienten oder die Patientin.<br />
Fragen, die gestellt werden, sollen<br />
vom Behandlungsteam ernst<br />
genommen und in verständlicher<br />
Sprache beantwortet werden.<br />
Der Arzt oder die Ärztin passt<br />
sich idealerweise an die Sprache<br />
des Gesprächspartners oder der<br />
Gesprächspartnerin an.<br />
Auch nonverbale Kommunikation<br />
wie Mimik und Gestik ist<br />
wichtig, denn Erkrankte sind<br />
besonders sensibel und interpretieren<br />
Zwischentöne – jede<br />
hochgezogene Augenbraue, jede<br />
Unsicherheit des Gegenübers – in<br />
eine negative Richtung.<br />
Kommunikation im<br />
Freundeskreis und mit<br />
Arbeitskolleg:innen<br />
Freundinnen und Freunde und<br />
Kolleg:innen ziehen sich häufig<br />
und für den/die Erkrankte:n nicht<br />
nachvollziehbar zurück. Sie haben<br />
Angst um den/die Betroffene:n<br />
und auch Angst davor, eventuell<br />
selbst zu erkranken. Diese<br />
unausgesprochene und meist<br />
völlig unbewusste Angst führt<br />
zum Rückzug von dem oder der<br />
Erkrankten, der oder die dies als<br />
Kränkung erlebt. Auch hier ist es<br />
ganz wichtig, im Gespräch zu<br />
bleiben.<br />
Mammografie<br />
Röntgen der Brust<br />
Metastase<br />
Tochtergeschwulst, auch Filiae (von lat. filia: Tochter).<br />
Der Begriff Metastase bezeichnet die Absiedelung eines<br />
bösartigen Tumors in entferntem Gewebe bei einer Krebserkrankung.<br />
Krebszellen neigen dazu, sich über Blut- und<br />
Lymphgefäße in weitere Organe auszubreiten und dort als<br />
Tochtergeschwülste anzusiedeln. Die Untersuchung von<br />
Metastasierung bei einer Krebserkrankung ist Gegenstand<br />
der Onkologie.<br />
Onkologie<br />
Lehre von den Krebserkrankungen<br />
Psychoonkologie<br />
Psychoonkologie ist eine multiprofessionelle Fachrichtung,<br />
die sich mit den psychischen und sozialen Bedürfnissen und<br />
Belangen von Krebspatient:innen und deren Angehörigen<br />
beschäftigt. Psychoonkolog:innen betreuen und begleiten<br />
Krebspatient:innen zu den verschiedenen Zeitpunkten<br />
der Erkrankung und der medizinischen Behandlung. Im<br />
Zentrum der psychoonkologischen Arbeit stehen die Unterstützung<br />
der Patient:innen im Umgang mit der Erkrankung,<br />
die Behandlung von psychischen Belastungsreaktionen und<br />
das Erreichen einer möglichst guten Lebensqualität.<br />
Remission<br />
Es sind keine Tumorzellen mehr nachweisbar.<br />
Rezidiv<br />
Wiederauftreten eines Tumors, Rückfall<br />
Screening<br />
Auf eine bestimmte Krankheit gerichtete Untersuchungen<br />
zur Erkennung von symptomlosen Krankheitsträgern<br />
(möglichst im Frühstadium)<br />
Tumor<br />
Gutartiges oder bösartiges Geschwulst, das durch<br />
unkontrollierte Wucherung von Zellen entstanden ist<br />
Tumormarker<br />
Einstufung des Tumors anhand seines Stadiums, d.h. meist<br />
anhand von Größe sowie Ausbreitung in Lymphknoten und<br />
andere Gewebe. Hiernach richten sich Verlauf und Behandlung<br />
der Tumorerkrankung.<br />
Weiterführende Links:<br />
Österreichische Krebshilfe<br />
service@krebshilfe.net<br />
www.krebshilfe.net<br />
Krebshilfe Wien<br />
beratung@krebshilfe-wien.at<br />
www.krebshilfe-wien.at<br />
Eine ausführliche Übersicht über<br />
verschiedene Krebsbegriffe finden Sie hier:<br />
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/<br />
basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/glossar.html<br />
IHR LEBEN MIT<br />
METASTASIERTEM BRUSTKREBS<br />
Handbuch:<br />
Es geht um mich!<br />
Ratgeber:<br />
Sexualität und Brustkrebs<br />
Jetzt kostenlos bestellen oder downloaden auf<br />
www.pfi.sr/ratgeber<br />
Lesen Sie Stellungnahmen Betroffener,<br />
entlastende Perspektiven und<br />
wertvolle Informationen zu Krankheit,<br />
Behandlungsmethoden und Lebensqualität.<br />
www.pfizer.at<br />
Pfizer Corp. Austria GmbH, Wien; PP-ONC-AUT-0321/05.2021
10 Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at<br />
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
INSPIRATION<br />
Zwischen schlechten<br />
Nachrichten und Hoffnung<br />
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe spricht täglich über Krebs. Als Experte<br />
weiß er, wie herausfordernd die Kommunikation über Krebserkrankungen<br />
sein kann – für Patient:innen, Angehörige aber auch für das medizinische<br />
Personal selbst.<br />
Kommunikation und Krebs: Welchen Stellenwert<br />
nimmt Kommunikation in Ihrem medizinischen<br />
Arbeitsalltag ein?<br />
Kommunikation nimmt in meinem Arbeitsalltag 95 Prozent<br />
der Zeit ein und ist für mich eine wesentliche Aufgabe<br />
– auch weil ich Abteilungsleiter bin. Die Diagnose Krebserkrankung<br />
ist für Patient:innen und Angehörige natürlich<br />
immer ein Schockerlebnis. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,<br />
wie Menschen auf diese Krisensituation reagieren.<br />
Daher stellt sich natürlich die Frage, wie wir als medizinisches<br />
Personal mit Patient:innen richtig kommunizieren<br />
und „Bad News“ teilen. Dies stellt eine große Herausforderung<br />
dar, da der Umgang mit emotionaler Betroffenheit<br />
nicht immer einfach ist. Es gibt dafür Kurse, aber kein<br />
Grundrezept zur allgemeinen Herangehensweise – auch<br />
weil vieles von der individuellen Persönlichkeit abhängt.<br />
Meine Lebenserfahrung beinhaltet zum Beispiel eine gute<br />
Informationsbasis für Gespräche und das Prinzip, authentisch<br />
zu sein und die Wahrheit zu sagen. Manche Ärztinnen<br />
und Ärzte schrecken davor zurück, das komplette Schicksal<br />
im Gespräch darzulegen. Ich persönlich denke aber, dass<br />
ein:e Arzt/Ärztin ehrlich sein sollte. Kein medizinisches Personal<br />
der Welt kann genau wissen, was die Zukunft bringt.<br />
Jede:r Patient:in ist ein Individuum, jede Tumorerkrankung<br />
hat einen individuellen Verlauf und jeder Mensch befindet<br />
sich in einer individuellen Situation.<br />
Hat sich die Kommunikation rund um Krebs – nicht nur<br />
im Krankenhaus, sondern ganz grundsätzlich in der Gesellschaft<br />
– verändert?<br />
Selbstverständlich hat sie das; das Stigma „Ich habe Krebs<br />
und bin gleich tot“ ist in der Gesellschaft dennoch nach wie<br />
vor verankert. Von Jahr zu Jahr werden aber immer mehr<br />
Menschen von einer Krebserkrankung geheilt und sprechen<br />
darüber. Gerade am Beispiel von Brustkrebserkrankungen<br />
wird das besonders deutlich. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs<br />
hingehen sehen wir etwa ein ganz anders Bild. Die wenigsten<br />
Menschen, die wissen, dass sie aufgrund einer Krebserkrankung<br />
nur mehr eine gewisse Zeit zu leben haben, wollen<br />
alles verkaufen und eine Weltreise machen. Die meisten<br />
Menschen sehnen sich in dieser Phase der Krankheit nach<br />
Normalität: in der Früh aufstehen, Zeitung lesen, zu Kaffeerunden<br />
gehen, Freunde treffen und Zeit mit der Familie<br />
verbringen. Viele wollen einfach den Alltag erleben, in dem<br />
man nicht über die eigene Erkrankung spricht, sondern<br />
Kraft aus der Normalität schöpft.<br />
Emotionales auch mit nach Hause, gerade als junge:r Arzt/<br />
Ärztin. Ich habe es aber praktisch nie zuhause mit meiner<br />
Familie besprochen, weil es beispielsweise wichtiger war,<br />
die gerade verlorenen Schnuller meiner Kinder zu finden.<br />
Aber natürlich kann es auch passieren, dass man selbst in<br />
eine Depression stürzt. Gerade wenn Menschen sterben,<br />
mit denen man viele Gespräche geführt oder zu denen man<br />
eine Beziehung aufgebaut hat, ist das eine Belastung. Daher<br />
braucht es in diesem Kontext einen Raum, in dem man<br />
sich mit Kolleg:innen austauschen kann. Heute geht diese<br />
Reflexion durch das neue Arbeitszeitgesetz leider immer<br />
mehr verloren. Vor allem junge Kolleg:innen lassen wir mit<br />
all diesen Herausforderungen allein. Das ist schlecht.<br />
Was sollte sich hier ändern,<br />
was könnte man konkret tun?<br />
Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dass ein Team Zeit<br />
hat, miteinander zu reden. Wir müssen den Gesprächen<br />
wieder Raum gehen. In Österreich nennen wir das zum<br />
Beispiel Kaffeetrinken. Dieses Tool des Reflektierens, des<br />
Zusammensetzens im Team ist ein ganz wichtiger Prozess,<br />
der ermöglicht, dass nicht nur Patient:innen sondern auch<br />
Mitarbeiter:innen mit Belastungen umgehen können. Diese<br />
Kommunikation ist wichtig!<br />
Was möchten Sie persönlich gerne rund um<br />
das Thema Krebs kommunizieren?<br />
Die Frage ist, ob wir überhaupt von „Krebs“ sprechen sollen.<br />
Es gibt nicht „den Krebs“, sondern hunderte Arten von<br />
Tumorerkrankungen. Nur die Diagnose Krebs allein heißt<br />
genau gar nichts. Es hängt davon ab, welches Erkrankungsbild<br />
vorliegt und was das für den/die Einzelne:n bedeutet.<br />
Es ist alles möglich: von Krebserkrankungen, die<br />
tödlich enden, über jene, mit denen man<br />
und nicht an denen man stirbt, bis hin<br />
zur Heilung. Jede:r Patient:in hat ihr/<br />
sein eigenes Schicksal und wird ihren/<br />
seinen eigenen Weg gehen. Es<br />
macht daher einen Unterschied,<br />
welche Termini wir verwenden<br />
und wie wir über<br />
Erkrankungen<br />
sprechen.<br />
Univ.-Prof. Dr.<br />
Wolfgang Hilbe<br />
Präsident der Österreichischen<br />
Gesellschaft<br />
für Hämatologie<br />
und Medizinische<br />
Onkologie<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
Text Magdalena<br />
Reiter-Reitbauer<br />
Sie arbeiten in einem sehr herausfordernden Umfeld. Wie<br />
gehen Sie damit um, gerade im Übergang zwischen beruflichem<br />
Wirken und Privatleben?<br />
Aus meiner eigenen Kariere kann ich sagen, dass man nicht<br />
immer so einfach abschalten kann. Natürlich trägt man<br />
EVENT TIPP<br />
Best of ASCO® 2022<br />
24.–25. Juni 2022 | 20 Jahre – Jubiläumsedition<br />
Aktuelle Erkenntnisse vom ASCO® 2022 komprimiert & von<br />
Fachexpert*innen für die klinische Praxis aufbereitet!<br />
GI-Tumore • Urogenitale Tumore • Sarkome & Melanome •<br />
HNO-Tumore & ZNS • Bronchuskarzinome •<br />
Gynäkologische Tumore • Mammakarzinome<br />
Link zur Anmeldung: https://www.onconovum.academy/<br />
anmeldung/anmeldung-best-of-asco-2022<br />
FOTO: SHUTTERSTOCK
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at 11<br />
Seltene Krebserkrankungen<br />
vor den Vorhang holen<br />
Etwa 20-25 % aller Krebserkrankungen sind<br />
selten. Statistisch gesehen ist das weniger<br />
als ein Mensch von 2.000 Menschen.<br />
Bei seltenen Krebserkrankungen gibt<br />
es deshalb großen Bedarf an der<br />
Beschleunigung der Diagnosestellung,<br />
adäquater Versorgung, innovativen<br />
Therapien sowie an Aufbau und<br />
Verbreitung von Wissen.<br />
FOTO: SHUTTERSTOCK<br />
Claas Röhl –<br />
Mitglied des<br />
Vorstands<br />
von Pro Rare Austria<br />
– Allianz für seltene<br />
Erkrankungen<br />
Österreich<br />
Obmann NF Kinder<br />
Austria<br />
Obmann NF Patients<br />
United<br />
Obmann EUPATI<br />
Austria<br />
FOTO: FELICITAS MATERN<br />
Kontakt:<br />
Email: claas.roehl@<br />
nfkinder.at<br />
Tel. +43 699 16624548<br />
Servitengasse 5/16<br />
1090 Wien<br />
Angeborenes Risiko für Tumore<br />
Eine besondere Rolle nehmen die<br />
genetischen Tumorprädispositionssyndrome<br />
ein. Diese machen etwa<br />
10 % aller onkologischen Erkrankungen<br />
aus. Die Betroffenen kommen<br />
mit einer genetischen Veränderung<br />
zur Welt, die ihr Tumorrisiko erhöht.<br />
In manchen Fällen kann das Risiko<br />
einen Tumor zu entwickeln nahezu<br />
100 % betragen. Die Besonderheit<br />
ist, dass in diesen Fällen eine Diagnose<br />
per Gentest teilweise schon im<br />
Kindheitsalter gestellt werden kann,<br />
theoretisch sogar mit dem Neugeborenen-Screening.<br />
Natürlich ist eine<br />
solche Diagnose ein großer Schock für<br />
die betroffene Familie, aber sie birgt<br />
auch die Chance, sich früh mit der<br />
Diagnose auseinandersetzen zu können.<br />
Das heißt, man kann das eigene<br />
Leben danach frühzeitig ausrichten<br />
und vor allem auch lebenswichtige<br />
Vorsorgeuntersuchungen planen und<br />
sich in die Hände einer Expertin/eines<br />
Experten begeben.<br />
Abgesehen davon ist es schon vor der<br />
Familienplanung wichtig zu wissen,<br />
ob man Träger:in einer genetischen<br />
Veränderung ist, die mit einer Wahrscheinlichkeit<br />
von oft 50 % oder höher<br />
an das eigene Kind vererbt werden<br />
kann.<br />
Offener Umgang –<br />
Abbau von Stigmata<br />
Ein Beispiel für ein genetisches<br />
Tumorprädispositionssyndrom ist<br />
Neurofibromatose (NF). Jeden Tag<br />
kommt im deutschsprachigen Raum<br />
ein Kind mit NF zu Welt. Die vielen<br />
verschiedenen Tumore, die bei dieser<br />
Erkrankung auftreten können, sind<br />
mitunter sehr entstellend. Gerade<br />
deswegen braucht es hier mutige<br />
Botschafter:innen, die anderen helfen,<br />
das eigene Schattendasein zu verlassen,<br />
und Betroffenen Mut machen,<br />
ebenfalls offen mit der Erkrankung<br />
umzugehen. Nur wenn Betroffene ihr<br />
Schweigen brechen und sich engagieren,<br />
kann es zu einem gesteigerten<br />
Bewusstsein in der Öffentlichkeit und<br />
zu Verbesserungen der Versorgung in<br />
Bezug auf seltene Krebserkrankungen<br />
kommen.<br />
Internationale Vernetzung<br />
Besonders im Bereich dieser seltenen<br />
Erkrankungen ist eine internationale<br />
Vernetzung ein Schlüsselthema. In<br />
Europa gibt es 24 sogenannte europäische<br />
Referenznetzwerke (ERN). Das<br />
sind Netzwerke von akademischen<br />
Institutionen, die gemeinsam mit<br />
Patient:innen-Vertreter:innen unter<br />
dem Motto „Share – Care – Cure“<br />
daran arbeiten, die Lebensqualität von<br />
Menschen mit seltenen Erkrankungen<br />
zu verbessern. Die vier ERN, die sich<br />
mit seltenen Krebserkrankungen<br />
beschäftigen, sind: EuroCan (für<br />
seltene solide Tumore im Erwachsenenalter),<br />
PaedCan (für seltene<br />
Krebserkrankungen bei pädiatrischen<br />
Patient:innen), EurobloodNet (für<br />
seltene hämatologische Krebserkrankungen)<br />
und GENTURIS (für erblich<br />
bedingte Tumorerkrankungen).<br />
Die Rolle von<br />
Patient:innenorganisationen<br />
Patient:innenorganisationen leisten<br />
wichtige Arbeit, um Betroffene in den<br />
Phasen der Diagnoseabklärung zu<br />
informieren, ihnen Orientierung zu<br />
schenken und um sie an Expert:innen<br />
zu vermitteln. Darüber hinaus ist auch<br />
die Zusammenarbeit mit Forscher:innen<br />
von Bedeutung, um patient:innenzentrierte<br />
Forschungsprojekte<br />
umzusetzen. Beratungsmöglichkeiten<br />
sowie Möglichkeiten zur Vernetzung<br />
mit anderen Betroffenen und zur psychosozialen<br />
Unterstützung sind weitere<br />
Beispiele für die wertvolle Arbeit von<br />
Patient:innenorganisationen.<br />
Patient:innen-Vertreter:innen, die<br />
sich in die Arzneimittelentwicklung<br />
einbringen möchten, brauchen<br />
entsprechendes Wissen über präklinische<br />
und klinische Forschung sowie<br />
über Zulassungsprozesse. Die europäische<br />
Patient:innen-Akademie (EUPATI)<br />
vermittelt seit 2015 genau dieses<br />
Know-how an Patient:innen-Vertreter:innen.<br />
Etwa 300 Absolvent:innen,<br />
viele davon aus onkologischen Indikationen,<br />
haben den Patient Expert<br />
Training Kurs von EUPATI absolviert<br />
und sind dadurch zu gefragten Partnern<br />
in Forschungsprojekten geworden. In<br />
Österreich plant der Dachverband<br />
„Allianz der onkologischen PatientInnenorganisationen“<br />
einen Universitätslehrgang<br />
in deutscher Sprache zum<br />
Thema Patient Advocacy.<br />
Weiterführende Links:<br />
www.prorare-austria.org<br />
www.nf-patients.eu<br />
www.nfkinder.at<br />
www.dieallianz.org<br />
www.eupati.eu<br />
Diese Kampagne wurde unterstützt von Incyte.<br />
Bei dieser Logoplatzierung handelt es sich<br />
um eine entgeltliche Einschaltung.
12 Lesen Sie mehr unter www.krebsratgeber.at<br />
Eine Themenzeitung von Mediaplanet<br />
HÄUFIGSTE KREBSARTEN<br />
in der EU<br />
2.948.369<br />
neue Fälle im Jahr 2020<br />
12,1 %<br />
Brustkrebs<br />
11,6 %<br />
Dickdarm<br />
11,4 %<br />
Prostata<br />
10,8 %<br />
Lunge<br />
3,6 %<br />
Haut<br />
5,3 %<br />
Blase<br />
3,2 %<br />
Bauchspeicheldrüse<br />
FOTO: SHUTTERSTOCK<br />
(Wie) kann ich über<br />
Krebs sprechen?<br />
Wie gut muss man sich kennen, um über<br />
Krebs sprechen zu können/dürfen/müssen?<br />
Ist Humor erlaubt oder eher nicht?<br />
Ist es manchmal besser, nichts zu sagen?<br />
42 %<br />
Sonstige<br />
Egal, wie du über Krebs sprichst –<br />
Hauptsache du tust es.<br />
– Martina Hagspiel, InfluCancer Kurvenkratzer<br />
Quelle: Global Cancer Observatory,2020