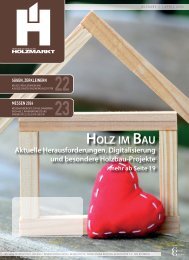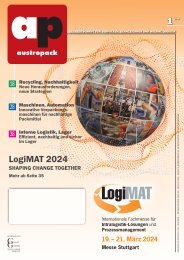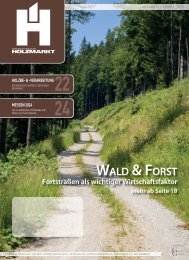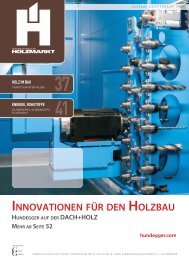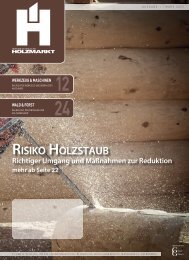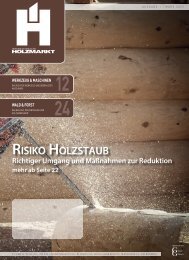Holzmarkt 2023/03
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16<br />
FORSTWIRTSCHAFT/SOFTWARE, IT<br />
HOLZTROCKNUNG<br />
17<br />
Was uns Ultraschall über den Wald erzählt<br />
Die Folgen der Klimakrise setzen Wälder unter Druck. Die Trockenperioden werden stärker und häufen sich. Wie gehen<br />
Buchen und Fichten damit um? Das findet Biologin Barbara Beikircher unter anderem mit Ultraschall heraus. Dabei hat sie<br />
festgestellt, dass ausgetrockneten Fichten irgendwann auch Wasser nicht mehr helfen könnte.<br />
„Wir wollen wissen, wie sich Buchen und Fichten entwickeln, wenn durch den<br />
Klimawandel Trockenheit häufiger und intensiver wird – und ob sich die Bäume<br />
erholen können, wenn sie wieder Wasser zur Verfügung haben“, erklärt Barbara<br />
Beikircher von der Universität Innsbruck. Die Biologin forscht an einem besonderen<br />
Ort – dem Kranzberger Forst nördlich des Münchner Flughafens.<br />
Ihre Forschung ist Teil des Kranzberg Roof Experiment (KROOF) – eines breit angelegten<br />
Forschungsprojekts, das WissenschaftlerInnen des Helmholtz-Zentrums<br />
München und der Technischen Universität München im Jahr 2010 initiierten. Internationale<br />
Forschende ergründen darin, wie Wälder mit Trockenstress umgehen.<br />
Der Wissenschaftsfonds FWF förderte Barbara Beikirchers Teilprojekt „Trockenheitsanpassung<br />
und Erholung von Buche und Fichte“, das sie mit ihren Projektpartnern<br />
Rainer Matyssek und Thorsten Grams von der TU München durchführt.<br />
Im ehemaligen Wirtschaftswald wählten die Forschenden zwölf Teilflächen aus.<br />
Auf ihnen wachsen 70 bis 90 Jahre alte Buchen und Fichten. Der Boden rund um<br />
jede dieser Flächen wurde jeweils mit einer wasserdichten Plane bis zu einem Meter<br />
tief umschlossen, sodass seitlich kein Wasser eindringen konnte. Und automatische<br />
Dächer auf sechs dieser Teilflächen hielten im Zeitraum von 2013 bis 2019<br />
Wasser vom Boden ab. Im Sommer 2019 wurden alle Dächer geöffnet und alle Flächen<br />
bewässert. Die Forschenden konnten zudem mit einem Kran rund um die Uhr<br />
auf die Baumkronen in den beforschten Teilflächen zugreifen. „Es gibt nur ganz<br />
wenige Orte weltweit, wo man so forschen kann“, sagt Barbara Beikircher.<br />
Wie verdurstet ein Baum?<br />
Wasser wird über die Wurzeln aufgenommen und im Holzteil zu den Blättern transportiert.<br />
Diese haben kleine Spaltöffnungen. Sind diese geöffnet, kann der Baum<br />
CO 2<br />
aufnehmen, gleichzeitig verdunstet Wasser. „Man könnte ganz salopp sagen:<br />
Unter Trockenstress ist der Baum immer zwischen Verhungern und Verdursten.<br />
Sind die Spaltöffnungen geschlossen, verhungert er. Sind sie geöffnet, verdurstet<br />
er, wenn nicht ausreichend Wasser von unten nachkommt“, erklärt Beikircher.<br />
Die starke Haftung der einzelnen Wassermoleküle sorgt dafür, dass Wasser,<br />
angetrieben durch die Verdunstung an der Blattoberfläche passiv von den Wurzeln<br />
in die Blätter gelangt. Dieser Transport geschieht im Holz des Baumes, das<br />
sich aus vielen verholzten, lang gestreckten Zellen – den Tracheiden und Tracheen<br />
– zusammensetzt. Diese Leitgefäße sind im Fall der Fichte nur wenige<br />
Millimeter lang und wenige Mikrometer dick, verlaufen parallel zueinander nach<br />
oben und sind miteinander verbunden.<br />
Embolie der Leitgefäße<br />
„Dieses Leitungssystem funktioniert nur so lange, wie die Wasserfäden in den<br />
Leitgefäßen erhalten bleiben. Reißen sie, gelangt Luft in die Leitgefäße und der<br />
Wassertransport kommt zum Erliegen. Wir sprechen dann von Embolien“, so<br />
Barbara Beikircher. Das Reißen eines feinen Wasserfadens in den Leitgefäßen<br />
erzeugt ein Geräusch im Ultraschallbereich. Um dieses zu hören, verkabelten die<br />
Biologin und ihr Team Bäume von der Wurzel bis zur Krone mit Ultraschallsensoren.<br />
In diesem Ausmaß wurde ein solcher Freilandversuch noch nie durchgeführt.<br />
Brechen Hunderttausende feine Wasserfäden, ist das noch kein Problem. Leitgefäße<br />
können sich wieder befüllen oder andere ihre Wasserleitung übernehmen.<br />
Das funktioniert allerdings nur eingeschränkt, erläutert Beikircher: „Ab einem<br />
Schwellenwert sind so viele Leitgefäße mit Luft gefüllt, dass der Wassertransport<br />
zum Erliegen kommt. Dann kann der Baum auch absterben.“<br />
Foto: Uni Innsbruck/Beikircher<br />
Ächzende Fichte<br />
Nach einigen Tagen der Messungen konnte sie bei den trockengestressten Bäumen<br />
deutlich mehr Signale feststellen als bei den Kontrollbäumen. „Außerdem<br />
wurden bei den Fichten um ein Vielfaches mehr Signale verzeichnet als bei den<br />
Buchen. Vermutlich taten sich Buchen durch ihre tiefen Wurzeln deutlich leichter,<br />
Wasser aus der Tiefe zu holen“, sagt Barbara Beikircher.<br />
Auch innerhalb eines Baumes hörte die Biologin Unterschiede. In den Wurzeln<br />
gab es kaum Signale, in der Krone viele. „Das bestätigt unsere Theorie, dass<br />
Embolien zunächst in der Krone auftreten, denn die Wasserpotenziale sind dort<br />
niedriger“, so die Biologin. Die trockengestressten Fichten zeigten zudem eine<br />
verringerte Leistung der Fotosynthese. Sie wuchsen deshalb nur wenige Zentimeter<br />
im Jahr. „Hätten wir sie länger gestresst, wären bestimmt mehrere Bäume<br />
abgestorben“, ist Beikircher sicher.<br />
Der Blick ins Innere<br />
Für eine weitere Methode, die elektrische Widerstandstomografie, schlugen die<br />
Biologin und ihr Team rund um Baumstämme Nägel ein, an denen Elektroden<br />
befestigt wurden. Über diese Elektroden legten sie Strom an und erfassten elektrische<br />
Widerstände. Da der elektrische Widerstand auch von der Feuchtigkeit<br />
abhängt, kann die Verteilung von Wasser im Inneren des Stammes so bildlich dargestellt<br />
werden. Dabei sahen sie: Im Stamm trockengestresster Bäume war deutlich<br />
weniger Wasser verfügbar als bei den Kontrollbäumen. Fichten waren zudem<br />
mehr beeinträchtigt als Buchen.<br />
Die Forscher erlangten so eine weitere wichtige Erkenntnis. Während alle klassisch<br />
untersuchten Parameter darauf hindeuteten, dass die trockengestressten<br />
Fichten sich erholen, wenn sie wieder Wasser erhalten, offenbarte die Widerstandstomografie<br />
das Gegenteil. „Als wir ins Detail gingen, haben wir gesehen:<br />
Die äußeren Bereiche waren gut versorgt. Aber das innenliegende Kernholz, das<br />
als Wasserspeicher dient, war entleert. Der Baum hat Wasser nach außen geleitet,<br />
um die Äste und Blätter weiter versorgen zu können. Auch nach einem Jahr<br />
konnten sich diese inneren Speicher nicht wieder befüllen“, erklärt Beikircher. In<br />
einem Folgeprojekt will das Forscherteam nun herausfinden, ob sich die Speicher<br />
wieder füllen können. Geht das nicht, könnten bei zukünftigen Dürreereignissen<br />
Bäume früher absterben.<br />
Lektionen für die Klimakrise<br />
Was lässt sich durch ihre Forschung über Waldbewirtschaftung in der Klimakrise<br />
lernen? „Unsere Messungen bestätigen, dass Fichten-Monokulturen an trockenen<br />
Standorten keine Zukunft mehr haben“, resümiert Barbara Beikircher. Zusätzliche<br />
Untersuchungen in der Klimakammer an dreijährigen Fichten zeigten<br />
zudem, dass sich die Jungbäume bei starker, langer Trockenheit nicht mehr erholen<br />
können und absterben. Im Wald könnten sie es schwer haben, nachzuwachsen.<br />
Dazu kommt: Trockenheit macht anfällig für Schädlinge und Krankheiten.<br />
Auch einige Fichten im Kranzenberger Forst erlagen dem Borkenkäfer. Sie waren<br />
zu schwach, um ausreichend Abwehrstoffe zu produzieren.<br />
Publikationen<br />
Knüver T., Bär A., Ganthaler A., Gebhardt T. et al.: Recovery after long-term<br />
summer drought: Hydraulic measurements reveal legacy effects in trunks of Picea<br />
abies but not in Fagus sylvatica, in: Plant Biology 2022<br />
Hesse BD., Gebhardt T., Hafner BD., Hikino K. et al: Physiological recovery of<br />
tree water relations upon drought release – response of mature beech and spruce<br />
after five years of recurrent summer drought, in: Tree Physiology 2022<br />
Tomasella M., Beikircher B., Häberle KH., Hesse B. et al.: Acclimation of branch<br />
and leaf hydraulics in adult Fagus sylvatica and Picea abies in a forest through-fall<br />
exclusion experiment, in: Tree Physiology 2017<br />
3/<strong>2023</strong><br />
Holzwerke Ladenburger in Kerkingen (Deutschland).<br />
Rekordprojekt für Mühlböck<br />
Fünf Kanaltrockner von Mühlböck Holztrocknungsanlagen in Eberschwang gehen bis 2025 in zwei Ausbaustufen an<br />
die Holzwerke Ladenburger in Kerkingen. Das ist das größte Projekt der Unternehmensgeschichte des Innviertler<br />
Holztrocknungsspezialisten.<br />
Holzwerke Ladenburger (Deutschland) bestellte Ende 2022 für seinen Standort<br />
in Kerkingen fünf Kanaltrockner von Mühlböck Holztrocknungsanlagen mit<br />
einem Gesamtauftragswert von über zehn Millionen Euro. Die Holzwerke Ladenburger<br />
zählen in Deutschland zu den größten Produzenten von Konstruktionsvollholz<br />
(KVH) und Brettschichtholz (BSH) und beschäftigen an vier Standorten in<br />
Deutschland rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<br />
Geordert wurden fünf Mühlböck Kanaltrockner der Variante DYNAMIC 1306 PRO,<br />
die nun in den kommenden Jahren in zwei Ausbaustufen am Sägewerk in Kerkingen<br />
montiert werden: Zuerst sollen zwei Kanaltrockner für BSH bis Mitte 2024 in<br />
Betrieb genommen werden (gemeinsame Trocknungskapazität ca. 121.000 m³/a).<br />
Mit Ausbaustufe 2 sollen dann drei weitere Kanaltrockner für KVH bis Anfang<br />
2025 anlaufen (Trocknungskapazität insgesamt bis zu 144.000 m³/a). „Neben der<br />
für uns optimalen, vereinbarten Lieferzeit, den Trocknungsgarantien und dem<br />
technischen Know-how bei Mühlböck war für uns vor allem die Energieeffizienz<br />
der Kanaltrockner DYNAMIC 1306 PRO ausschlaggebend für unsere Entscheidung“,<br />
betont Dr. Christoph Rettenmeier, Prokurist und Projektleiter bei Ladenburger.<br />
„Die neuen Kanaltrockner fügen sich damit hervorragend in den Fokus<br />
unseres Unternehmens auf Ressourcenschonung und Klimaschutz ein.“<br />
Einsparungen bei Energiebedarf und hohe Trocknungsqualität<br />
Die Mühlböck Kanaltrockner DYNAMIC erreichen in dieser Ausführung durch die<br />
innovative Wärmerückgewinnung einen sehr hohen Effizienzgrad: Das Einsparungspotential<br />
für den Wärmeverbrauch wird beim Trocknungssystem 1306 PRO<br />
je nach Trocknungscharge, Außentemperatur und anderen Einflussfaktoren mit<br />
bis zu 25 % angegeben.<br />
„Zusätzlich sorgt die Mühlböck Regelung K5 in Kombination mit dem Intelli-<br />
Vent System dafür, dass Unterschiede in der Anfangsfeuchte bei gleichbleibender<br />
Taktzeit exakt auf die definierten Endfeuchten getrocknet werden“, formuliert<br />
man bei Mühlböck einen weiteren Kundennutzen. Gemeinsam mit der schonenden<br />
Trocknung in einem Kanaltrockner sorgt dies für höchste Holzqualität bei<br />
gleichzeitig bestmöglicher Feuchtestreuung.<br />
Zahlreiche Vorteile durch individuelle Transportlösung<br />
Eine weitere technische Besonderheit im Auftrag von Holzwerke Ladenburger<br />
stellt das von Mühlböck entworfene Transportsystem dar. Das innovative Beschickungs-<br />
und Fördersystem wurde speziell nach Kundenwünschen auch um eine<br />
Paketrückführung erweitert und wird künftig für einen vollautomatischen Transport<br />
der Holzstapel über den gesamten<br />
Trocknungsprozess sorgen. „Diese individuelle Lösung ermöglicht es unserem<br />
Kunden, den Staplerverkehr in seinem Produktionsprozess zu minimieren und<br />
die Kanaltrockner optimal in seinen Produktionsfluss zu integrieren“, so Richard<br />
Mühlböck, Geschäftsführer von Mühlböck Holztrocknungsanlagen. Das komplette<br />
Fördersystem ist wetterfest überdacht. Zudem reduzieren sich mit dieser Lösung<br />
der interne Transport- und Personalaufwand im Bereich der Trocknung und<br />
die dabei anfallenden Lärmemissionen bei Holzwerke Ladenburger erheblich.<br />
3/<strong>2023</strong> www.holzmarkt-online.at<br />
Foto: Ladenburger