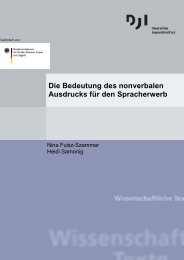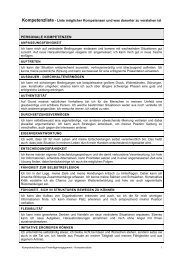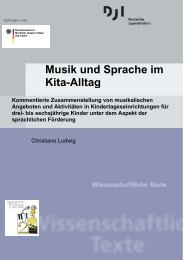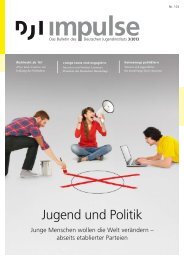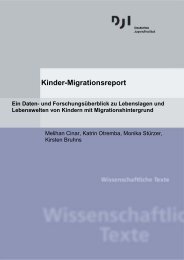6 Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung (Nicola Gragert) 193 6.1 ...
6 Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung (Nicola Gragert) 193 6.1 ...
6 Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung (Nicola Gragert) 193 6.1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die <strong>Arbeitsfeld</strong>er<br />
Helming u.a. (1997) nennen als Sozial- und Persönlichkeitskompetenz z.B.<br />
die Kooperations-, Aushandlungs- und Vermittlungsfähigkeit, damit zwischen<br />
den Familien und den Behörden, Schulen und sonstigen Institutionen effektiv<br />
vermittelt werden kann. Persönliche und soziale Kompetenzen sind aber auch<br />
im Umgang mit eigenen Grenzen, bei der Balance zwischen freundlicher Anbindung<br />
und professioneller Distanz oder bei der Teamberatung und Selbstreflexion<br />
gefordert.<br />
Merchel (1998a) verweist auf die notwendige Fähigkeit, mit der Ambivalenz<br />
von Hilfe und Kontrolle umgehen zu können, weil die Anwesenheit der FamilienhelferInnen<br />
einen starken Einbruch in den familiären Intimbereich bedeutet<br />
(vgl. Münder u.a. 1998) und sie sich im Spannungsfeld zwischen Hilfe und<br />
Kontrolle befinden (vgl. Helming u.a. 1997).<br />
Insbesondere die Ergebnisse des Praxisforschungsprojekts von Helming u.a.<br />
(1997) zeigen, dass die Fachkräfte umfangreiche Fähigkeiten aus allen Kompetenzbereichen<br />
für ihre Arbeit benötigen. Weitere Auseinandersetzungen mit<br />
dem Qualifikationsprofil der sozialpädagogischen Familienhilfe verdeutlichen,<br />
dass je nach Art der Betrachtung andere Kompetenzbereiche als besonders bedeutend<br />
hervorgehoben werden. So hebt Merchel (1998a) mit dem Blick auf die<br />
Qualitätsdiskussion die Methodenkompetenz besonders hervor und die überörtlichen<br />
Träger der Jugendhilfe (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter<br />
1996) stellen die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz der FamilienhelferInnen<br />
in den Vordergrund.<br />
6.3.1.3 Soziale Gruppenarbeit<br />
Die soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII ist in ihrem Grundkonzept<br />
zwischen den offenen Angeboten der Jugendarbeit und den intensiveren Angeboten<br />
der teilstationären und stationären <strong>Hilfen</strong> angesiedelt (vgl. Wegehaupt-<br />
Schlundt 2001).<br />
(a) Besonderheiten der Hilfeart<br />
Wegehaupt-Schlundt (2001) macht auf die mittlerweile entstandene Heterogenität<br />
der Zielgruppe der sozialen Gruppenarbeit aufmerksam, die zu vielfältigen<br />
Konzepten und einem uneinheitlichen, momentan nicht klar strukturierten Bild<br />
der Praxis geführt haben. Häufig wird die soziale Gruppenarbeit in Form eines<br />
»sozialen Trainingskurses« durchgeführt.<br />
Seit Einführung des SGB VIII hat die Inanspruchnahme der sozialen<br />
Gruppenarbeit kontinuierlich zugenommen, wobei große regionale Unterschiede<br />
zu verzeichnen sind. Die durchschnittliche Dauer von 7,2 Monaten lässt eher<br />
eine »justiznahe« Verwendung der Hilfeform vermuten. Ein Blick auf den<br />
AdressatInnenkreis zeigt, dass die soziale Gruppenarbeit zu 81% aus männlichen<br />
Klienten besteht und im Gegensatz zu anderen <strong>Erziehung</strong>shilfen mit 20%<br />
einen relativ hohen Anteil an ausländischen Kindern und Jugendlichen aufzuweisen<br />
hat (vgl. van Santen u.a. 2003).<br />
217