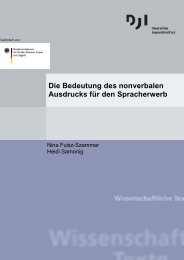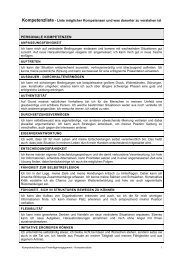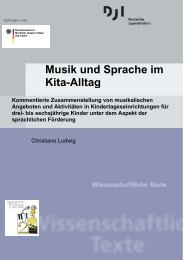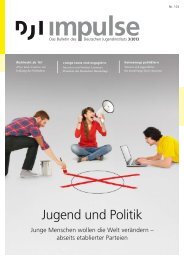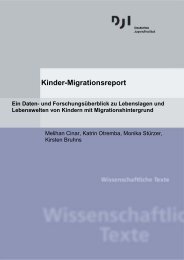6 Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung (Nicola Gragert) 193 6.1 ...
6 Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung (Nicola Gragert) 193 6.1 ...
6 Das Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung (Nicola Gragert) 193 6.1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die <strong>Arbeitsfeld</strong>er<br />
weg, weil in den vorausgehenden Lebenssituationen der Heranwachsenden<br />
meistens eine emotional verlässliche Unterstützung im Herkunftsmilieu fehlte.<br />
Eine wichtige Voraussetzung, um dem gesellschaftlichen Auftrag und der pädagogischen<br />
Verantwortung in diesem Tätigkeitsfeld entsprechen zu können, wird<br />
in der ausreichenden zeitlichen Stabilität und in der Zusammensetzung des BetreuerInnenteams<br />
gesehen. Damit ist ein längerfristiges Verbleiben in einer<br />
Einrichtung zu einer notwendigen Anforderung an die Fachkräfte in diesem<br />
Bereich geworden.<br />
Besondere Anforderungen ergeben sich durch die umfassende pädagogische<br />
Tätigkeit, durch die vermehrt auftretenden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen<br />
der betreuten Kinder und Jugendlichen und durch vielfältige institutionelle<br />
und arbeitsorganisatorische Belastungsbedingungen, z.B. bei Konflikten<br />
mit der Herkunftsfamilie oder mit Ausbildungseinrichtungen, aber auch aufgrund<br />
der zeitlichen Arbeitsbedingungen (vgl. Günther/Bergler 1992) müssen<br />
die Professionellen besonderen Belastungen gewachsen sein. Die MitarbeiterInnen<br />
haben zudem einen erhöhten Legitimationsbedarf gegenüber den Heranwachsenden<br />
und Außenstehenden, weil sie Aufgaben zu erfüllen haben, die<br />
gemein hin nicht als Arbeit definiert werden, sondern den Bereichen Freizeit<br />
und Familie zugeordnet werden (vgl. Freigang 2000).<br />
Die Betreuungsarbeit im Rahmen der Heimerziehungsformen, die keine<br />
ständige Anwesenheit von Personal vorsehen, erfordert aufgrund der punktuellen<br />
Anwesenheit eine erhöhte Flexibilität und eine besondere Vertrauensbeziehung<br />
zu den Jugendlichen, die ohne den täglichen Kontakt aufgebaut werden<br />
muss (vgl. Freigang/ Wolf 2001).<br />
6.3.3 Zusammenfassende Einschätzung<br />
Fasst man die vorgestellten Ergebnisse zusammen, muss zunächst festgestellt<br />
werden, dass wenig neuere Studien oder empirische Untersuchungen vorliegen,<br />
die sich gezielt mit den Aufgaben im <strong>Arbeitsfeld</strong> der <strong>Hilfen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erziehung</strong> und<br />
den hierfür erforderlichen Kernkompetenzen der Fachkräfte in den unterschiedlichen<br />
Bereichen und auf den verschiedenen Ebenen befassen.<br />
Die in der aktuellen Diskussion vorfindbaren Aufgabenprofile für die jeweiligen<br />
<strong>Arbeitsfeld</strong>er der <strong>Erziehung</strong>shilfen werden häufig aus den Gesetzestexten<br />
sowie aus den Gesetzeskommentaren übernommen und abgeleitet. Von den<br />
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen werden weitere Aufgabenformulierungen<br />
abgeleitet. Auffällig dabei ist, dass Berichte von MitarbeiterInnen aus<br />
der Praxis bezüglich ihrer alltäglichen Aufgaben bisher kaum Eingang in die<br />
Fachdiskussion gefunden haben.<br />
Deutlich mehr als über die Aufgabenprofile wird über die Qualität der <strong>Hilfen</strong><br />
sowie über die Anforderungen an die Qualifizierung der Fachkräfte und die Kompetenzprofile<br />
diskutiert.<br />
Zu erwähnen ist die »JES-Studie« (Jugendhilfe-Effekte-Studie) mit der Laufzeit<br />
von 5 Jahren (1995-2000):<br />
• Die Personalsituation in den erzieherischen <strong>Hilfen</strong> wird in der »JES-Studie«<br />
zwar angesprochen und die Prozesse zwischen Kindern, Familien und den<br />
231