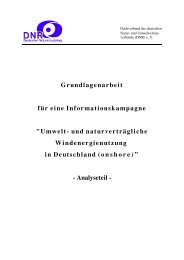DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.dstgb.de<br />
4 Auswirkungen der Windenergienutzung und des <strong>Repowering</strong><br />
auf lokaler Ebene<br />
4.1 Wirtschaftliche Aspekte und Vergütung<br />
nach EEG<br />
Bei der Standortwahl kommt es darauf an, dass die tatsächlichen<br />
und rechtlichen Rahmenbedingungen auf<br />
lange Sicht einen wirtschaftlichen Betrieb der Windenergieanlage<br />
ermöglichen. Maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit<br />
eines Vorhabens ist vor allem die Höhe der Einnahmen,<br />
die der Betreiber durch die Veräußerung des<br />
erzeugten Stroms erzielen kann. Diese sind abhängig<br />
von den gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Einspeisevergütung<br />
und von den konkreten Verhältnissen<br />
vor Ort.<br />
Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Einspeisevergütung<br />
Nach dem EEG hat der Betreiber einer Windenergieanlage<br />
gegenüber dem Stromnetzbetreiber einen<br />
Anspruch auf Vergütung des abgenommenen Stroms<br />
zu fest definierten Vergütungssätzen. Näher dazu B 4.1.<br />
Für <strong>Repowering</strong>-Vorhaben enthält das Gesetz eine<br />
besondere Anreizregelung (§ 30 EEG). Im Wege der<br />
Direktvermarktung besteht für den Anlagenbetreiber<br />
die Möglichkeit, eine noch höhere Vergütung zu erzielen.<br />
Grundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit<br />
eines Vorhabens bilden jedoch die Vergütungssätze des<br />
EEG. Da dem Betreiber die Vergütung für einen Zeitraum<br />
von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres<br />
garantiert ist, schafft das EEG eine besondere<br />
Investitions sicherheit.<br />
Konkrete Verhältnisse vor Ort<br />
Die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens hängt vor allem<br />
von der Standortqualität ab, also der Frage wie viel Prozent<br />
des im EEG definierten Referenzertrages sich am<br />
vorgesehenen Standort voraussichtlich erzielen lassen.<br />
Für die Höhe des Ertrages spielt auch die Gesamthöhe<br />
der Windenergieanlagen eine entscheidende Rolle. Weitere<br />
Faktoren, wie die Entfernung vom nächsten Verknüpfungspunkt<br />
zum öffentlichen Stromnetz, können<br />
ebenfalls ausschlaggebend für die Frage der Wirtschaftlichkeit<br />
eines Vorhabens sein.<br />
Die Wirtschaftlichkeit eines <strong>Repowering</strong>-Vorhabens<br />
hängt von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel<br />
der Betreiberstruktur hinsichtlich der Altanlagen, des<br />
Gesamtzustandes des Altanlagenbestandes sowie seiner<br />
Finanzierungssituation, der Verfügbarkeit eines pla-<br />
nungsrechtlich gesicherten Windenergiestandortes für<br />
neue Windenergieanlagen mit großen Höhen etc. ab.<br />
Näher dazu B 4.3.<br />
4.2 Wertschöpfung<br />
Die örtliche Wertschöpfung durch Windenergie rückt<br />
immer mehr in den Fokus. Für eine 2 MW-Windenergieanlage<br />
berechnet das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung<br />
(IÖW) eine kommunale Wertschöpfung<br />
von bis zu 2,2 Millionen Euro in 20 Jahren, wobei<br />
dafür insbesondere angenommen wird, dass Anlagenbetrieb<br />
und Wartung durch eine örtliche Firma geschehen<br />
und der Betreiber seinen Sitz innerhalb der Gemeinde<br />
hat und somit dort steuerpflichtig ist. 1 Unter den Begriff<br />
der so errechneten Wertschöpfung fallen dabei Unternehmensgewinne,<br />
Einkommen von Beschäftigten und<br />
Steuereinnahmen der Gemeinde. Die Gemeinde profitiert<br />
daher direkt von den Steuereinnahmen, zusätzlich<br />
gegebenenfalls, wenn sie als Betreiber von Windenergieanlagen<br />
tätig ist und hiermit Gewinne erwirtschaftet.<br />
Bei den Steuereinnahmen kommt es zu Gewerbesteuereinnahmen<br />
und Einnahmen durch den Anteil der<br />
Gemeinde an der Einkommenssteuer. Es verbleiben<br />
70 Prozent der Gewerbesteuer in der Gemeinde, weitere<br />
30 Prozent kommen hinzu, wenn der Sitz des Betreibers<br />
im Gemeindegebiet liegt. Näher dazu B 5.1.<br />
Bürgerinnen und Bürger können als Beschäftigte in<br />
Windenergieprojekten profitieren, können Windenergieanlagen<br />
betreiben, oder sich finanziell daran beteiligen.<br />
Eine solche finanzielle Beteiligungsmöglichkeit<br />
sind sogenannte Bürgerwindparks. Sie werden als wünschenswert<br />
angesehen, um vor Ort möglichst viel Wertschöpfung<br />
zu erzielen und die Akzeptanz für Anlagen zu<br />
erhöhen. Grundsätzlich sollen sich bei diesem Modell<br />
die Bürger, die in einer bestimmten räumlichen Nähe<br />
wohnen, an einem Bürgerwindpark finanziell beteiligen<br />
können oder / und ihn in Eigenregie führen. 2 Die Bürgerwindparks<br />
unterscheiden sich von Ort zu Ort danach,<br />
wie hoch die Beteiligungsmöglichkeit ist und wie die<br />
Gesellschaftsform gestaltet wird. Die Bürger beteiligen<br />
sich in der Regel als Mitglied einer Genossenschaft<br />
1 Renews Spezial- Ausgabe 46 / Dezember 2010, Hintergrundinformation<br />
der Agentur für Erneuerbare Energien, Ergebnisse der Studie des Instituts<br />
für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), S. 10 ff.<br />
2 Vgl. Windenergie-Erlass vom 11. Juli 2011 des Landes NRW 1.4.: „Bürgerwindparks<br />
sind Windfarmen, an denen sich die ortsansässigen Bürgerinnen<br />
und Bürger konzeptionell und finanziell beteiligen können.“<br />
24 <strong>Kommunal</strong>e Handlungsmöglichkeiten beim Ausbau der Windenergie<br />
11 / 2012