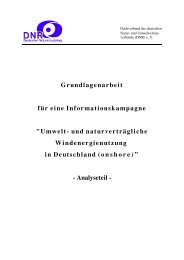DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.dstgb.de<br />
teile hat er gegebenenfalls durch günstigere Beschaffungskonditionen.<br />
Ob vor Ort Bürgerwindparks befördert<br />
werden sollen oder nicht, ist eine Frage des Einzelfalls<br />
und des Engagements vor Ort. Investieren Bürger in<br />
einen Windpark oder entschließen sich diesen selbst zu<br />
betreiben, gehen sie wirtschaftliche Risiken ein, die sie<br />
im Vorfeld genau einschätzen sollten. 22<br />
5.4.3 Gestaltung von Bürgerwindparks<br />
Mangels gesetzlicher Vorgabe existieren wie geschrieben<br />
unterschiedlichste gesellschaftsrechtliche Konstrukte<br />
von Bürgerwindparks. Auf Grund der Haftungsbegrenzung<br />
werden zwei Rechtformen besonders häufig<br />
gewählt, die GmbH & Co. KG und die Genossenschaft.<br />
Beide Rechtsformen haben Vor- und Nachteile, die im<br />
Einzelfall zu prüfen sind. Sie werden unterschiedlich<br />
steuerlich behandelt und unterscheiden sich bei den<br />
Regelungen über den Einfluss der Mitwirkenden in den<br />
Organen. 23 Auch bei der sogenannten Prospektpflicht<br />
bestehen Unterschiede, derzeit besteht für die Genossenschaft<br />
keine Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagengesetz.<br />
Die Genossenschaft hat eine Generalversammlung, in<br />
der grundsätzlich jedes Mitglied eine Stimme hat, § 43<br />
Abs. 3 Satz 1 GenG. Ausnahmen hiervon sind restriktiv<br />
geregelt, so dass die Genossenschaft als besonders<br />
demokratische Rechtsform gilt, bei der Personen, die<br />
nur einen kleinen finanziellen Beitrag geleistet haben,<br />
6 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
6.1 Bedeutung für die Windenergie und<br />
das <strong>Repowering</strong><br />
Bei der Errichtung von Windenergieanlagen sind deren<br />
Auswirkungen auf die Belange des Naturschutzes und<br />
der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Dies gilt für<br />
sowohl für die Regional- und Bauleitplanung als auch<br />
für die Genehmigung von Windenergieanlagen.<br />
22 Näheres zu den Wirtschaftlichen Risiken, insbesondere zum Ertragsrisiko,<br />
findet sich hier: EEG-Erfahrungsberichts 2011 der Bundesregierung<br />
gemäß § 65 EEG im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit Vorhaben IIe Windenergie – Endbericht<br />
S. 82 ff; ebenso in: Bundesministerium für Verkehr, Bau und<br />
Stadtentwicklung (BMVBS) – Strategische Einbindung regenerativer<br />
Energien in regionale Energiekonzepte Wertschöpfung auf regionaler<br />
Ebene, BMVBS-Online-Publikation, Nr. 18/2011, S. 104 ff.<br />
23 Vergleichende Darstellungen finden sich in verschiedenen Publikationen<br />
zum Thema: „Leitfaden Bürgerwindpark Mehr Wertschöpfung für<br />
die Region“ herausgegeben von windcomm Schleswig-Holstein; „Windenergie<br />
in Bürgerhand: Energie aus der Region für die Region“ herausgegeben<br />
vom Bundesverband WindEnergie e. V.<br />
hinsichtlich ihres Einflusses genau so behandelt werden<br />
wie Personen, die höhere finanzielle Beiträge geleistet<br />
haben. Auch bei der Frage, wie hoch finanzielle Mindestbeteiligung<br />
und Höchstbeteiligung sind, sind Bürgerwindparks<br />
unterschiedlich gestaltet. Einige ermöglichen<br />
schon ab 500 Euro eine Beteiligung, mehrere<br />
Anteile werden oft im sogenannten Rundenverfahren<br />
ausgegeben. Die auszugebenden Anteile werden in der<br />
ersten Runde möglichst an alle Interessenten ausgeben,<br />
in späteren Runden entscheidet gegebenenfalls das<br />
Los, wer mehrere Anteile erwerben darf.<br />
5.5 Stiftungen<br />
Zum Teil wird darauf gesetzt, dass Bürger vor Ort Stiftungen<br />
gründen und Verträge mit den Betreibern von<br />
Windenergieanlagen dahingehend abschließen, dass<br />
diese die Stiftung mit Geldern aus ihren Gewinnen unterstützen<br />
bzw. das Grundkapital stiften. Dies geschieht vor<br />
dem Hintergrund, dass die Gemeinde selbst dem verwaltungsrechtlichen<br />
Koppelungsverbot unterliegt und<br />
sie sich häufig nicht in die Nähe der Gefahr begeben<br />
möchte, dass ihre Amtsträger eine strafrechtliche Vorteilsannahme<br />
oder andere Straftatbestände begehen. 24<br />
Zudem begrüßen viele Gemeinden solche Stiftungen<br />
als Möglichkeit, bestimmte Projekte in der Gemeinde<br />
zu unterstützen, die aus dem Gemeindehaushalt nicht<br />
finanziert werden könnten, obgleich sie vielen Bürgerinnen<br />
und Bürgern zu Gute kommen (s. Anhang 1.3).<br />
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind die<br />
Auswirkungen eines einzelnen Vorhabens auf Natur und<br />
Landschaft zu prüfen. Hierbei ist vor allem wichtig:<br />
❚ Die Errichtung und der Betrieb der Windenergieanlage<br />
müssen den Anforderungen entsprechen, die sich<br />
aus dem Naturschutzrecht ergeben, insbesondere<br />
aus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), aus<br />
den Naturschutzgesetzen der Länder sowie aus dem<br />
dazu erlassenden Ausführungsrecht, wie zum Beispiel<br />
aus festgesetzten Schutzgebieten.<br />
24 Angeregt werden solche Stiftungen zum Beispiel im Windenergie-Erlass<br />
vom 11. Juli 2011 des Landes NRW unter Punkt 1.3.: „Empfehlenswert<br />
ist stattdessen [öffentlich-rechtlicher Vertrag] eine indirekte Förderung<br />
über die Gründung einer Bürgerstiftung, welche mit Vertretern verschiedener<br />
lokaler Vereine, Verbände und Gremien besetzt ist. Die Stiftung<br />
könnte vom Betreiber mit Finanzmitteln ausgestattet werden.“<br />
46 <strong>Kommunal</strong>e Handlungsmöglichkeiten beim Ausbau der Windenergie<br />
11 / 2012