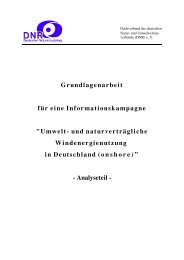DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
DStGB-Dokumentation N° 111 - Repowering-Kommunal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.dstgb.de<br />
Auch obliegt es den Beteiligten in diesem Fall, den<br />
Nachweis zur Einhaltung der Voraussetzungen des <strong>Repowering</strong>-Bonus<br />
gegenüber dem Netzbetreiber zu führen.<br />
4.4 Bedeutung von Aspekten der Wirtschaftlichkeit<br />
für die Gemeinden<br />
Die planenden Gemeinden haben ein Interesse an dem<br />
wirtschaftlichen Betrieb eines Windparks und wollen –<br />
zum Beispiel über die Gewerbesteuer – indirekt hiervon<br />
profitieren. Die durch die Regelungen des EEG geschaf-<br />
5 Wertschöpfung<br />
Neben einem Beitrag zum Klimaschutz und zur lokalen<br />
Versorgungssicherheit kann Windenergie auch einen<br />
Beitrag zur kommunalen Wertschöpfung leisten. In seiner<br />
Studie „<strong>Kommunal</strong>e Wertschöpfung durch Erneuerbare<br />
Energien“ errechnet das Institut für ökologische<br />
Wirtschaftsforschung (IÖW) verschiedene Wertschöpfungsbeispiele.<br />
Es betont, da davon auszugehen sei, dass bei einem<br />
<strong>Repowering</strong> eine größere Leistung installiert würde, stiegen<br />
damit auch die Steuereinnahmen, die Gewinne und<br />
die Einkommen durch den Betrieb der Anlagen. 18 Für<br />
eine 2 MW-Anlage berechnet das IÖW eine kommunale<br />
Wertschöpfung von bis zu 2,8 Millionen Euro in 20 Jahren,<br />
wobei dafür insbesondere angenommen wird, dass<br />
Anlagenbetrieb und Wartung durch eine örtliche Firma<br />
geschehen, der Betreiber seinen Sitz innerhalb der<br />
Gemeinde hat und somit dort steuerpflichtig ist und dass<br />
die Anlage in der Gemeinde produziert wird. 19 Für den<br />
häufigeren Fall, dass die Anlage nicht in der Gemeinde<br />
produziert wird, wird von einer Wertschöpfung von bis zu<br />
2,2 Millionen Euro ausgegangen, wobei wiederum dafür<br />
zumindest vorausgesetzt wird, dass Anlagenbetrieb und<br />
Wartung durch eine örtliche Firma geschehen und der<br />
Betreiber seinen Sitz innerhalb der Gemeinde hat.<br />
Bei den Rahmenbedingungen sind folgende Aspekte<br />
zu betrachten:<br />
5.1 Gewerbesteuer<br />
Seit 2009 gilt ein spezieller Zerlegungsmaßstab für die<br />
Windenergie. Es verbleiben nach § 29 Abs. 1 Nr. 2<br />
GewStG 70 Prozent der Gewerbesteuer in der Gemeinde,<br />
18 <strong>Kommunal</strong>e Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien, Schriftenreihe<br />
des IÖW 196/10, S. 58.<br />
19 Renews Spezial- Ausgabe 46 / Dezember 2010, Hintergrundinformation<br />
der Agentur für Erneuerbare Energien, Ergebnisse der Studie des Instituts<br />
für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), S. 10 ff.<br />
fene Investitionssicherheit ist Grundlage des im Rahmen<br />
der planerischen Abwägung zu berücksichtigenden<br />
Investitionsinteresses von Investoren, Betreibern und<br />
Grundstückseigentümern. Regelungen, wie jene in § 30<br />
Abs. 2 EEG zur Zeitspanne des Abbaus bestehender<br />
Altanlagen beim <strong>Repowering</strong> können als Orientierungsmaßstab<br />
für die Bauleitplanung herangezogen werden,<br />
wenn es zum Beispiel um die Bestimmung einer „angemessenen“<br />
Frist bei Darstellungen bzw. Festsetzungen<br />
in den Bauleitplänen nach § 249 Abs. 2 BauGB geht.<br />
in der die Windenergieanlage steht. Wie bei anderen<br />
Vorhaben gilt auch für Windenergieanlagen, dass der<br />
Gewerbesteuerertrag nicht gleichmäßig anfällt und mit<br />
Verlustvorträgen zu rechnen ist. Die Abschreibungsdauer<br />
ist in der Afa-Tabelle im Abschnitt 3 „Betriebsanlagen<br />
allgemeiner Art“ in Ziffer 3.1.5 geregelt. Sie<br />
beträgt danach 16 Jahre.<br />
5.2 <strong>Kommunal</strong>e Beteiligung an Windenergie<br />
anlagen<br />
Die Gemeinde kann sich selbst an Windenergieanlagen<br />
beteiligen oder diese betreiben unter Einhaltung der von<br />
Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Regelungen<br />
über die kommunalwirtschaftliche Betätigung.<br />
Hauptvoraussetzung dafür ist allerdings die Zugriffsmöglichkeit<br />
der Gemeinde auf Flächen. Ist sie selbst<br />
nicht Eigentümer in Frage kommender Flächen, muss<br />
sie die Rechte daran frühzeitig durch Verträge mit den<br />
Eigentümern absichern.<br />
5.3 Pachteinnahmen und Steuern durch<br />
Pachteinnahmen<br />
Ist die Gemeinde selbst Eigentümer von Flächen, die<br />
für die Windenergie in Betracht kommen, so kann sie<br />
diese zum Zwecke der Erzielung von Pachteinnahmen<br />
verpachten. Haushaltsrecht und gegebenenfalls das<br />
Vergaberecht sind dabei im Einzelfall einzuhalten. Die<br />
Höhe der Pachteinnahmen richtet sich häufig nach der<br />
erzielten Einspeisevergütung, ein vereinbarter prozentualer<br />
Anteil wird gezahlt.<br />
Grundstückseigentümer, die ihre Grundstücke für die<br />
Errichtung von Windenergieanlagen verpachten, müssen<br />
ihre Einnahmen entsprechend versteuern. Von den<br />
Steuern erhält die Gemeinde ihren gesetzlichen Anteil,<br />
der Anteil an der Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent<br />
nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes.<br />
44 <strong>Kommunal</strong>e Handlungsmöglichkeiten beim Ausbau der Windenergie<br />
11 / 2012