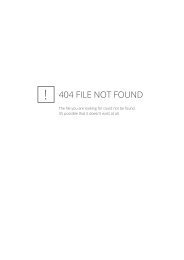Arbeitsprozesse und Lernfeldorientierung - Institut Technik und ...
Arbeitsprozesse und Lernfeldorientierung - Institut Technik und ...
Arbeitsprozesse und Lernfeldorientierung - Institut Technik und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Arbeitsprozesswissen <strong>und</strong> lernfeldorientierte Curricula<br />
organisierendes Prinzip der Berufsausbildung in Deutschland“ (Deißinger 1998) <strong>und</strong><br />
Heideggers/Rauners Konzept offener dynamischer Berufsbilder genommen.<br />
Deißinger stellt Beruflichkeit als „organisierendes Prinzip“ der deutschen<br />
Berufsausbildung dar. Er zeigt die Bedeutung dieses organisierenden Prinzips an drei<br />
Funktionen auf:<br />
• eine Integration- <strong>und</strong> Sozialisationsfunktion für die nachfolgende Generation,<br />
• eine ordnungspolitisch-organisatorische Funktion des Qualifizierungsprozesses,<br />
• eine Funktion als didaktisch-curriculare Richtgröße <strong>und</strong> Bezugspunkt des<br />
außerschulischen Berechtigungswesens.<br />
Integration- <strong>und</strong> Sozialisationsfunktion für die nachfolgende Generation:<br />
Berufserziehung hat die Aufgabe, die nachwachsende Generation in die arbeitsteilig<br />
strukturierte Gesellschaft zu integrieren (vgl. Deißinger 1998, S. 134). Die Frage nach<br />
dem Gelingen einer sinnvollen sozialen Integration schließt die Persönlichkeitsbildung<br />
ein. Die gesellschaftlich-berufliche Integration ist damit durch zwei Punkte markiert:<br />
• Zum einen ist die Gesellschaft an stabilen Verknüpfungen <strong>und</strong> Mechanismen der in<br />
ihr stattfindenden Reproduktionsprozesse interessiert.<br />
• Zum anderen liegt es im Interesse des Individuums, so im Beschäftigungssystem<br />
platziert zu werden, dass es ihm gelingt, seinen Vorstellungen entsprechend an<br />
einem gewissen Status, Einkommen, Ansehen <strong>und</strong> Sicherheit zu partizipieren.<br />
Das Berufsprinzip erweist sich nach Deißinger im Prozess gesellschaftlich-beruflicher<br />
Integration als strukturierende Größe (vgl. Deißinger 1998, S. 137). Es bindet die<br />
Individuen an die Gesellschaft über die berufliche Bildung <strong>und</strong> ist eine „Drehscheibe“<br />
zwischen Bildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungssystem (vgl. Deißinger 1998, S. 138).<br />
Ordnungspolitisch-organisatorische Funktion des Qualifizierungsprozesses: Auf der<br />
Seite des Ausbildungswesens repräsentiert der Beruf ein Qualifizierungsziel, das darin<br />
besteht, den einzelnen Menschen so auszustatten, dass es ihm möglich wird, erworbene<br />
Kompetenzen möglichst umfassend in <strong>Arbeitsprozesse</strong>n einzubringen. Was die<br />
Beschäftigungsseite angeht, so ist von Beruflichkeit dann auszugehen, wenn die<br />
Gestaltung betrieblicher Arbeitsplätze bzw. der betrieblichen Arbeitsorganisation<br />
Aufgabenbewältigungen auf der Basis derartiger Kompetenzen ermöglicht.<br />
„Beruflichkeit zeigt sich nicht isoliert in den Strukturen des Ausbildungs- oder des<br />
Beschäftigungswesens“ (Deißinger 1998, S. 170). Beide sind durch einen<br />
Zusammenhang gekennzeichnet. Dem Berufsprinzip kommt in diesen<br />
makrostrukturellen Ordnungsbeziehungen eine große Bedeutung zu. Das Berufsprinzip<br />
beinhaltet die Idee der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Berufsförmige Strukturen<br />
knüpfen an ein berufliches Ausbildungsmodell, dessen Funktion die Überwindung der<br />
individuellen <strong>und</strong> betrieblichen Vorgaben für die gesellschaftliche Integration der<br />
nachwachsenden Generation ist (vgl. Deißinger 1998, S. 172). Dies führt zu einer<br />
Standardisierung der Qualifizierungsleistungen des Ausbildungssystems. Berufe heben<br />
die Heterogenität der im Wesentlichen prozessunabhängigen Ausdifferenzierung<br />
funktionaler Arbeitsverrichtungen tendenziell auf, indem sie ein Potenzial an<br />
qualifikatorischer wie gesellschaftlicher Verallgemeinerung konstituieren <strong>und</strong> dieses als<br />
Zurechnungsstrategie schul- <strong>und</strong> ausbildungsabhängiger Qualifikations- <strong>und</strong><br />
Statusbündelung in die betrieblichen Arbeitsabläufe <strong>und</strong> die zugr<strong>und</strong>eliegende<br />
18