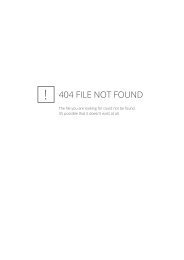Arbeitsprozesse und Lernfeldorientierung - Institut Technik und ...
Arbeitsprozesse und Lernfeldorientierung - Institut Technik und ...
Arbeitsprozesse und Lernfeldorientierung - Institut Technik und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Arbeitsprozesswissen <strong>und</strong> lernfeldorientierte Curricula<br />
entstehen, <strong>und</strong> die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme<br />
verwendet werden, beinhaltet (vgl. Brockhaus Bd. 21, 1996, S. 599).<br />
<strong>Technik</strong> bezeichnet also nicht nur die von Menschen gefertigten Gegenstände,<br />
sondern auch deren Entstehungs- <strong>und</strong> Verwendungszusammenhänge <strong>und</strong> die dafür<br />
erforderliche Handlungsfähigkeit. <strong>Technik</strong> stellt eine Vergegenständlichung von<br />
Arbeitserfahrung dar (vgl. Fischer 1995, S. 294).<br />
Technische Systeme sind durch Funktionen gekennzeichnet, in denen Stoffe,<br />
Energie oder Informationen transportiert, gewandelt oder gespeichert werden. Die<br />
Funktion von <strong>Technik</strong> stellt eine „innere Logik von <strong>Technik</strong>“ (Rauner 1987, S. II)<br />
dar. Die Funktionen technischer Systeme werden durch Wirkungszusammenhänge<br />
realisiert, die Naturgesetzen unterliegen. Dieser Umstand hat vielfach zu der<br />
vereinfachten Vorstellung geführt, <strong>Technik</strong> sei gleichbedeutend mit angewandter<br />
Naturwissenschaft. Diese Annahme hat sich als großer Irrtum in der Entwicklung<br />
der <strong>Technik</strong> erwiesen. Insbesondere die offene Zweckstruktur von gr<strong>und</strong>legenden<br />
Erfindungen zeigt, dass technische Praxis sich erheblich von der<br />
Naturwissenschaft unterscheidet.<br />
Technische Systeme entfalten ihre Funktionen nur im Rahmen gesellschaftlich<br />
geprägten menschlichen Handelns. Sie sind immer Teile von übergeordneten<br />
soziotechnischen Systemen <strong>und</strong> repräsentieren menschliche Zwecksetzungen,<br />
Handlungsmuster <strong>und</strong> Arbeitsvollzüge. <strong>Technik</strong> wird in diesem Zusammenhang<br />
als Einheit des technisch Möglichen <strong>und</strong> sozial Wünschbaren begriffen (vgl.<br />
Rauner 1987, S. II).<br />
Technische Systeme bringen gr<strong>und</strong>sätzlich Eingriffe in das natürliche Ökosystem<br />
mit sich. Fragen der Zweckmäßigkeit <strong>und</strong> der sozialen sowie ökologischen Folgen<br />
machen auf die Nebenwirkungen <strong>und</strong> Risiken vom <strong>Technik</strong>einsatz aufmerksam.<br />
Der Glaube an einen technischen Fortschritt, der sich eine stetige Verbesserung<br />
der gesellschaftlichen Entwicklung versprochen hat, ist vor den zerstörerischen<br />
Folgen verschiedenster <strong>Technik</strong>en verblasst. Das Verständnis, welches technische<br />
Entwicklung als sozialen Prozess auffasst, bricht radikal mit der Annahme einer<br />
selbstständigen Eigengesetzlichkeit von <strong>Technik</strong>entwicklung <strong>und</strong> weist auf den<br />
Bedarf an <strong>Technik</strong>gestaltung <strong>und</strong> <strong>Technik</strong>bewertung hin.<br />
Im Rahmen beruflicher Facharbeit zeigt sich dies in einer<br />
gebrauchswertorientierten <strong>Technik</strong>gestaltung, welche die Nebenfolgen des<br />
<strong>Technik</strong>einsatzes potenziell mitberücksichtigt (vgl. Rauner 1987 S. 292).<br />
Bildung: Die Gestaltungsorientierung als Bildungsidee umfasst sowohl den Aspekt der<br />
Persönlichkeitsbildung wie auch der fachlichen Kompetenz. Sie hebt den<br />
Dualismus von subjektivem Bildungsdenken <strong>und</strong> technischer Rationalität auf. Der<br />
Gestaltungsansatz von Arbeit <strong>und</strong> <strong>Technik</strong> zielt einerseits auf die Befähigung zur<br />
Gestaltung <strong>und</strong> andererseits auf die objektiven <strong>und</strong> subjektiven Voraussetzungen,<br />
damit gestaltet werden kann. Die berufliche Bildung erweist sich damit im<br />
Modernisierungsprozess beruflicher Facharbeit als zentrale Kategorie. Die<br />
Fähigkeit zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung <strong>und</strong> Solidarität in konkreten<br />
<strong>Arbeitsprozesse</strong>n ist unter anderem als Bedingung für eine Modernisierung zu<br />
bewerten (vgl. Klafki 1996, S. 52). Bildung in diesem Sinne versteht sich reflexiv,<br />
d.h. sie begreift sich einerseits in realen Arbeitsvollzügen im Spannungsfeld<br />
ökonomischer, individueller, gesellschaftlicher, betrieblicher, rechtlicher <strong>und</strong><br />
24