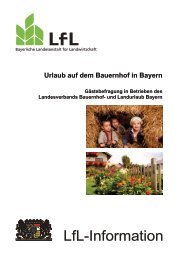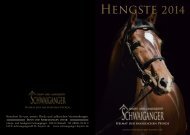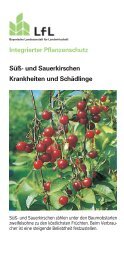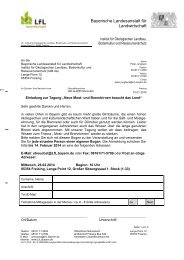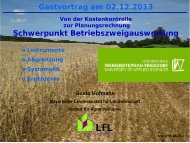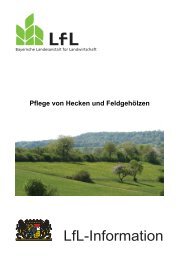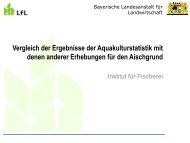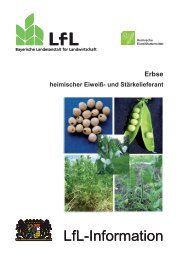Keimfähigkeit, Triebkraft, Feldaufgang und Steinbrandbefall bei ...
Keimfähigkeit, Triebkraft, Feldaufgang und Steinbrandbefall bei ...
Keimfähigkeit, Triebkraft, Feldaufgang und Steinbrandbefall bei ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5 Material <strong>und</strong> Methoden<br />
5.6.2 Aussaat<br />
Die Aussaat auf dem Versuchsfeld erfolgte am 03.11.08 mit einer Versuchssämaschine der<br />
Firma Wintersteiger. Die Saatstärke betrug 350 Körner/m 2 <strong>und</strong> der Drillabstand 0,13 cm. Der<br />
Saatgutbedarf je m 2 errechnet sich aus dem Produkt von Saatstärke <strong>und</strong> Tausendkorngewicht<br />
dividiert durch die <strong>Keimfähigkeit</strong>. Somit ergab sich für 'Capo' (CT 96 %) <strong>bei</strong> einem Tausendkorngewicht<br />
50 g <strong>und</strong> einer <strong>Keimfähigkeit</strong> von 96 % ein Saatgutbedarf von 742 g für die gesamte<br />
Versuchsfläche.<br />
Von 'Capo' (CT 56 %) wurden <strong>bei</strong> einem Tausendkorngewicht von 50 g <strong>und</strong> einer <strong>Keimfähigkeit</strong><br />
von 95 % insgesamt 746 g Saatgut benötigt.<br />
Alle Parzellen wurden im April 2009 aufgr<strong>und</strong> einer starken Verkrustung der Versuchsfläche<br />
gestriegelt.<br />
5.6.3 Bonituren<br />
Der <strong>Feldaufgang</strong> der einzelnen Varianten wurde am 30.12.2008 ermittelt.<br />
Um den <strong>Feldaufgang</strong> zu bestimmen, musste die Bestandesdichte der einzelnen Versuchsglieder<br />
<strong>und</strong> deren Wiederholungen erfasst werden. Zu diesem Zweck wurden die aufgelaufenen<br />
Pflanzen innerhalb vier laufender Meter in jeder Parzelle gezählt. Von der unteren Grenze der<br />
Parzelle wurde ein Meter Abstand eingehalten <strong>und</strong> ab der dritten Saatreihe wurde mit der<br />
Zählung der Keimlinge innerhalb eines Meters begonnen, um Randeffekte auszuschließen.<br />
Analog wurde in der vierten, fünften <strong>und</strong> sechsten Reihe vorgegangen, jeweils um einen Meter<br />
versetzt. Mit Hilfe der auf diese Weise erfassten Zahlen wurde unter der Berücksichtigung<br />
der Aussaatstärke <strong>und</strong> des Reihenabstands die Bestandsdichte je m 2 <strong>und</strong> damit der <strong>Feldaufgang</strong><br />
für jede Variante errechnet.<br />
Die Ährenbonitur auf dem Feld (mit T. caries befallene Ähren/ m 2 ) wurde vom 21.07.09 bis<br />
24.07.09 erfasst.<br />
Hierzu wurden die befallenen Ähren pro m 2 gezählt. Die Zählung erfolgte mit Hilfe eines<br />
1 m 2 großen Holzrahmens, welcher in vier gleich große Quadrate unterteilt war, um das Zählen<br />
zu vereinfachen. In jeder Parzelle wurden vier zufällig ausgewählte Quadratmeter auf<br />
<strong>Steinbrandbefall</strong> untersucht. Abschließend wurde aus den vier Werten jeweils der Mittelwert<br />
für einen Quadratmeter berechnet.<br />
Neben der Bestimmung von <strong>Feldaufgang</strong> <strong>und</strong> <strong>Steinbrandbefall</strong> wurde am 11.08.09 zusätzlich<br />
der Ertrag der einzelnen Parzellen ermittelt. Nach der Ernte mit dem Parzellenmähdrescher<br />
wurde das Erntegut in Baumwollsäcken mit der entsprechenden Etikettierung getrocknet. Für<br />
jede Parzelle wurde das Gewicht des Ernteguts mit Hilfe einer Waage der Firma Precisia Gravimetrics<br />
AG erfasst <strong>und</strong> anschließend auf die Einheit Dezitonnen pro Hektar umgerechnet.<br />
Um eine exakte Bestimmung des Befalls mit T. caries zu erreichen, wurde vom 11.08.09 bis<br />
14.08.09 der Befall am Erntegut (Anzahl Sporen/Korn) im Labor bestimmt. Hierzu mussten<br />
aus den Baumwollsäcken repräsentative Stichproben genommen werden. Zu diesem Zweck<br />
wurde ein so genannter Bodenprobenteiler (Synonym: Riffelteiler) verwendet, welcher eine<br />
Aufteilung der Probe in zwei annähernd gleich große Teilproben bewirkte (siehe Abbildung<br />
17). Ein Bodenprobenteiler besteht aus einem Einfüllstutzen mit daran angebrachten etwa 18<br />
Kanälen oder Rinnen, die abwechselnd zu gegenüberliegenden Seiten zeigen. Kanäle mit einer<br />
Weite von etwa 13 mm haben sich als zweckmäßig erwiesen. Zum Gebrauch des Probenteilers<br />
wird das Saatgut gleichmäßig in den Einfüllbehälter gegeben <strong>und</strong> dann gleichmäßig<br />
- 30 -