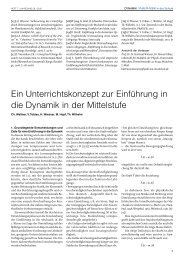Physik und Sport - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Physik und Sport - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Physik und Sport - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
I.2 Schulleistungsmessung 6<br />
b<strong>und</strong>es oder den des Individuums misst. Die Evaluierung kann dabei statisch in Form eines<br />
Leistungsnachweises am Ende einer Lerneinheit oder prozessbezogen über den gesamten Verlauf<br />
einer Unterrichtseinheit z. B. in Form von Portfolios erfolgen. Darüber hinaus muss entschieden<br />
werden, welche Art von Wissen abgeprüft wird: Ein Leistungsnachweis, bei dem der<br />
Schüler semantisches Wissen, sprich Daten- <strong>und</strong> Faktenwissen, nachweisen muss, gibt beispielsweise<br />
keinerlei Hinweise auf die Fertigkeiten <strong>und</strong> Fähigkeiten, die dieselbe Person in<br />
anwendungsorientierten Prüfungen erbringen könnte. Die Leistung sagt also nichts über das<br />
so genannte prozedurale Wissen des Schülers aus. Gründe für diese unterschiedliche Leistungsfähigkeit<br />
liefert die Gedächtnispsychologie, welche die Existenz verschiedener Sparten<br />
des Langzeitgedächtnisses aufgezeigt hat, die je nach Wissensart aktiviert werden. Es kann<br />
somit durchaus sein, dass ein Schüler, der enorme Probleme bei der quantitativen Auswertung<br />
physikalischer Versuche hat, sich aktiv <strong>und</strong> gewinnbringend an Experimenten <strong>und</strong> Schülerversuchen<br />
einbringen kann, weil er hier auf eben genannte prozedurale Gedächtnisinhalte,<br />
also nicht direkt bewusstseinsfähige Fertigkeiten zurückgreifen kann. Diese Überlegungen zur<br />
Komplexität der Schulleistungsmessung werfen zwangsläufig die Frage auf, wodurch schulische<br />
Leistungen überhaupt determiniert werden.<br />
2.2 Determinanten der Schulleistung<br />
Einleitend kann festgestellt werden, dass die gängige intuitive Vorstellung, gute schulische<br />
Leistungen seien einzig <strong>und</strong> allein auf Intelligenz zurückzuführen, in diesem Maße nicht haltbar<br />
ist. Diese allgemein weit verbreitete Vorstellung relativiert u. a. FUNKE (2004) mit Verweis<br />
auf verschiedene andere Faktoren, die den Schulerfolg in äußerst komplexen Wechselwirkungen<br />
beeinflussen (ebd., S. 79 ff.). Eine mögliche Gliederung essentieller Einflussgrößen<br />
schlagen zum Beispiel HELMKE <strong>und</strong> WEINERT vor (ebd., S. 84)<br />
Abbildung 1: Determinanten der Schulleistung nach Helmke <strong>und</strong> Weinert<br />
(Quelle: Helmke et al., 2006, S. 84)