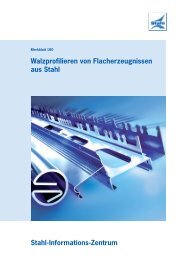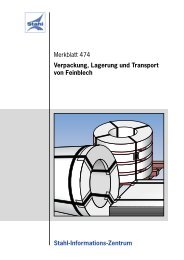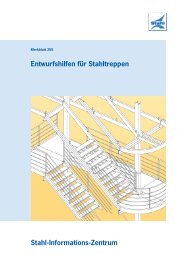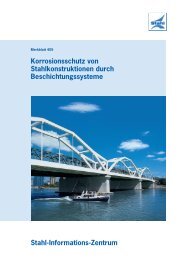MB 322 Geschraubte Verbindungen im Stahlbau
MB 322 Geschraubte Verbindungen im Stahlbau
MB 322 Geschraubte Verbindungen im Stahlbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.4 Zugverbindungen der Kategorien<br />
D und E<br />
<strong>Geschraubte</strong> <strong>Verbindungen</strong> können auch<br />
so konstruiert werden, dass Kräfte in Richtung<br />
der Schraubenachse auftreten. Gemäß Abb. 4.7<br />
werden die Schrauben dann durch Zugkräfte<br />
beansprucht, was die kennzeichnende Beanspruchung<br />
der Verbindung ist. Bei dieser Verbindungsart<br />
können Abstützkräfte auftreten,<br />
die Auswirkungen auf die Schraubenzugkräfte<br />
und auf die Beanspruchungen der Anschlussbleche<br />
haben. Gemäß Abb. 4.7 kommen folgende<br />
Versagensarten in Frage:<br />
a) Überschreiten der max<strong>im</strong>alen Schraubenzugkräfte<br />
b) Überschreiten der max<strong>im</strong>alen Blechbiegemomente<br />
c) Durchstanzen der Schraubenköpfe oder der<br />
Mutter durch die Anschlussbleche<br />
Abb. 4.7: Verbindung mit zugbeanspruchten Schrauben<br />
sowie Versagensarten<br />
Zugbeanspruchte Schrauben kommen hauptsächlich<br />
in Verbindung mit Stirnplatten vor.<br />
Auf die Ermittlung der Tragfähigkeit dieser <strong>Verbindungen</strong><br />
wird in Abschnitt 4.6 näher eingegangen.<br />
Max<strong>im</strong>ale Schraubenzugkräfte können<br />
Tabelle 5.7 entnommen werden.<br />
4.5 Schraubenkräfte in<br />
Scherverbindungen<br />
<strong>Geschraubte</strong> <strong>Verbindungen</strong> werden fast ausschließlich<br />
so konstruiert, dass alle Schrauben<br />
der Verbindung den gleichen Durchmesser und<br />
gleiche Abstände untereinander haben (siehe<br />
<strong>Geschraubte</strong> <strong>Verbindungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Stahlbau</strong><br />
beispielsweise Abb. 4.3 b). Von Ausnahmen abgesehen<br />
werden die Schrauben symmetrisch angeordnet,<br />
so dass der Schwerpunkt S des Schraubenbildes<br />
<strong>im</strong> Schnittpunkt der Symmetrielinien<br />
liegt. Gemäß Abb. 4.8 werden die Schnittgrößen<br />
NS, VS und MS auf diesen Punkt bezogen.<br />
Sofern die zu übertragenden Schnittgrößen des<br />
anzuschließenden Querschnittsteils (siehe Abschnitt<br />
1.3) nicht in diesem Punkt wirken, sind<br />
entsprechende Schnittgrößentransformationen<br />
durchzuführen.<br />
Die allgemein übliche Vorgehensweise zur<br />
Ermittlung der Schraubenkräfte ist in Abb. 4.8<br />
an einem Beispiel mit vier Schrauben dargestellt:<br />
1. Zunächst werden die Schnittgrößen NS und<br />
VS gleichmäßig auf die vier Schrauben verteilt,<br />
so dass man Ni = NS / 4 und Vi = VS / 4<br />
erhält.<br />
2. Nun werden die Schraubenkräfte infolge<br />
MS ermittelt, die senkrecht auf den Hebel -<br />
armen ri zum Schwerpunkt S stehen. Bei<br />
dem Beispiel in Abb. 4.8 ergeben sie sich<br />
aus Gleichgewichts- und Symmetriegründen<br />
zu MS / (4 · ri).<br />
3. Nun wird die max<strong>im</strong>ale Schraubenkraft infolge<br />
NS, VS und MS berechnet. Sie tritt stets<br />
in Schrauben auf, die vom Schwerpunkt am<br />
weitesten entfernt liegen. Bei dem Beispiel<br />
in Abb. 4.8 genügt ein Blick, um festzustellen,<br />
dass die Schraube unten links die größte<br />
Schraubenkraft aufnehmen muss.<br />
Abb. 4.8:<br />
Ermittlung der<br />
Schraubenkräfte bei<br />
symmetrischen<br />
Schraubenbildern<br />
23