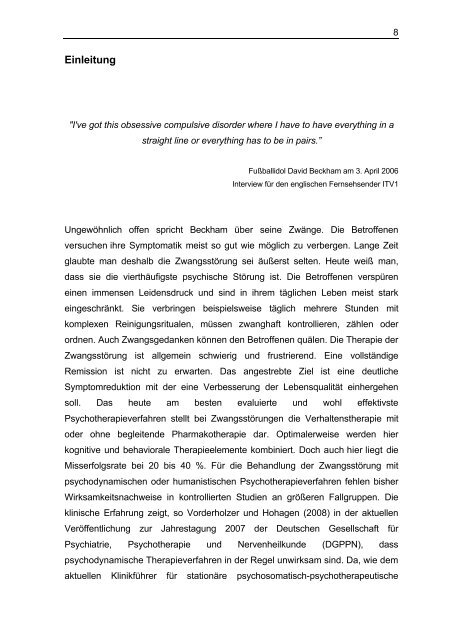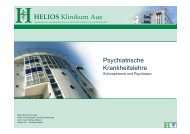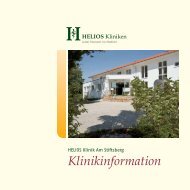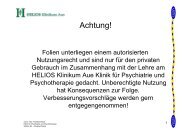Diplomarbeit Nina Kartmann - HELIOS Kliniken GmbH
Diplomarbeit Nina Kartmann - HELIOS Kliniken GmbH
Diplomarbeit Nina Kartmann - HELIOS Kliniken GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung<br />
"I've got this obsessive compulsive disorder where I have to have everything in a<br />
straight line or everything has to be in pairs.”<br />
Fußballidol David Beckham am 3. April 2006<br />
Interview für den englischen Fernsehsender ITV1<br />
Ungewöhnlich offen spricht Beckham über seine Zwänge. Die Betroffenen<br />
versuchen ihre Symptomatik meist so gut wie möglich zu verbergen. Lange Zeit<br />
glaubte man deshalb die Zwangsstörung sei äußerst selten. Heute weiß man,<br />
dass sie die vierthäufigste psychische Störung ist. Die Betroffenen verspüren<br />
einen immensen Leidensdruck und sind in ihrem täglichen Leben meist stark<br />
eingeschränkt. Sie verbringen beispielsweise täglich mehrere Stunden mit<br />
komplexen Reinigungsritualen, müssen zwanghaft kontrollieren, zählen oder<br />
ordnen. Auch Zwangsgedanken können den Betroffenen quälen. Die Therapie der<br />
Zwangsstörung ist allgemein schwierig und frustrierend. Eine vollständige<br />
Remission ist nicht zu erwarten. Das angestrebte Ziel ist eine deutliche<br />
Symptomreduktion mit der eine Verbesserung der Lebensqualität einhergehen<br />
soll. Das heute am besten evaluierte und wohl effektivste<br />
Psychotherapieverfahren stellt bei Zwangsstörungen die Verhaltenstherapie mit<br />
oder ohne begleitende Pharmakotherapie dar. Optimalerweise werden hier<br />
kognitive und behaviorale Therapieelemente kombiniert. Doch auch hier liegt die<br />
Misserfolgsrate bei 20 bis 40 %. Für die Behandlung der Zwangsstörung mit<br />
psychodynamischen oder humanistischen Psychotherapieverfahren fehlen bisher<br />
Wirksamkeitsnachweise in kontrollierten Studien an größeren Fallgruppen. Die<br />
klinische Erfahrung zeigt, so Vorderholzer und Hohagen (2008) in der aktuellen<br />
Veröffentlichung zur Jahrestagung 2007 der Deutschen Gesellschaft für<br />
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), dass<br />
psychodynamische Therapieverfahren in der Regel unwirksam sind. Da, wie dem<br />
aktuellen Klinikführer für stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische<br />
8