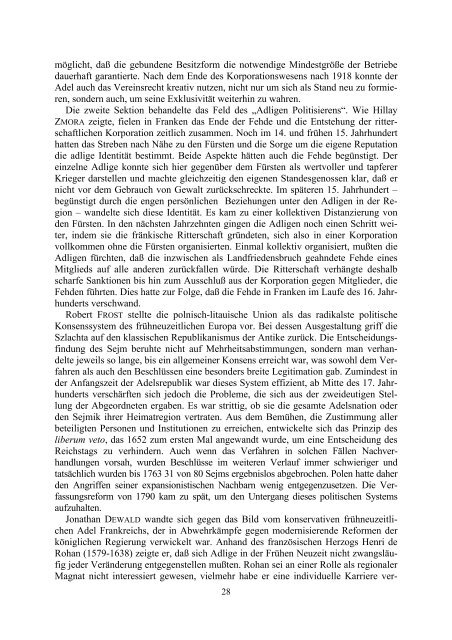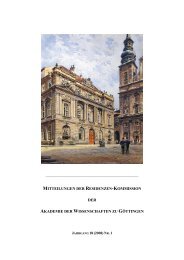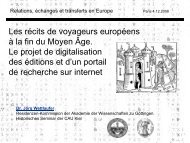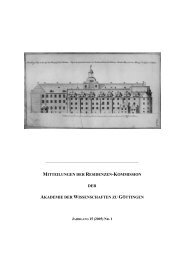mitteilungen der residenzen - Residenzen-Kommission - GWDG
mitteilungen der residenzen - Residenzen-Kommission - GWDG
mitteilungen der residenzen - Residenzen-Kommission - GWDG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
möglicht, daß die gebundene Besitzform die notwendige Mindestgröße <strong>der</strong> Betriebe<br />
dauerhaft garantierte. Nach dem Ende des Korporationswesens nach 1918 konnte <strong>der</strong><br />
Adel auch das Vereinsrecht kreativ nutzen, nicht nur um sich als Stand neu zu formieren,<br />
son<strong>der</strong>n auch, um seine Exklusivität weiterhin zu wahren.<br />
Die zweite Sektion behandelte das Feld des „Adligen Politisierens“. Wie Hillay<br />
ZMORA zeigte, fielen in Franken das Ende <strong>der</strong> Fehde und die Entstehung <strong>der</strong> ritterschaftlichen<br />
Korporation zeitlich zusammen. Noch im 14. und frühen 15. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
hatten das Streben nach Nähe zu den Fürsten und die Sorge um die eigene Reputation<br />
die adlige Identität bestimmt. Beide Aspekte hätten auch die Fehde begünstigt. Der<br />
einzelne Adlige konnte sich hier gegenüber dem Fürsten als wertvoller und tapferer<br />
Krieger darstellen und machte gleichzeitig den eigenen Standesgenossen klar, daß er<br />
nicht vor dem Gebrauch von Gewalt zurückschreckte. Im späteren 15. Jahrhun<strong>der</strong>t –<br />
begünstigt durch die engen persönlichen Beziehungen unter den Adligen in <strong>der</strong> Region<br />
– wandelte sich diese Identität. Es kam zu einer kollektiven Distanzierung von<br />
den Fürsten. In den nächsten Jahrzehnten gingen die Adligen noch einen Schritt weiter,<br />
indem sie die fränkische Ritterschaft gründeten, sich also in einer Korporation<br />
vollkommen ohne die Fürsten organisierten. Einmal kollektiv organisiert, mußten die<br />
Adligen fürchten, daß die inzwischen als Landfriedensbruch geahndete Fehde eines<br />
Mitglieds auf alle an<strong>der</strong>en zurückfallen würde. Die Ritterschaft verhängte deshalb<br />
scharfe Sanktionen bis hin zum Ausschluß aus <strong>der</strong> Korporation gegen Mitglie<strong>der</strong>, die<br />
Fehden führten. Dies hatte zur Folge, daß die Fehde in Franken im Laufe des 16. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
verschwand.<br />
Robert FROST stellte die polnisch-litauische Union als das radikalste politische<br />
Konsenssystem des frühneuzeitlichen Europa vor. Bei dessen Ausgestaltung griff die<br />
Szlachta auf den klassischen Republikanismus <strong>der</strong> Antike zurück. Die Entscheidungsfindung<br />
des Sejm beruhte nicht auf Mehrheitsabstimmungen, son<strong>der</strong>n man verhandelte<br />
jeweils so lange, bis ein allgemeiner Konsens erreicht war, was sowohl dem Verfahren<br />
als auch den Beschlüssen eine beson<strong>der</strong>s breite Legitimation gab. Zumindest in<br />
<strong>der</strong> Anfangszeit <strong>der</strong> Adelsrepublik war dieses System effizient, ab Mitte des 17. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
verschärften sich jedoch die Probleme, die sich aus <strong>der</strong> zweideutigen Stellung<br />
<strong>der</strong> Abgeordneten ergaben. Es war strittig, ob sie die gesamte Adelsnation o<strong>der</strong><br />
den Sejmik ihrer Heimatregion vertraten. Aus dem Bemühen, die Zustimmung aller<br />
beteiligten Personen und Institutionen zu erreichen, entwickelte sich das Prinzip des<br />
liberum veto, das 1652 zum ersten Mal angewandt wurde, um eine Entscheidung des<br />
Reichstags zu verhin<strong>der</strong>n. Auch wenn das Verfahren in solchen Fällen Nachverhandlungen<br />
vorsah, wurden Beschlüsse im weiteren Verlauf immer schwieriger und<br />
tatsächlich wurden bis 1763 31 von 80 Sejms ergebnislos abgebrochen. Polen hatte daher<br />
den Angriffen seiner expansionistischen Nachbarn wenig entgegenzusetzen. Die Verfassungsreform<br />
von 1790 kam zu spät, um den Untergang dieses politischen Systems<br />
aufzuhalten.<br />
Jonathan DEWALD wandte sich gegen das Bild vom konservativen frühneuzeitlichen<br />
Adel Frankreichs, <strong>der</strong> in Abwehrkämpfe gegen mo<strong>der</strong>nisierende Reformen <strong>der</strong><br />
königlichen Regierung verwickelt war. Anhand des französischen Herzogs Henri de<br />
Rohan (1579-1638) zeigte er, daß sich Adlige in <strong>der</strong> Frühen Neuzeit nicht zwangsläufig<br />
je<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung entgegenstellen mußten. Rohan sei an einer Rolle als regionaler<br />
Magnat nicht interessiert gewesen, vielmehr habe er eine individuelle Karriere ver-<br />
28