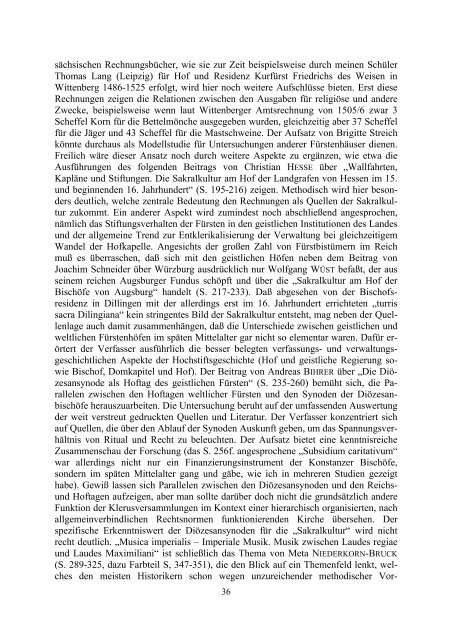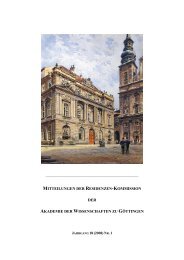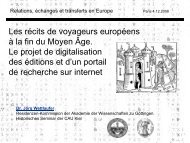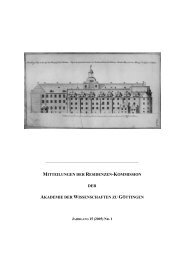mitteilungen der residenzen - Residenzen-Kommission - GWDG
mitteilungen der residenzen - Residenzen-Kommission - GWDG
mitteilungen der residenzen - Residenzen-Kommission - GWDG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sächsischen Rechnungsbücher, wie sie zur Zeit beispielsweise durch meinen Schüler<br />
Thomas Lang (Leipzig) für Hof und Residenz Kurfürst Friedrichs des Weisen in<br />
Wittenberg 1486-1525 erfolgt, wird hier noch weitere Aufschlüsse bieten. Erst diese<br />
Rechnungen zeigen die Relationen zwischen den Ausgaben für religiöse und an<strong>der</strong>e<br />
Zwecke, beispielsweise wenn laut Wittenberger Amtsrechnung von 1505/6 zwar 3<br />
Scheffel Korn für die Bettelmönche ausgegeben wurden, gleichzeitig aber 37 Scheffel<br />
für die Jäger und 43 Scheffel für die Mastschweine. Der Aufsatz von Brigitte Streich<br />
könnte durchaus als Modellstudie für Untersuchungen an<strong>der</strong>er Fürstenhäuser dienen.<br />
Freilich wäre dieser Ansatz noch durch weitere Aspekte zu ergänzen, wie etwa die<br />
Ausführungen des folgenden Beitrags von Christian HESSE über „Wallfahrten,<br />
Kapläne und Stiftungen. Die Sakralkultur am Hof <strong>der</strong> Landgrafen von Hessen im 15.<br />
und beginnenden 16. Jahrhun<strong>der</strong>t“ (S. 195-216) zeigen. Methodisch wird hier beson<strong>der</strong>s<br />
deutlich, welche zentrale Bedeutung den Rechnungen als Quellen <strong>der</strong> Sakralkultur<br />
zukommt. Ein an<strong>der</strong>er Aspekt wird zumindest noch abschließend angesprochen,<br />
nämlich das Stiftungsverhalten <strong>der</strong> Fürsten in den geistlichen Institutionen des Landes<br />
und <strong>der</strong> allgemeine Trend zur Entklerikalisierung <strong>der</strong> Verwaltung bei gleichzeitigem<br />
Wandel <strong>der</strong> Hofkapelle. Angesichts <strong>der</strong> großen Zahl von Fürstbistümern im Reich<br />
muß es überraschen, daß sich mit den geistlichen Höfen neben dem Beitrag von<br />
Joachim Schnei<strong>der</strong> über Würzburg ausdrücklich nur Wolfgang WÜST befaßt, <strong>der</strong> aus<br />
seinem reichen Augsburger Fundus schöpft und über die „Sakralkultur am Hof <strong>der</strong><br />
Bischöfe von Augsburg“ handelt (S. 217-233). Daß abgesehen von <strong>der</strong> Bischofsresidenz<br />
in Dillingen mit <strong>der</strong> allerdings erst im 16. Jahrhun<strong>der</strong>t errichteten „turris<br />
sacra Dilingiana“ kein stringentes Bild <strong>der</strong> Sakralkultur entsteht, mag neben <strong>der</strong> Quellenlage<br />
auch damit zusammenhängen, daß die Unterschiede zwischen geistlichen und<br />
weltlichen Fürstenhöfen im späten Mittelalter gar nicht so elementar waren. Dafür erörtert<br />
<strong>der</strong> Verfasser ausführlich die besser belegten verfassungs- und verwaltungsgeschichtlichen<br />
Aspekte <strong>der</strong> Hochstiftsgeschichte (Hof und geistliche Regierung sowie<br />
Bischof, Domkapitel und Hof). Der Beitrag von Andreas BIHRER über „Die Diözesansynode<br />
als Hoftag des geistlichen Fürsten“ (S. 235-260) bemüht sich, die Parallelen<br />
zwischen den Hoftagen weltlicher Fürsten und den Synoden <strong>der</strong> Diözesanbischöfe<br />
herauszuarbeiten. Die Untersuchung beruht auf <strong>der</strong> umfassenden Auswertung<br />
<strong>der</strong> weit verstreut gedruckten Quellen und Literatur. Der Verfasser konzentriert sich<br />
auf Quellen, die über den Ablauf <strong>der</strong> Synoden Auskunft geben, um das Spannungsverhältnis<br />
von Ritual und Recht zu beleuchten. Der Aufsatz bietet eine kenntnisreiche<br />
Zusammenschau <strong>der</strong> Forschung (das S. 256f. angesprochene „Subsidium caritativum“<br />
war allerdings nicht nur ein Finanzierungsinstrument <strong>der</strong> Konstanzer Bischöfe,<br />
son<strong>der</strong>n im späten Mittelalter gang und gäbe, wie ich in mehreren Studien gezeigt<br />
habe). Gewiß lassen sich Parallelen zwischen den Diözesansynoden und den Reichs-<br />
und Hoftagen aufzeigen, aber man sollte darüber doch nicht die grundsätzlich an<strong>der</strong>e<br />
Funktion <strong>der</strong> Klerusversammlungen im Kontext einer hierarchisch organisierten, nach<br />
allgemeinverbindlichen Rechtsnormen funktionierenden Kirche übersehen. Der<br />
spezifische Erkenntniswert <strong>der</strong> Diözesansynoden für die „Sakralkultur“ wird nicht<br />
recht deutlich. „Musica imperialis – Imperiale Musik. Musik zwischen Laudes regiae<br />
und Laudes Maximiliani“ ist schließlich das Thema von Meta NIEDERKORN-BRUCK<br />
(S. 289-325, dazu Farbteil S, 347-351), die den Blick auf ein Themenfeld lenkt, welches<br />
den meisten Historikern schon wegen unzureichen<strong>der</strong> methodischer Vor-<br />
36