Mo.-Fr. 7.30 – 12.00 Uhr und Mo., Di., Do. 15.00 - Wilhelmshavener ...
Mo.-Fr. 7.30 – 12.00 Uhr und Mo., Di., Do. 15.00 - Wilhelmshavener ...
Mo.-Fr. 7.30 – 12.00 Uhr und Mo., Di., Do. 15.00 - Wilhelmshavener ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 20 · <strong>Wilhelmshavener</strong> Zeitung<br />
Gester n<br />
<strong>und</strong>Heute<br />
präsentiert vom<br />
30. Juni 2012<br />
Noch immer nennen die Italiener den ehemaligen <strong>Wilhelmshavener</strong> Schwimmkran offiziell „Langer Heinrich“. Er reckt sich im<br />
GenueserHafenalstechnisches DenkmalvordieHafensilhouette. FOTO: PRIVAT<br />
SeeleutesahenalsErstesden„Heinrich“<br />
Fortsetzung von Seite 19<br />
ehemaligen Tanker, kamen die<br />
ersten vier Brücken an die Jade.<br />
Schon einmal zählte ein<br />
Kran zu den Wahrzeichen Wilhelmshavens.<br />
1915 bis 1944<br />
reckte sich hier der „Lange<br />
Heinrich“, der damals weltgrößte<br />
Schwimmkran, 83 Meter<br />
hoch in den Himmel an der Jade.<br />
Als technisches Denkmal<br />
steht er heute in Genua, wo er<br />
zwischen 2005 <strong>und</strong> 2008 aufwändig<br />
restauriert <strong>und</strong> heute in<br />
hohen Ehren gehalten wird. Er<br />
ist dort in den vergangenen 20<br />
Jahren zum Wahrzeichen des<br />
Hafens geworden, wird täglich<br />
von etlichen Besuchern der<br />
Stadt besichtigt <strong>und</strong> bietet in<br />
seinem „Ruhestand“ für manche<br />
spektakuläre künstlerische<br />
<strong>und</strong> artistische Vorstellung eine<br />
imposante Kulisse.<br />
Vor dem zweiten Weltkrieg<br />
zählte der Schwimmkran zu den<br />
höchsten Bauwerken der Stadt.<br />
Ihn sahen die Seeleute mit als<br />
Erstes, wenn sie Kurs auf Wilhelmshaven<br />
nahmen.<br />
Der „Lange Heinrich“ tat sei-<br />
nen <strong>Di</strong>enst mit der offiziellen<br />
Bezeichnung „Großer<br />
Schwimmkran I“. Er war der<br />
zweite Schwergewichtsheber im<br />
<strong>Wilhelmshavener</strong> Hafen <strong>und</strong><br />
löste den 1886 gebauten Scherenkran<br />
ab, der den gestiegenen<br />
Ansprüchen von Marine<br />
<strong>und</strong> Schiffbau nicht mehr genügt<br />
hatte. Auch diesen ersten<br />
Schwimmkran nannte der<br />
Volksm<strong>und</strong> bereits „Langer<br />
Heinrich“. Übrigens gab es<br />
auch in Rostock einen großen<br />
Schwimmkran, dem man denselben<br />
Spitznamen gegeben<br />
hatte. Auf die <strong>Fr</strong>age, wie es zu<br />
dieser Kran-Bezeichnung gekommen<br />
ist, fand sich bei den<br />
Recherchen zu diesem Artikel<br />
keine Antwort. Vielleicht weiß<br />
ein Leser sie.<br />
Der heutige Genueser „Heinrich“<br />
wurde von der Deutschen<br />
Maschinenfabrik AG (DEMAG)<br />
Duisburg (heute Mannesmann)<br />
1913 bis 1915 gebaut <strong>und</strong> auf<br />
einen von der AG Weser in Bremen<br />
gefertigten Schwimmponton<br />
gestellt. Bis 1935 war er<br />
mit 250 Tonnen Tragkraft der<br />
größte Kran der Welt, dann lie-<br />
fen ihm noch größere DEMAG-<br />
Krane für Brest, Kalifornien <strong>und</strong><br />
den Panama-Kanal mit bis zu<br />
400 Tonnen Hebekraft den<br />
Rang ab.<br />
Der „Heinrich“-Ponton misst<br />
50,4 mal 30,8 mal 3 Meter <strong>und</strong><br />
verdrängt bis zu 4000 Tonnen<br />
Wasser. Ursprünglich wurde er<br />
durch zwei Dampfmaschinen<br />
angetrieben, die später durch<br />
vier Sechszylinder-<strong>Di</strong>eselmotoren<br />
ersetzt wurden. Es gibt fünf<br />
elektrische Hebewerke von 10<br />
t, 20 t, 50 t <strong>und</strong> zwei mal 125 t,<br />
die über eine Traverse zu 250 t<br />
Tragkraft gekoppelt werden können.<br />
Im Gleichgewicht bleibt der<br />
Kran durch regulierbare Gegengewichte<br />
im eigentlichen Kran<br />
<strong>und</strong> flutbare Ballastkammern<br />
im Ponton.<br />
Nach dem verlorenen Ersten<br />
Weltkrieg hätte „Heinrich“<br />
eigentlich gemäß den Bestimmungen<br />
des Versailler Vertrages<br />
an die Siegermächte ausgeliefert<br />
werden sollen. Weil er<br />
als nicht seetauglich eingestuft<br />
wurde, blieb er in Wilhelmshaven.<br />
1938 übernahm Kapitän<br />
Eduard Steinmeyer für die<br />
nächsten 20 Jahre das Kommando<br />
auf dem „Kraftmeier“.<br />
Wenn man John Asmussen<br />
<strong>und</strong> seiner seiner Website<br />
www.bismarck-class.dk Glauben<br />
schenken kann, verabschiedete<br />
sich das Werft-Wahrzeichen<br />
am 10. Mai 1944 endgültig<br />
aus Wilhelmshaven Richtung<br />
Bremerhaven <strong>und</strong> Bremen,<br />
um Schiffswracks zu heben <strong>und</strong><br />
andere kriegsbedingte Aufräumarbeiten<br />
zu erledigen. Bei<br />
Kriegsende stand er in Nordenham,<br />
wo ihn die Amerikaner<br />
konfiszierten.<br />
Acht Jahre später charterte<br />
ihn die B<strong>und</strong>esrepublik für<br />
einen symbolischen <strong>Do</strong>llar. <strong>Di</strong>e<br />
„<strong>Wilhelmshavener</strong> Zeitung“ berichtete<br />
am 3. Mai 1958 von<br />
der Übergabe:<br />
„Bis 1939 war der Kran eins<br />
der markantesten Wahrzeichen<br />
Wilhelmshavens. Am 1. Juni<br />
1945 übernahmen die USA den<br />
Giganten in Nordenham als<br />
Beutegut . . . 1950 kam er nach<br />
Bremerhaven, wo er jahrelang<br />
viele h<strong>und</strong>erttausend Tonnen<br />
Fortsetzung auf Seite 21



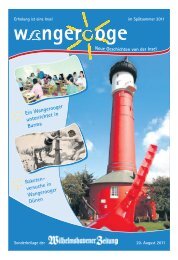
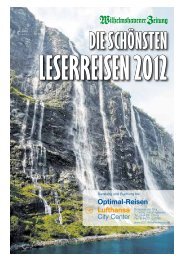

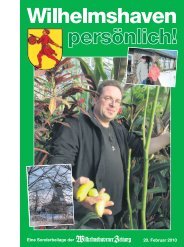
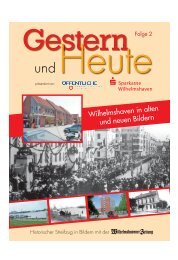
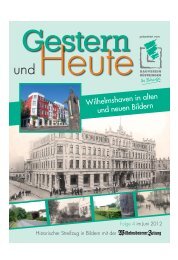





![WZ102: WZ-BEILAGEN [BEILAGE1 -1 ] ... 13.](https://img.yumpu.com/455237/1/174x260/wz102-wz-beilagen-beilage1-1-13.jpg?quality=85)

