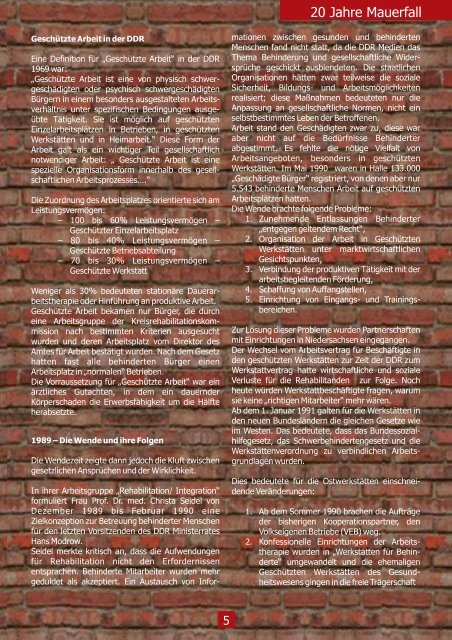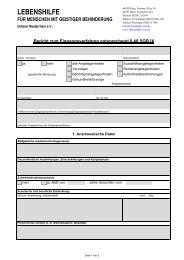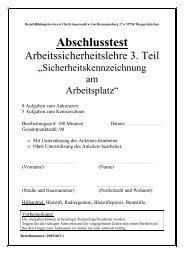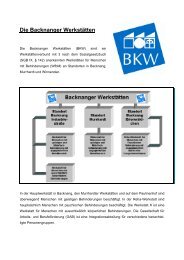20 Jahre - aktionbildung
20 Jahre - aktionbildung
20 Jahre - aktionbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Geschützte Arbeit in der DDR<br />
Eine Definition für „Geschützte Arbeit“ in der DDR<br />
1969 war:<br />
„Geschützte Arbeit ist eine von physisch schwergeschädigten<br />
oder psychisch schwergeschädigten<br />
Bürgern in einem besonders ausgestalteten Arbeitsverhältnis<br />
unter spezifischen Bedingungen ausgeübte<br />
Tätigkeit. Sie ist möglich auf geschützten<br />
Einzelarbeitsplätzen in Betrieben, in geschützten<br />
Werkstätten und in Heimarbeit.“ Diese Form der<br />
Arbeit galt als ein wichtiger Teil gesellschaftlich<br />
notwendiger Arbeit: „ Geschützte Arbeit ist eine<br />
spezielle Organisationsform innerhalb des gesellschaftlichen<br />
Arbeitsprozesses….“<br />
Die Zuordnung des Arbeitsplatzes orientierte sich am<br />
Leistungsvermögen:<br />
– 100 bis 60% Leistungsvermögen –<br />
Geschützter Einzelarbeitsplatz<br />
– 80 bis 40% Leistungsvermögen –<br />
Geschützte Betriebsabteilung<br />
– 70 bis 30% Leistungsvermögen –<br />
Geschützte Werkstatt<br />
Weniger als 30% bedeuteten stationäre Dauerarbeitstherapie<br />
oder Hinführung an produktive Arbeit.<br />
Geschützte Arbeit bekamen nur Bürger, die durch<br />
eine Arbeitsgruppe der Kreisrehabilitationskommission<br />
nach bestimmten Kriterien ausgesucht<br />
wurden und deren Arbeitsplatz vom Direktor des<br />
Amtes für Arbeit bestätigt wurden. Nach dem Gesetz<br />
hatten fast alle behinderten Bürger einen<br />
Arbeitsplatz in „normalen“ Betrieben.<br />
Die Vorraussetzung für „Geschützte Arbeit“ war ein<br />
ärztliches Gutachten, in dem ein dauernder<br />
Körperschaden die Erwerbsfähigkeit um die Hälfte<br />
herabsetzte.<br />
1989 – Die Wende und ihre Folgen<br />
Die Wendezeit zeigte dann jedoch die Kluft zwischen<br />
gesetzlichen Ansprüchen und der Wirklichkeit.<br />
In ihrer Arbeitsgruppe „Rehabilitation/ Integration“<br />
formuliert Frau Prof. Dr. med. Christa Seidel von<br />
Dezember 1989 bis Februar 1990 eine<br />
Zielkonzeption zur Betreuung behinderter Menschen<br />
für den letzten Vorsitzenden des DDR Ministerrates<br />
Hans Modrow.<br />
Seidel merkte kritisch an, dass die Aufwendungen<br />
für Rehabilitation nicht den Erfordernissen<br />
entsprachen. Behinderte Mitarbeiter wurden mehr<br />
geduldet als akzeptiert. Ein Austausch von Infor-<br />
5<br />
<strong>20</strong> <strong>Jahre</strong> Mauerfall<br />
mationen zwischen gesunden und behinderten<br />
Menschen fand nicht statt, da die DDR Medien das<br />
Thema Behinderung und gesellschaftliche Widersprüche<br />
geschickt ausblendeten. Die staatlichen<br />
Organisationen hätten zwar teilweise die soziale<br />
Sicherheit, Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten<br />
realisiert; diese Maßnahmen bedeuteten nur die<br />
Anpassung an gesellschaftliche Normen, nicht ein<br />
selbstbestimmtes Leben der Betroffenen.<br />
Arbeit stand den Geschädigten zwar zu, diese war<br />
aber nicht auf die Bedürfnisse Behinderter<br />
abgestimmt. Es fehlte die nötige Vielfalt von<br />
Arbeitsangeboten, besonders in geschützten<br />
Werkstätten. Im Mai 1990 waren in Halle 133.000<br />
„Geschädigte Bürger“ registriert, von denen aber nur<br />
5.543 behinderte Menschen Arbeit auf geschützten<br />
Arbeitsplätzen hatten.<br />
Die Wende brachte folgende Probleme:<br />
1. Zunehmende Entlassungen Behinderter<br />
„entgegen geltendem Recht“,<br />
2. Organisation der Arbeit in Geschützten<br />
Werkstätten unter marktwirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten,<br />
3. Verbindung der produktiven Tätigkeit mit der<br />
arbeitsbegleitenden Förderung,<br />
4. Schaffung von Auffangstellen,<br />
5. Einrichtung von Eingangs- und Trainingsbereichen.<br />
Zur Lösung dieser Probleme wurden Partnerschaften<br />
mit Einrichtungen in Niedersachsen eingegangen.<br />
Der Wechsel vom Arbeitsvertrag für Beschäftigte in<br />
den geschützten Werkstätten zur Zeit der DDR zum<br />
Werkstattvertrag hatte wirtschaftliche und soziale<br />
Verluste für die Rehabilitanden zur Folge. Noch<br />
heute würden Werkstattbeschäftigte fragen, warum<br />
sie keine „richtigen Mitarbeiter“ mehr wären.<br />
Ab dem 1. Januar 1991 galten für die Werkstätten in<br />
den neuen Bundesländern die gleichen Gesetze wie<br />
im Westen. Das bedeutete, dass das Bundessozialhilfegesetz,<br />
das Schwerbehindertengesetz und die<br />
Werkstättenverordnung zu verbindlichen Arbeitsgrundlagen<br />
wurden.<br />
Dies bedeutete für die Ostwerkstätten einschneidende<br />
Veränderungen:<br />
1. Ab dem Sommer 1990 brachen die Aufträge<br />
der bisherigen Kooperationspartner, den<br />
Volkseigenen Betriebe (VEB) weg.<br />
2. Konfessionelle Einrichtungen der Arbeitstherapie<br />
wurden in „Werkstätten für Behinderte“<br />
umgewandelt und die ehemaligen<br />
Geschützten Werkstätten des Gesundheitswesens<br />
gingen in die freie Trägerschaft