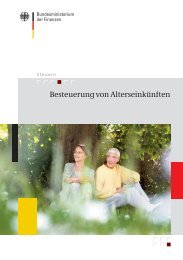Das Wichtigste auf einem Blick - Eureka24.de
Das Wichtigste auf einem Blick - Eureka24.de
Das Wichtigste auf einem Blick - Eureka24.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
■ Pflegestufe II oder III<br />
■ GdB von mindestens 60 oder Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens<br />
60 v. H.<br />
■ Es muss eine kontinuierliche medizinische Versorgung erforderlich sein, ohne<br />
die eine lebensbedrohende Verschlimmerung der Lebenserwartung oder eine<br />
dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die auslösende Krankheit<br />
zu erwarten ist.<br />
Über die Befreiung von Zuzahlungen (einschl. Praxisgebühr) stellt die Krankenkasse<br />
einen entsprechenden Ausweis aus, der dem Apotheker, Krankengymnasten usw.<br />
vorzulegen ist.<br />
7. Beiträge, Beitragszuschüsse<br />
Im Gegensatz zum Kapitaldeckungsverfahren (aus Rückstellungen für zu erwartende<br />
Kosten) der PKV finanziert sich die GKV aus an ihren Aufwendungen ausgerichteten<br />
Beiträgen der Versicherten, die sich zumeist nach der Höhe von Lohn und Rente bemessen.<br />
Alter, Geschlecht und gesundheitliches Risiko sind unerheblich. Ist ein Mitglied<br />
mit der Zahlung des Zusatzbeitrags im Rückstand, hat die Krankenkasse zusätzlich<br />
einen Verspätungszuschlag zu erheben.<br />
Beitragspflichtige Einnahmen sind:<br />
a) bei versicherungspflichtig Beschäftigten: das Arbeitsentgelt, die Rente sowie<br />
die der Rente vergleichbaren Einnahmen (Versorgungsbezüge)<br />
b) bei freiwilligen Mitgliedern: alle die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />
des Versicherten ausmachenden Einnahmen (somit auch Einnahmen aus<br />
Vermietung sowie aus Kapitalvermögen, gesetzliche Renten, Betriebsrenten,<br />
Versorgungsbezüge, Abfindungen, Einmalzahlungen aus einer privaten Rentenversicherung<br />
– verteilt <strong>auf</strong> angenommene Monatsrenten –, gewerbliche<br />
und freiberufliche Einkünfte), im Einzelnen geregelt durch die Satzung der<br />
betreffenden Krankenkasse<br />
c) bei versicherungspflichtigen Rentnern: die Rente, die der Rente vergleichbaren<br />
Einnahmen (Versorgungsbezüge) sowie das Arbeitseinkommen<br />
Diese werden in allen Fällen begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze (→ Bemessungsgrenzen).<br />
Es sind zu unterscheiden:<br />
a) der allgemeine Beitragssatz (für Mitglieder, die bei Arbeitsunfähigkeit für<br />
mindestens sechs Wochen Anspruch <strong>auf</strong> Lohnfortzahlung haben)<br />
b) der erhöhte Beitragssatz (für Mitglieder, die den unter Buchst. a erwähnten<br />
Anspruch nicht haben)<br />
c) der ermäßigte Beitragssatz für Wehr- und Zivildienstleistende sowie Studenten<br />
d) der kassenindividuelle Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V)<br />
Für die Bemessung der Beiträge aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen gilt<br />
auch für freiwillig Versicherte der allgemeine Beitragssatz der Krankenkasse.<br />
Den Beitrag für versicherungspflichtig Beschäftigte tragen die Beschäftigten und ihre<br />
Arbeitgeber je zur Hälfte; in Ausnahmefällen (z. B. bei geringfügiger Beschäftigung)<br />
trägt der Arbeitgeber den Beitrag allein. Der bei Pflichtversicherten <strong>auf</strong> die Rente<br />
entfallende Beitrag wird von diesem und dem Rentenversicherungsträger je zur Hälfte<br />
getragen; die <strong>auf</strong> Versorgungsbezüge entfallenden Beiträge trägt der Versorgungsempfänger<br />
allein. Freiwillige Mitglieder tragen ihren Beitrag ebenfalls allein, ggf. unter<br />
Gewährung eines Beitragszuschusses. Für mitversicherte Familienangehörige werden<br />
keine Beiträge erhoben.<br />
© WALHALLA FACHVERLAG<br />
17