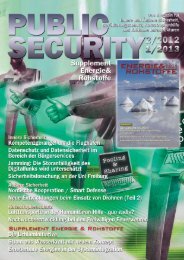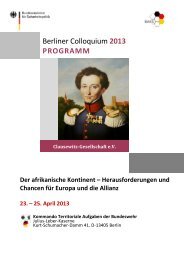1-2013 - Public Security
1-2013 - Public Security
1-2013 - Public Security
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fluss-Strom: Strom aus kinetischer Wasserkraft<br />
Anders als seine traditionellen Vorläufer wie die Hammermühlen, die an Elbe und<br />
Donau verbreitet waren, wandelt das Kleinst-Wasserkraftwerk kinetische Energie nicht<br />
in mechanische (Pump-) Energie, sondern in elektrischen Strom. Aufgrund zusätzlicher<br />
Kosten, aber insbesondere auch für eine kommerzielle Nutzung der elektrischen Energie,<br />
muss das Gerät eine Mindestleistung erbringen, um rentabel und sinnvoll arbeiten<br />
zu können. Die Rentabilität wurde über den Zielpreis von 24 € Cent / kWh und eine Amortisationsdauer<br />
von 4 Jahren definiert – unter der Annahme von Eigenleistung wurden Installationskosten<br />
nicht berücksichtigt. (24 Cent entsprechen aktuell auch den Kosten<br />
einer Kilowattstunde inkl. Netz und Steuern für einen Privathaushalt in Deutschland.)<br />
Die untere Leistungsgrenze von 1,5 kW ist zunächst nur über einen sinnvollen Anwendungsfall<br />
definiert. Es muss gezeigt werden, dass sich diese Leistung mit einer kostengünstigen<br />
Anlage auch bei „normalen“ Fließeigenschaften umsetzen lässt. Die kinetische<br />
Energie eines Flusses ergibt sich aus der durchströmten Fläche, der Dichte des<br />
Wassers und der Fließgeschwindigkeit. Die Fließgeschwindigkeit geht in diese Formel<br />
mit der dritten Potenz ein. Diese kinetische Energie kann nach der Betz‘schen Formel<br />
analog zum Wind nur zu knapp 60% genutzt werden. Bei einem Rotordurchmesser von<br />
1,0 m und einer mittleren Fließgeschwindigkeit von 1,5 m/s (5,4 km / h) ergibt sich eine<br />
nutzbare kinetische Energie von ca. 1 kW. Da selbst schiffbare Flüsse wie die Elbe<br />
oder der Rhein außerhalb der Schifffahrtsrinne bei Niedrigwasser oft nicht tiefer als 2<br />
m sind, kann der Rotordurchmesser nicht wesentlich größer als 1 m gewählt werden.<br />
Um die Ziel-Leistung auch bei möglichst geringen Fließgeschwindigkeiten trotzdem zu<br />
erreichen, muss also ein Diffusor, eine umgekehrte Düse, verwendet werden. Durch den<br />
erzeugten „Sog“ (siehe Grafik) wird die Kraft auf dem Rotor optimiert.<br />
Die Wirkung des Diffusors ist über das Verhältnis von Durchmesser an Eingangsund<br />
Ausgangsseite definiert. Da der Anstellwinkel im Diffusor 7% zur Vermeidung von<br />
Strömungsabriss nicht überschreiten soll, ist die Effizienz über die Länge limitiert. Mit<br />
Blick auf hohe Transportkosten sollte das Gerät kompakt gehalten werden, so dass zu<br />
einem technischen Trick gegriffen wurde: Der Diffusor ist in drei Teilen gebaut, die ineinander<br />
gesteckt sind und deren Übergang durchströmte Spalte bilden. Durch den Strömungsfluss<br />
im Übergang kann der Anstellwinkel erhöht und der Diffusor bei gleichem<br />
Durchmesser auf der Ausgangseite wesentlich kürzer gehalten werden. Zugleich erlaubt<br />
diese Bauweise, die drei Kunststoff-Teile des Diffusors kostengünstig aus einem Stück<br />
im Roto Guss Verfahren herzustellen.<br />
Auch wenn bei der Entwicklung die Empfehlungen der Internationalen Energieagentur<br />
bzgl. maximaler Rotorumdrehung und die Vorgaben des Deutschen Wasserrechtes<br />
bzgl. der verwendeten Materialien eingehalten wurden, so verlaufen die Genehmigungsverfahren<br />
in Deutschland (noch) sehr unterschiedlich. Die Dauer zur Erlangung einer<br />
Genehmigung (für einen befristeten Testbetrieb) variiert in Deutschland von vier Wochen<br />
bis aktuell vier Monate.<br />
Die kinetische Wasserkraft erlaubt wie Photovoltaik und Windenergie die Stromerzeugung<br />
aus erneuerbaren Quellen. Die Grundlast-Fähigkeit der Wasserkraft macht sie<br />
zu einer echten Alternative für dezentrale Energieerzeugung – nicht nur in den Ländern<br />
mit niedriger Elektrifizierungsquote. Seit September 2011 laufen erste Referenzanlagen.<br />
Peru hat diese Kleinst-Wasserkraftwerke im Mai 2012 als mögliche Technologie in seinen<br />
nationalen Energieplan aufgenommen hat. In Deutschland wurde im Juni 2012 eine<br />
erste kommerzielle Installation von 30 Turbinen im Rhein genehmigt.<br />
Vor der Turbine ist ein Fischabweiser monitert<br />
Rhein gesetzt und wie eine Boje oder ein Ponton verankert<br />
werden kann. Die Partner haben einen Standort im Rhein in<br />
Bonn identifiziert, an dem die gesamte gewonnene regenerative<br />
Energie in eine Ladestation für Elektrofahrzeuge und<br />
der Überschuss Strom in das lokale Stromnetz von SWB<br />
Energie und Wasser eingespeist werden.<br />
Die Turbine besteht aus einem aus Polyethylen gefertigten<br />
Schwimmkörper. Dieser ist 147 cm lang, 174 cm breit<br />
und 198 cm hoch. Das Gewicht der Turbine beträgt leer ca.<br />
340 kg. Zur Installation wird die Turbine auf das Wasser gehoben<br />
und dann wird der Schwimmkörper solange mit Wasser<br />
gefüllt bis Diffusor mit Rotor vollständig untergetaucht<br />
ist. Die optimale Schwimmlage ist damit erreicht.<br />
Die Turbine selbst benötigt keine externe Stromversorgung,<br />
so dass nur ein stromführendes Kabel an Land verlegt<br />
werden muss. Für den Fall, dass dieses Stromkabel<br />
reißt oder beschädigt wird, schaltet eine Sicherung den Generator<br />
ab. Die Rotorblätter drehen zwar weiter, aber es<br />
fließt kein Strom mehr, eine Überhitzung sowie die Gefahr<br />
des Stromschlags ist damit ausgeschlossen. Der Generator<br />
befindet sich auf der Rotorachse und liegt damit beim<br />
Betrieb der Turbine permanent unter Wasser. Durch diese<br />
Konstruktion wird erreicht, dass er vom vorbeifließenden<br />
Wasser des Rheins permanent gekühlt wird.<br />
Zweifache Dichtungen an der Achse schützen den Generator<br />
vor Wassereintritt. Der Rotor selbst besteht aus drei<br />
Flügeln. Im Interesse eines besseren Fischschutzes, dreht<br />
sich der Generator langsam. Bei voller Auslastung kommt<br />
er theoretisch auf eine maximale Drehzahl von 230 Umdrehungen<br />
pro Minute Bei einer Strömungsgeschwindigkeit<br />
des Rheins von 1 - 1,5 m/s ist dort mit einer Rotorgeschwindigkeit<br />
von maximal 67 bis 111 Umdrehungen pro Minute<br />
zu rechnen. Da sich alle beweglichen Teile der Turbine<br />
unter Wasser befinden, geht von der Turbine im ordnungsgemäßen<br />
Betrieb keine Lärmbelästigung aus.<br />
Die Partner streben an, die Turbine bis Ende des Jahres<br />
im Rhein zu installieren. Ab <strong>2013</strong> wird dieses Pilotprojekt<br />
das Zusammenspiel von Elektromobilität und lokal erzeugtem<br />
Strom aus Wasserkraft zeigen und auch untersuchen,<br />
wie kleine, dezentrale Erzeugungsanlagen ins Stromnetz<br />
integriert werden können. ➛<br />
ENERGIE & ROHSTOFFE 2-2012 / 1-<strong>2013</strong> 57