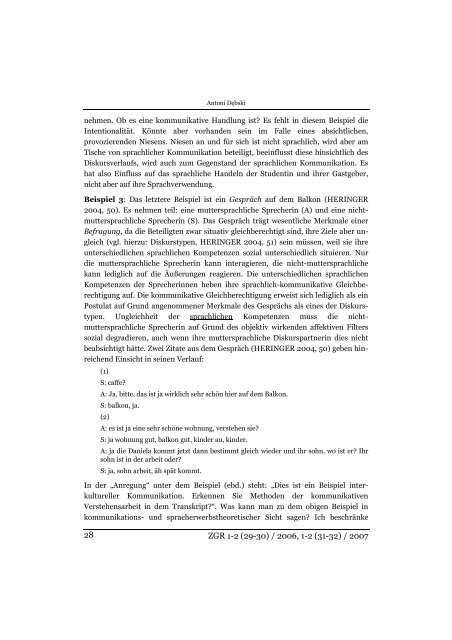ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Antoni Dębski<br />
nehmen. Ob es eine kommunikative Handlung ist? Es fehlt in diesem Beispiel die<br />
Intentionalität. Könnte aber vorhanden sein im Falle eines absichtlichen,<br />
provozierenden Niesens. Niesen an und für sich ist nicht sprachlich, wird aber am<br />
Tische von sprachlicher Kommunikation beteiligt, beeinflusst diese hinsichtlich des<br />
Diskursverlaufs, wird auch zum Gegenstand der sprachlichen Kommunikation. Es<br />
hat also Einfluss auf das sprachliche Handeln der Studentin und ihrer Gastgeber,<br />
nicht aber auf ihre Sprachverwendung.<br />
Beispiel 3: Das letztere Beispiel ist ein Gespräch auf dem Balkon (HERINGER<br />
2004, 50). Es nehmen teil: eine muttersprachliche Sprecherin (A) und eine nichtmuttersprachliche<br />
Sprecherin (S). Das Gespräch trägt wesentliche Merkmale einer<br />
Befragung, da die Beteiligten zwar situativ gleichberechtigt sind, ihre Ziele aber ungleich<br />
(vgl. hierzu: Diskurstypen, HERINGER 2004, 51) sein müssen, weil sie ihre<br />
unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen sozial unterschiedlich situieren. Nur<br />
die muttersprachliche Sprecherin kann interagieren, die nicht-muttersprachliche<br />
kann lediglich auf die Äußerungen reagieren. Die unterschiedlichen sprachlichen<br />
Kompetenzen der Sprecherinnen heben ihre sprachlich-kommunikative Gleichberechtigung<br />
auf. Die kommunikative Gleichberechtigung erweist sich lediglich als ein<br />
Postulat auf Grund angenommener Merkmale des Gesprächs als eines der Diskurstypen.<br />
Ungleichheit der sprachlichen Kompetenzen muss die nichtmuttersprachliche<br />
Sprecherin auf Grund des objektiv wirkenden affektiven Filters<br />
sozial degradieren, auch wenn ihre muttersprachliche Diskurspartnerin dies nicht<br />
beabsichtigt hätte. Zwei Zitate aus dem Gespräch (HERINGER 2004, 50) geben hinreichend<br />
Einsicht in seinen Verlauf:<br />
28<br />
(1)<br />
S: caffe?<br />
A: Ja, bitte, das ist ja wirklich sehr schön hier auf dem Balkon.<br />
S: balkon, ja.<br />
(2)<br />
A: es ist ja eine sehr schöne wohnung, verstehen sie?<br />
S: ja wohnung gut, balkon gut, kinder au, kinder.<br />
A: ja die Daniela kommt jetzt dann bestimmt gleich wieder und ihr sohn, wo ist er? Ihr<br />
sohn ist in der arbeit oder?<br />
S: ja, sohn arbeit, äh spät kommt.<br />
In der „Anregung“ unter dem Beispiel (ebd.) steht: „Dies ist ein Beispiel interkultureller<br />
Kommunikation. Erkennen Sie Methoden der kommunikativen<br />
Verstehensarbeit in dem Transkript?“. Was kann man zu dem obigen Beispiel in<br />
kommunikations- und spracherwerbstheoretischer Sicht sagen? Ich beschränke<br />
<strong>ZGR</strong> 1-2 (<strong>29</strong>-<strong>30</strong>) / <strong>2006</strong>, 1-2 (<strong>31</strong>-<strong>32</strong>) / <strong>2007</strong>