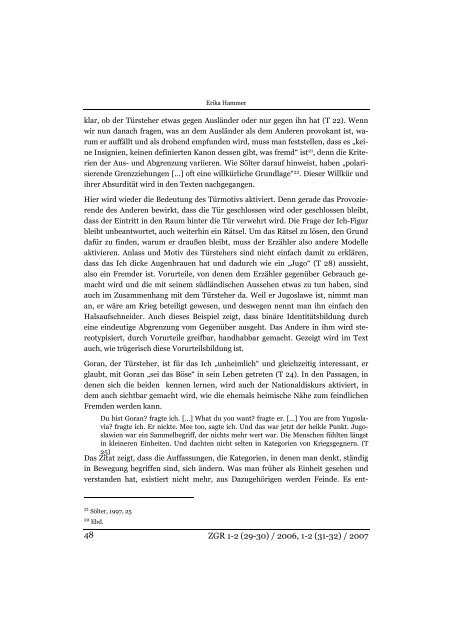ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erika Hammer<br />
klar, ob der Türsteher etwas gegen Ausländer oder nur gegen ihn hat (T 22). Wenn<br />
wir nun danach fragen, was an dem Ausländer als dem Anderen provokant ist, warum<br />
er auffällt und als drohend empfunden wird, muss man feststellen, dass es „keine<br />
Insignien, keinen definierten Kanon dessen gibt, was fremd“ ist 21 , denn die Kriterien<br />
der Aus- und Abgrenzung variieren. Wie Sölter darauf hinweist, haben „polarisierende<br />
Grenzziehungen […] oft eine willkürliche Grundlage“ 22 . Dieser Willkür und<br />
ihrer Absurdität wird in den Texten nachgegangen.<br />
Hier wird wieder die Bedeutung des Türmotivs aktiviert. Denn gerade das Provozierende<br />
des Anderen bewirkt, dass die Tür geschlossen wird oder geschlossen bleibt,<br />
dass der Eintritt in den Raum hinter die Tür verwehrt wird. Die Frage der Ich-Figur<br />
bleibt unbeantwortet, auch weiterhin ein Rätsel. Um das Rätsel zu lösen, den Grund<br />
dafür zu finden, warum er draußen bleibt, muss der Erzähler also andere Modelle<br />
aktivieren. Anlass und Motiv des Türstehers sind nicht einfach damit zu erklären,<br />
dass das Ich dicke Augenbrauen hat und dadurch wie ein „Jugo“ (T 28) aussieht,<br />
also ein Fremder ist. Vorurteile, von denen dem Erzähler gegenüber Gebrauch gemacht<br />
wird und die mit seinem südländischen Aussehen etwas zu tun haben, sind<br />
auch im Zusammenhang mit dem Türsteher da. Weil er Jugoslawe ist, nimmt man<br />
an, er wäre am Krieg beteiligt gewesen, und deswegen nennt man ihn einfach den<br />
Halsaufschneider. Auch dieses Beispiel zeigt, dass binäre Identitätsbildung durch<br />
eine eindeutige Abgrenzung vom Gegenüber ausgeht. Das Andere in ihm wird stereotypisiert,<br />
durch Vorurteile greifbar, handhabbar gemacht. Gezeigt wird im Text<br />
auch, wie trügerisch diese Vorurteilsbildung ist.<br />
Goran, der Türsteher, ist für das Ich „unheimlich“ und gleichzeitig interessant, er<br />
glaubt, mit Goran „sei das Böse“ in sein Leben getreten (T 24). In den Passagen, in<br />
denen sich die beiden kennen lernen, wird auch der Nationaldiskurs aktiviert, in<br />
dem auch sichtbar gemacht wird, wie die ehemals heimische Nähe zum feindlichen<br />
Fremden werden kann.<br />
Du bist Goran? fragte ich. […] What du you want? fragte er. […] You are from Yugoslavia?<br />
fragte ich. Er nickte. Mee too, sagte ich. Und das war jetzt der heikle Punkt. Jugoslawien<br />
war ein Sammelbegriff, der nichts mehr wert war. Die Menschen fühlten längst<br />
in kleineren Einheiten. Und dachten nicht selten in Kategorien von Kriegsgegnern. (T<br />
25)<br />
Das Zitat zeigt, dass die Auffassungen, die Kategorien, in denen man denkt, ständig<br />
in Bewegung begriffen sind, sich ändern. Was man früher als Einheit gesehen und<br />
verstanden hat, existiert nicht mehr, aus Dazugehörigen werden Feinde. Es ent-<br />
21 Sölter, 1997, 25<br />
22 Ebd.<br />
48<br />
<strong>ZGR</strong> 1-2 (<strong>29</strong>-<strong>30</strong>) / <strong>2006</strong>, 1-2 (<strong>31</strong>-<strong>32</strong>) / <strong>2007</strong>