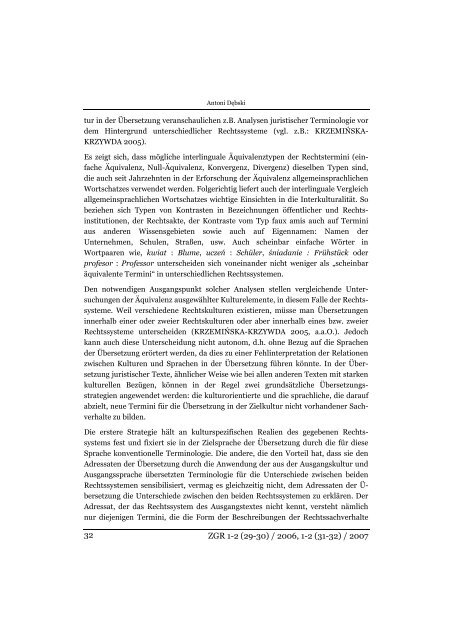ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
ZGR Nr. 29-30; 31-32/2006-2007 Partea I - Universitatea din ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Antoni Dębski<br />
tur in der Übersetzung veranschaulichen z.B. Analysen juristischer Terminologie vor<br />
dem Hintergrund unterschiedlicher Rechtssysteme (vgl. z.B.: KRZEMIŃSKA-<br />
KRZYWDA 2005).<br />
Es zeigt sich, dass mögliche interlinguale Äquivalenztypen der Rechtstermini (einfache<br />
Äquivalenz, Null-Äquivalenz, Konvergenz, Divergenz) dieselben Typen sind,<br />
die auch seit Jahrzehnten in der Erforschung der Äquivalenz allgemeinsprachlichen<br />
Wortschatzes verwendet werden. Folgerichtig liefert auch der interlinguale Vergleich<br />
allgemeinsprachlichen Wortschatzes wichtige Einsichten in die Interkulturalität. So<br />
beziehen sich Typen von Kontrasten in Bezeichnungen öffentlicher und Rechtsinstitutionen,<br />
der Rechtsakte, der Kontraste vom Typ faux amis auch auf Termini<br />
aus anderen Wissensgebieten sowie auch auf Eigennamen: Namen der<br />
Unternehmen, Schulen, Straßen, usw. Auch scheinbar einfache Wörter in<br />
Wortpaaren wie, kwiat : Blume, uczeń : Schüler, śniadanie : Frühstück oder<br />
profesor : Professor unterscheiden sich voneinander nicht weniger als „scheinbar<br />
äquivalente Termini“ in unterschiedlichen Rechtssystemen.<br />
Den notwendigen Ausgangspunkt solcher Analysen stellen vergleichende Untersuchungen<br />
der Äquivalenz ausgewählter Kulturelemente, in diesem Falle der Rechtssysteme.<br />
Weil verschiedene Rechtskulturen existieren, müsse man Übersetzungen<br />
innerhalb einer oder zweier Rechtskulturen oder aber innerhalb eines bzw. zweier<br />
Rechtssysteme unterscheiden (KRZEMIŃSKA-KRZYWDA 2005, a.a.O.). Jedoch<br />
kann auch diese Unterscheidung nicht autonom, d.h. ohne Bezug auf die Sprachen<br />
der Übersetzung erörtert werden, da dies zu einer Fehlinterpretation der Relationen<br />
zwischen Kulturen und Sprachen in der Übersetzung führen könnte. In der Übersetzung<br />
juristischer Texte, ähnlicher Weise wie bei allen anderen Texten mit starken<br />
kulturellen Bezügen, können in der Regel zwei grundsätzliche Übersetzungsstrategien<br />
angewendet werden: die kulturorientierte und die sprachliche, die darauf<br />
abzielt, neue Termini für die Übersetzung in der Zielkultur nicht vorhandener Sachverhalte<br />
zu bilden.<br />
Die erstere Strategie hält an kulturspezifischen Realien des gegebenen Rechtssystems<br />
fest und fixiert sie in der Zielsprache der Übersetzung durch die für diese<br />
Sprache konventionelle Terminologie. Die andere, die den Vorteil hat, dass sie den<br />
Adressaten der Übersetzung durch die Anwendung der aus der Ausgangskultur und<br />
Ausgangssprache übersetzten Terminologie für die Unterschiede zwischen beiden<br />
Rechtssystemen sensibilisiert, vermag es gleichzeitig nicht, dem Adressaten der Übersetzung<br />
die Unterschiede zwischen den beiden Rechtssystemen zu erklären. Der<br />
Adressat, der das Rechtssystem des Ausgangstextes nicht kennt, versteht nämlich<br />
nur diejenigen Termini, die die Form der Beschreibungen der Rechtssachverhalte<br />
<strong>32</strong><br />
<strong>ZGR</strong> 1-2 (<strong>29</strong>-<strong>30</strong>) / <strong>2006</strong>, 1-2 (<strong>31</strong>-<strong>32</strong>) / <strong>2007</strong>