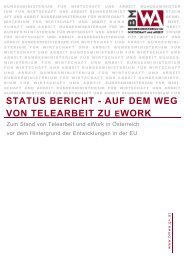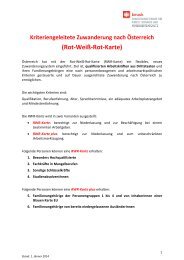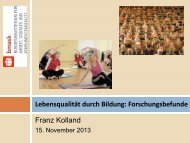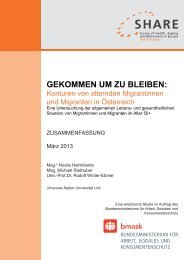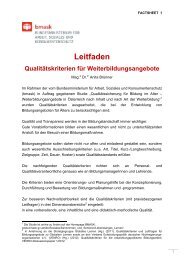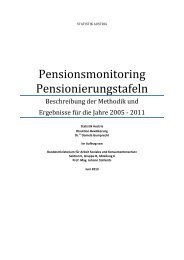- Seite 1 und 2: HOCHALTRIGKEIT IN ÖSTERREICH EINE
- Seite 3: HOCHALTRIGKEIT IN ÖSTERREICH EINE
- Seite 6 und 7: 2.4.2.2. Steiermark 85 2.4.2.3. Wie
- Seite 8 und 9: 7.2.4. Barrieren bei der Verwendung
- Seite 10 und 11: 13.4. Medikamentöse Polypragmasie
- Seite 12 und 13: 17.3.2. Kurzzeitpfl ege 425 17.3.3.
- Seite 14 und 15: Empfehlungen zu Kapitel 5: Alltag i
- Seite 16 und 17: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 18 und 19: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 20 und 21: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 22 und 23: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 24 und 25: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 26 und 27: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 30 und 31: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 32 und 33: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 34 und 35: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 36 und 37: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 38 und 39: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 40 und 41: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 42 und 43: HOCHALTRIGE IN ÖSTERREICH: EINE BE
- Seite 44 und 45: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Tabelle 1
- Seite 46 und 47: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Da die er
- Seite 48 und 49: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Tabelle 2
- Seite 50 und 51: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Eine weit
- Seite 52 und 53: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Eine ähn
- Seite 54 und 55: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG 52 Jahr T
- Seite 56 und 57: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG 54 Tabell
- Seite 58 und 59: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Diese Son
- Seite 60 und 61: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG 1.1.2.5.
- Seite 62 und 63: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Von beson
- Seite 64 und 65: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG 62 Tabell
- Seite 66 und 67: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Beginnend
- Seite 68 und 69: DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG Im Hinbli
- Seite 71 und 72: LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 73 und 74: LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 75 und 76: LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 77 und 78: LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 79 und 80:
2.3.2. Altenwohn- und Pfl egeheime
- Seite 81 und 82:
2.3.5. Senior/innenwohngemeinschaft
- Seite 83 und 84:
LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 85 und 86:
LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 87 und 88:
LEBENSFORMEN UND WOHNSITUATION DER
- Seite 89 und 90:
LITERATUR LEBENSFORMEN UND WOHNSITU
- Seite 91 und 92:
ÖKOLOGIE IM ALTER 3. ÖKOLOGIE IM
- Seite 93 und 94:
ÖKOLOGIE IM ALTER Die ostösterrei
- Seite 95 und 96:
ÖKOLOGIE IM ALTER Der Ausgleich r
- Seite 97 und 98:
ÖKOLOGIE IM ALTER Abbildung 2: Ver
- Seite 99 und 100:
ÖKOLOGIE IM ALTER identifi ziert w
- Seite 101 und 102:
ÖKOLOGIE IM ALTER Sowohl im städt
- Seite 103 und 104:
LITERATUR ÖKOLOGIE IM ALTER Bundes
- Seite 105 und 106:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 107 und 108:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 109 und 110:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 111 und 112:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 113 und 114:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 115 und 116:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 117 und 118:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 119 und 120:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 121 und 122:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 123 und 124:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 125 und 126:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 127 und 128:
DIE ÖKONOMISCHE SITUATION DER HOCH
- Seite 129 und 130:
5. ALLTAG IM ALTER FRANZ KOLLAND 5.
- Seite 131 und 132:
ALLTAG IM ALTER basalen Kompetenz s
- Seite 133 und 134:
ALLTAG IM ALTER werden, durch ander
- Seite 135 und 136:
5.3. Mediennutzung ALLTAG IM ALTER
- Seite 137 und 138:
70 60 50 40 30 20 10 0 Intervall 03
- Seite 139 und 140:
Viertelstundenreichweiten in % ALLT
- Seite 141 und 142:
5.4. Reiseintensität und Reisemoti
- Seite 143 und 144:
ALLTAG IM ALTER 67%; 50-59-Jährige
- Seite 145 und 146:
ALLTAG IM ALTER gern Gesellschaft h
- Seite 147 und 148:
35 30 25 20 15 10 5 0 20- 24 Abbild
- Seite 149 und 150:
ALLTAG IM ALTER Altersbildung brauc
- Seite 151 und 152:
ALLTAG IM ALTER Tabelle 7: Häufi g
- Seite 153 und 154:
ALLTAG IM ALTER sind es 32% und bei
- Seite 155 und 156:
ALLTAG IM ALTER geschehens nicht er
- Seite 157 und 158:
ALLTAG IM ALTER Faber, Margaret von
- Seite 159 und 160:
ALLTAG IM ALTER Rosenmayr, Leopold
- Seite 161 und 162:
6. SICHERHEIT IM HOHEN ALTER RUPERT
- Seite 163 und 164:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER Im Jahr 2
- Seite 165 und 166:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER ist nicht
- Seite 167 und 168:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER Wohlfahrt
- Seite 169 und 170:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER » Fehlen
- Seite 171 und 172:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER katoren (
- Seite 173 und 174:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER Für Hoch
- Seite 175 und 176:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER sio- und
- Seite 177 und 178:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER » Zur L
- Seite 179 und 180:
SICHERHEIT IM HOHEN ALTER Furian, G
- Seite 181 und 182:
7. MOBILITÄT IM ALTER BARBARA REIT
- Seite 183 und 184:
MOBILITÄT IM ALTER 8 europäischen
- Seite 185 und 186:
MOBILITÄT IM ALTER Eine ähnliche
- Seite 187 und 188:
MOBILITÄT IM ALTER Die fi nanziell
- Seite 189 und 190:
MOBILITÄT IM ALTER weise stellte s
- Seite 191 und 192:
MOBILITÄT IM ALTER Aus einer Auße
- Seite 193 und 194:
MOBILITÄT IM ALTER als Hindernis a
- Seite 195 und 196:
MOBILITÄT IM ALTER Durchsetzung vo
- Seite 197 und 198:
MOBILITÄT IM ALTER auch besonderes
- Seite 199 und 200:
MOBILITÄT IM ALTER Hubacher, Marku
- Seite 201 und 202:
8. LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIE
- Seite 203 und 204:
8.2. Kontexte der Lebensqualität u
- Seite 205 und 206:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 207 und 208:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 209 und 210:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 211 und 212:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 213 und 214:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 215 und 216:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 217 und 218:
LEBENSQUALITÄT UND LEBENSZUFRIEDEN
- Seite 219 und 220:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 221 und 222:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 223 und 224:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 225 und 226:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 227 und 228:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 229 und 230:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 231 und 232:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 233 und 234:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 235 und 236:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 237 und 238:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 239 und 240:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 241 und 242:
LITERATUR GENERATIONENSOLIDARITÄT
- Seite 243 und 244:
GENERATIONENSOLIDARITÄT UND GENERA
- Seite 245 und 246:
10. HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN CHRIS
- Seite 247 und 248:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Aus der i
- Seite 249 und 250:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Im späte
- Seite 251 und 252:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Bedürfni
- Seite 253 und 254:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Tabelle 1
- Seite 255 und 256:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN 11% im Ve
- Seite 257 und 258:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Ähnlich
- Seite 259 und 260:
10.4. Zusammenfassung und Ausblick
- Seite 261 und 262:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Bundesarb
- Seite 263 und 264:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN Matuschek
- Seite 265 und 266:
HOCHALTRIGE MIGRANT/INNEN WHO (2006
- Seite 267 und 268:
11. HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHIND
- Seite 269 und 270:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 271 und 272:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 273 und 274:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 275 und 276:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 277 und 278:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 279 und 280:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 281 und 282:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 283 und 284:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 285 und 286:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 287 und 288:
LITERATUR HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT
- Seite 289 und 290:
HOCHBETAGTE MENSCHEN MIT BEHINDERUN
- Seite 291 und 292:
12. EINSAMKEIT UND ISOLATION JOSEF
- Seite 293 und 294:
EINSAMKEIT UND ISOLATION Diese gena
- Seite 295 und 296:
EINSAMKEIT UND ISOLATION Für Öste
- Seite 297 und 298:
EINSAMKEIT UND ISOLATION in den let
- Seite 299 und 300:
EINSAMKEIT UND ISOLATION Form auch
- Seite 301 und 302:
12.3.3. Einsamkeitserwartung EINSAM
- Seite 303 und 304:
EINSAMKEIT UND ISOLATION 1 additive
- Seite 305 und 306:
LITERATUR EINSAMKEIT UND ISOLATION
- Seite 307 und 308:
EINSAMKEIT UND ISOLATION Tesch-Röm
- Seite 309 und 310:
13. GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTE
- Seite 311 und 312:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER Le
- Seite 313 und 314:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER di
- Seite 315 und 316:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER Es
- Seite 317 und 318:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER m
- Seite 319 und 320:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER Mo
- Seite 321 und 322:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER »
- Seite 323 und 324:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER Al
- Seite 325 und 326:
GESUNDHEITLICHE ASPEKTE IM ALTER St
- Seite 327 und 328:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 329 und 330:
14.2.1. Gesunde Ernährung GESUNDHE
- Seite 331 und 332:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 333 und 334:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 335 und 336:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 337 und 338:
14.3.2. Sturzprävention GESUNDHEIT
- Seite 339 und 340:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 341 und 342:
14.4.5. Krebs GESUNDHEITSFÖRDERUNG
- Seite 343 und 344:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 345 und 346:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 347 und 348:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 349 und 350:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 351 und 352:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 353 und 354:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 355 und 356:
LITERATUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PR
- Seite 357 und 358:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 359 und 360:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 361 und 362:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 363 und 364:
GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION
- Seite 365 und 366:
15. PFLEGE UND BETREUUNG JOSEF HÖR
- Seite 367 und 368:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 369 und 370:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 371 und 372:
15.3.4. Erwerbs-, Bildungs- und Ber
- Seite 373 und 374:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 375 und 376:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 377 und 378:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 379 und 380:
15.4.5. Belastungen und negative As
- Seite 381 und 382:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 383 und 384:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 385 und 386:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 387 und 388:
PFLEGE UND BETREUUNG I: INFORMELLE
- Seite 389 und 390:
16. PFLEGE UND BETREUUNG PFLEGE UND
- Seite 391 und 392:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 393 und 394:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 395 und 396:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 397 und 398:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 399 und 400:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 401 und 402:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 403 und 404:
PFLEGE UND BETREUUNG II: DIE FORMEL
- Seite 405 und 406:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 407 und 408:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 409 und 410:
Burgenland Sozialhilfegesetz Kärnt
- Seite 411 und 412:
Vorarlberg: PFLEGE UND BETREUUNG II
- Seite 413 und 414:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 415 und 416:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 417 und 418:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 419 und 420:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 421 und 422:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 423 und 424:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 425 und 426:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 427 und 428:
PFLEGE UND BETREUUNG III: DIE FORME
- Seite 429 und 430:
LITERATUR PFLEGE UND BETREUUNG III:
- Seite 431 und 432:
18. GEWALT UND KRIMINALITÄT JOSEF
- Seite 433 und 434:
18.2. Datenlage und Dunkelfeldprobl
- Seite 435 und 436:
GEWALT UND KRIMINALITÄT Tabelle 1:
- Seite 437 und 438:
GEWALT UND KRIMINALITÄT Und in der
- Seite 439 und 440:
18.3.3. Gewalt im häuslichen und p
- Seite 441 und 442:
GEWALT UND KRIMINALITÄT Die in die
- Seite 443 und 444:
LITERATUR GEWALT UND KRIMINALITÄT
- Seite 445 und 446:
GEWALT UND KRIMINALITÄT Pillemer,
- Seite 447 und 448:
19. RECHTLICHE ASPEKTE MICHAEL GANN
- Seite 449 und 450:
RECHTLICHE ASPEKTE (§ 324 Abs 3 AS
- Seite 451 und 452:
RECHTLICHE ASPEKTE Anwendungsbereic
- Seite 453 und 454:
RECHTLICHE ASPEKTE Das Recht auf ze
- Seite 455 und 456:
RECHTLICHE ASPEKTE Darüber hinaus
- Seite 457 und 458:
RECHTLICHE ASPEKTE ländern. Darin
- Seite 459 und 460:
RECHTLICHE ASPEKTE » das Recht auf
- Seite 461 und 462:
RECHTLICHE ASPEKTE nach dem Unterbr
- Seite 463 und 464:
RECHTLICHE ASPEKTE Der Bevollmächt
- Seite 465 und 466:
RECHTLICHE ASPEKTE Freiheitsbeschr
- Seite 467 und 468:
20. LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PA
- Seite 469 und 470:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 471 und 472:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 473 und 474:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 475 und 476:
Quelle: Statistik Austria, eig. Ber
- Seite 477 und 478:
20.2.1.3. FAZIT ZU DEN STERBEORTEN
- Seite 479 und 480:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 481 und 482:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 483 und 484:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 485 und 486:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 487 und 488:
20.3.3. Qualifi zierung im Bereich
- Seite 489 und 490:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 491 und 492:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 493 und 494:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 495 und 496:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 497 und 498:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 499 und 500:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 501 und 502:
LEBEN UND STERBEN IN WÜRDE. PALLIA
- Seite 503 und 504:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 505 und 506:
Empfehlungen zu Kapitel 3: Ökologi
- Seite 507 und 508:
Empfehlungen zu Kapitel 5: Alltag i
- Seite 509 und 510:
Informationsdefi zite bestehen insb
- Seite 511 und 512:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 513 und 514:
Empfehlungen zu Kapitel 10: Hochalt
- Seite 515 und 516:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 517 und 518:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 519 und 520:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 521 und 522:
Empfehlungen zu Kapitel 17: Pfl ege
- Seite 523 und 524:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 525 und 526:
HANDLUNGS- UND FORSCHUNGSEMPFEHLUNG
- Seite 527 und 528:
AUTOR/INNEN DER BEITRÄGE MARTINA A
- Seite 529 und 530:
PROF. (FH) DR. TOM SCHMID Sozialök
- Seite 532:
SOZIAL TELEFON Bürgerservice des S