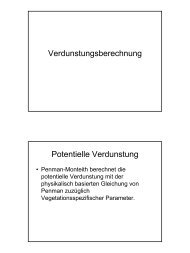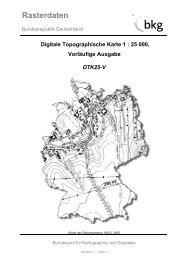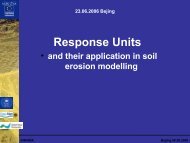Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Einleitung 8<br />
verlangen. Zudem können solche Modelle keine Veränderungen im Einzugsgebiet, wie zum<br />
Beispiel Landnutzungsänderungen, nachvollziehen. Vorteil der Modelle ist ihre relativ einfache<br />
Anwendbarkeit, da sie nur wenige Eingabedaten benötigen und einen geringen Rechenaufwand<br />
besitzen. Sie werden vorrangig in der operationellen Hochwasservorhersage (PFÜTZNER et al.<br />
1992) und in kleinen homogenen Einzugsgebieten eingesetzt. Beispielhaft für diese<br />
Modellkonzeption ist die Einheitsganglinie nach SHERMAN (1932) und ihre Modifizierung durch<br />
NASH (1957) und DOOGE (1959).<br />
Die konzeptionellen Modelle nehmen bezüglich dem Grad der Kausalität eine Mittelstellung<br />
zwischen dem deterministischen Ansatz und dem empirischen black-box Konzept ein. Sie können<br />
auch als grey-box Modelle bezeichnet werden, da wesentliche Prozessdynamiken detailliert und<br />
physikalisch begründet beschrieben, aber andere statistisch umgesetzt werden (SCHULZE 1998).<br />
Diesem hybriden Ansatz liegt die Gliederung des physikalischen Wassertransportprozesses in<br />
einzelne Komponenten, die durch einfache, lineare oder nicht-lineare Speicherbeziehungen<br />
wiedergegeben werden, zugrunde (HERRMANN 1992). Je nach Komplexität der Modelle ist eine<br />
räumliche und zeitliche Extrapolierbarkeit möglich. Ein häufiger Nachteil dieser Modelle ist, dass<br />
die Modellparameter teilweise keinen direkt messbaren physikalischen Bezug haben (BLACKIE &<br />
EELES 1985) und daher längere hydrometeorologische Aufzeichnungen zur Kalibrierung<br />
benötigen. Die Modelle finden aufgrund ihrer relativ einfachen Struktur und geringen Anzahl von<br />
Parametern, verglichen mit deterministischen Modellen, sowohl in der Praxis als auch in der<br />
Forschung ihre Anwendung (BEVEN 1989). Beispiel für ein konzeptionelles Modell ist das NAM<br />
(NIELSEN & HANSEN 1973).<br />
Deterministische Modelle (auch aufgrund ihrer Transparenz als white-box Modell bezeichnet)<br />
dienen einer möglichst detaillierten Prozesssimulation (GRAYSON et al. 1992b). Sie besitzen<br />
Parameter, welche sich direkt auf die physikalischen Eigenschaften des Einzugsgebiets<br />
(Topographie, Vegetation, Boden, Geologie) beziehen (REFSGAARD & KNUDSEN 1996). Das<br />
hydrologische Systemverhalten wird dabei unter Berücksichtigung der einzelnen Subsysteme<br />
sowie deren Wechselwirkungen wiedergegeben (MICHAUD & SOROOSHIAN 1994). Verschiedene<br />
physikalische Prozesse werden über partielle Differentialgleichungen und die Oberflächen- und<br />
Bodenwasserflüsse über Kontinuitätsgleichungen beschrieben (CHIEW et al. 1993). Wesentliche<br />
Vorteile der Modelle sind darin begründet, dass sie einerseits wissensbasiert und prozessorientiert<br />
arbeiten und andererseits Veränderungen im Einzugsgebiet nachvollziehen können (MORRIS 1980,<br />
BONELL 1993). Ihre Anwendung wird durch die oft unzureichende Verfügbarkeit der<br />
physikalischen Parameter begrenzt. Als Beispiele deterministischer Modelle sind das Système<br />
Hydrologique Européen (SHE) (ABBOTT et al. 1986a, b) und das Institute of Hydrology Distributed Model<br />
(IHDM) (BEVEN et al. 1987) zu nennen.