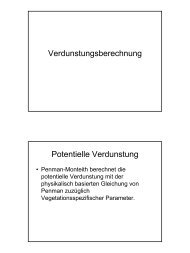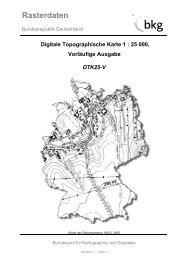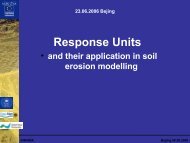Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Vergleichende - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Einleitung 14<br />
SIVAPALAN (1995), BEVEN (1991a), WOOD et al. (1988)und GUPTA et al. (1986). Die GIS-<br />
Integration ermöglicht die top down Diskretisierung (downskaling bezeichnet den<br />
Informationstransfer von einem gegebenen Maßstab auf einen kleineren) bzw. den umgekehrten<br />
Prozess der bottom up Diskretisierung (BECKER & BRAUN 1999, PFÜTZNER et al. 1992).<br />
Viele Anwendungen von GIS in der Einzugsgebietsmodellierung beschränken sich allerdings auf<br />
die begleitende graphische Darstellung hydrologischer Faktoren und der Modellergebnisse.<br />
MAIDMENT (1993) und NYERGES (1993) bezeichnen diesen Ansatz als lose Verknüpfung, wenn<br />
ein Datentransfer zwischen beiden Werkzeugen durch deren Verknüpfung über eine<br />
Datenschnittstelle gegeben ist. Zum Beispiel wurde bei REICHE (1996) das Modell WASMOD mit<br />
dem GIS ARC/INFO gekoppelt, so dass ein interaktiver Datentransfer vom GIS zum Modell<br />
und umgekehrt stattfinden konnte. Den höchsten Grad der Vernetztheit von GIS und<br />
Einzugsgebietsmodellierung sieht GOODCHILD (1993) in der Modellkalibrierung und -<br />
durchführung innerhalb eines GIS unter Verwendung der GIS-Befehlssprache<br />
(Anwendungsbeispiele bei MALLANTS & BADJI 1991, PFÜTZNER et al. 1997). Nach STUART &<br />
STOCKS (1993) fehlen aufgrund der separaten Entwicklung von GIS und hydrologischen Modellen<br />
noch hinreichende Schnittstellen, um beispielsweise die HRUs mit räumlichen Bezug ins<br />
hydrologische Modell zu überführen. SINGH (1995) betont als Potential der GIS die<br />
Durchführung von Overlay-Analysen und die Ableitung von Einzugsgebietseigenschaften, aber<br />
auch deren Verwendung zur Kalibrierung und Modifikation der hydrologischen Modelle.<br />
Neben der Verknüpfung von hydrologischen Modellen und GIS wurde in den letzten Jahren auch<br />
die Einbeziehung der Fernerkundung erforscht (LU et al. 1996, SAVABI et al. 1996, JETON & SMITH<br />
1993). Die Fernerkundung erlaubt das kontaktlose wissenschaftliche Beobachten und Erkunden<br />
eines Gebiets aus der Ferne durch Reflexion der Solarstrahlung und der thermalen Eigenstrahlung<br />
von Körpern (passive Systeme, zum Beispiel Luftbilder) oder der künstlichen (Radar-) Strahlung<br />
(aktive Systeme) (LÖFFLER 1994). Sie hat sich zu einer wichtigen Methode der flächenhaften<br />
Ableitung von Parametern für die hydrologische Modellierung mit physikalisch basierten,<br />
distributiven Modellen entwickelt (MAUSER et al. 1997). Ihr Vorteil liegt in der Erfassung<br />
flächenhafter Daten in hoher räumlicher (abhängig vom Fernerkundungssystem) und zeitlicher<br />
(abhängig von der Repetitionsrate) Auflösung (SCHULTZ 1988, zitiert in SINGH 1995). Bisher<br />
wurden für die hydrologische Modellierung vorrangig Daten der optischen Fernerkundung<br />
genutzt. Zukünftiges Ziel ist die Integration der Radarfernerkundung. Sie besitzt in der Ableitung<br />
hydrologischer Parameter noch experimentellen Status (KUSTAS et al. 1998), aber bietet gegenüber<br />
der optischen Fernerkundung den Vorteil der Unabhängigkeit von Witterungs- und<br />
Strahlungsbedingungen.<br />
Die Fernerkundungstechnologie kann adäquate Daten für die quantitative Beschreibung