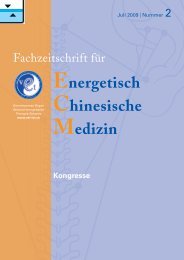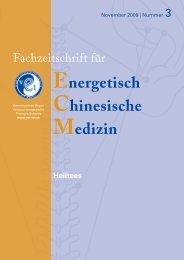Energetisch Chinesische Medizin - APM Radloff
Energetisch Chinesische Medizin - APM Radloff
Energetisch Chinesische Medizin - APM Radloff
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wissenschaft<br />
men. Diese ist zur vollautomatischen Kontrolle des Blutzuckerspiegels<br />
bei Diabetikern gedacht. Den Wissenschaftlern<br />
gelang es, den Blutzucker bei elf Diabetikern<br />
vom Typ 1 über mehr als 24 Stunden in einem normalen<br />
Bereich zu halten. Entscheidend dafür waren vor allem<br />
zwei Dinge, berichten die Forscher: Zum einen bekamen<br />
die Testteilnehmer nicht wie üblich lediglich Insulin verabreicht,<br />
sondern auch dessen Gegenspieler Glucagon,<br />
was die sonst häufig auftretende Unterzuckerung größtenteils<br />
verhinderte. Zum anderen wurde die Abgabe der<br />
Hormone von einer neuartigen Software gesteuert, die<br />
besser auf die Bedürfnisse des Körpers reagierte, berichten<br />
Firas El-Khatib von der Boston University und<br />
seine Kollegen.<br />
Normalerweise reguliert die Bauchspeicheldrüse den<br />
Blutzuckerspiegel mit Hilfe der beiden Hormone Insulin<br />
und Glucagon: Insulin sorgt bei einer zu hohen Glukosekonzentration<br />
im Blut für eine verstärkte Speicherung des<br />
Zuckers in der Leber und in anderen Organen, während<br />
Glucagon bei Glukosemangel die Zuckerausschüttung<br />
aus der Leber ankurbelt und so für Nachschub sorgt. Bei<br />
Diabetikern vom Typ 1 funktioniert dieses System jedoch<br />
nicht, weil das Immunsystem die Zellen der Bauchspeicheldrüse<br />
angreift und sie zerstört. Sie müssen daher<br />
ihren Blutzuckerspiegel selber überwachen und immer<br />
wieder entsprechend Insulin spritzen. Da dieses Prozedere<br />
ungemein aufwendig ist, suchen Forscher bereits<br />
seit längerem nach einer automatisierten Alternative.<br />
Bisherige Ansätze waren allerdings nur mäßig erfolgreich.<br />
Häufigstes Problem: Es kam immer wieder zu Überdosierungen<br />
von Insulin, die bei den Betroffenen eine massive<br />
Unterzuckerung herbeiführten. Aus diesem Grund<br />
entschieden sich El-Khatib und seine Kollegen bei ihrer<br />
Variante, sowohl Insulin als auch Glucagon zu verabreichen<br />
und damit die natürlichen Vorgänge bei der Blutzuckerregulierung<br />
genauer nachzuahmen. Ihr Testsystem<br />
sah schließlich so aus: Sie setzten elf Typ-1-Diabetikern<br />
eine Insulin- und eine Glucagon-Pumpe unter die Haut<br />
am Bauch, platzierten einen Blutzuckersensor in ihren<br />
Venen und schlossen das System an einen Computer<br />
an, auf dem die neuartige Software lief. 27 Stunden lang<br />
bestimmte der Sensor alle fünf Minuten den Blutzuckerwert<br />
und meldete ihn an den Computer. Die Software<br />
berechnete dann die nötige Insulin- und Glucagondosis,<br />
die anschließend über die Pumpen abgegeben wurde.<br />
Bei sechs der elf Tester habe das Prinzip auf Anhieb<br />
hervorragend funktioniert, berichten die Forscher. Bei<br />
den anderen fünf sei es jedoch zu Unterzuckerungen<br />
gekommen. Die Ursache: Ihr Körper nahm das Insulin<br />
sehr viel langsamer auf als angenommen, so dass<br />
ebenfalls ungewollt Überdosierungen entstanden. Eine<br />
langsamere Abgabe auf Basis dieses Wertes beseitigte<br />
das Problem jedoch, so die Wissenschaftler. Sie wollen<br />
ihr System nun weiter verbessern, so dass es nicht nur<br />
unter Laborbedingungen, sondern auch im täglichen Leben<br />
funktioniert. So soll in Zukunft beispielsweise ein<br />
Mik rochip für die Steuerung der Pumpen ausreichen und<br />
auch die Blutzuckermessung in den Venen soll durch einen<br />
unter die Haut implantierten Sensor ersetzt werden.<br />
Firas El-Khatib (Boston University) et al.: Science Translational Medicine,<br />
Bd. 2, Nr. 27, Artikel 27ra27<br />
List hilft bei der Rauchentwöhnung<br />
Fotos von Zigarettenstummeln dämpfen die Lust auf einen<br />
Glimmstängel<br />
Ein Foto von einer brennenden Zigarette löst in Rauchern<br />
einen geradezu unwiderstehlichen Drang aus, sich ebenfalls<br />
einen Glimmstängel anzustecken. Umgekehrt funktioniert<br />
das aber offensichtlich auch, wie Forscher der<br />
Julius-Maximilians-Universität Würzburg nun herausgefunden<br />
haben: Das Bild einer ausgedrückten Zigarette<br />
hemmt das Suchtzentrum im Gehirn und damit die Lust<br />
auf die Tabakwaren – vermutlich, weil das Bild das Ende<br />
des Rauchrituals symbolisiert. Die Forscher hoffen, Rauchern<br />
mit ihren Erkenntnissen bei der Entwöhnung von<br />
dem Suchtmittel helfen zu können, berichtet die Universität.<br />
Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass Bilder frisch<br />
entzündeter Zigaretten – ein Symbol für den Beginn<br />
des Rauchrituals – die Lust auf einen Glimmstängel bei<br />
Rauchern förderten. Die Wissenschaftler um Paul Pauli<br />
wollten nun überprüfen, ob auch das Gegenteil zutrifft.<br />
Dazu zeigten sie 20 Rauchern Fotos gerade erst entzündeter<br />
Zigaretten und solche von Zigarettenstummeln im<br />
Aschenbecher. Währenddessen zeichneten sie mit Hilfe<br />
eines Magnetresonanztomographen die Hirnaktivität der<br />
Probanden auf.<br />
Bei der Auswertung der Daten bestätigte sich die These<br />
der Forscher: Die Fotos brennender Zigaretten aktivierten<br />
die Suchtzentren im Gehirn, während Bilder<br />
ausgedrückter Zigaretten dämpfend wirkten. «Diese<br />
Reize, die das Ende des Rauchens markieren, sind also<br />
auf der einen Seite sehr klar mit dem Rauchen assoziiert,<br />
scheinen aber auf der anderen Seite das Suchtnetzwerk<br />
im Gehirn zu hemmen», sagt Pauli. In künftigen<br />
Studien wollen die Wissenschaftler untersuchen,<br />
ob Raucher in der Entwöhnungsphase kritische Situationen<br />
mit Hilfe von Fotos besser überstehen können.<br />
Pressemitteilung der Julius-ximilians-Universität Würzburg<br />
Paul Pauli (Universität Würzburg) et al.: Neuropsychopharmacology,<br />
Bd. 35, Nr. 5, S. 1209, doi:10.1038/npp.2009.227<br />
Restless-Legs-Syndrom Diagnose und Therapie<br />
in der <strong>Chinesische</strong>n <strong>Medizin</strong><br />
«Rastlose Beine» gehören mit einer Häufigkeit von 7-10<br />
% zu den häufigsten neurologischen Krankheitsbildern<br />
und sind eine wesentliche Ursache für Schlafstörungen.<br />
RLS tritt häufiger auf als Parkinson, Migräne oder Diabetes.<br />
Lilo Habersack von der Deutschen Restless Legs<br />
Vereinigung e.V. spricht von einer Volkskrankheit. Die<br />
FAZ-Sonntagszeitung vom 24. August 2003 widmet die-<br />
26 27 37