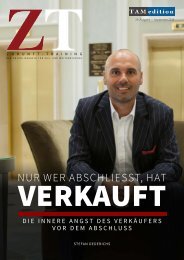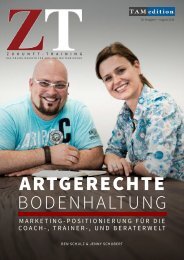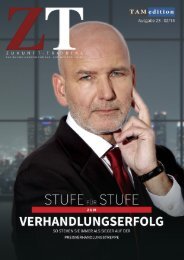ZT | Dezember 2013
Ausgabe 21 - 12/13
Ausgabe 21 - 12/13
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
CHARA24© als bildgestützter Fragebogen verfügbar.<br />
Zentral ist die Messung von insgesamt 24<br />
Charakterdimensionen, die zusammengefasst<br />
sechs Tugenden ergeben:<br />
• Weisheit (Neugier/Interesse, Liebe zum<br />
Lernen, Urteilsvermögen, Kreativität,<br />
Weitsichtigkeit/Tiefsinn<br />
• Mut (Tapferkeit, Ausdauer, Authentizität,<br />
Tatendrang)<br />
• Liebe/Humanität (Fähigkeit zu lieben,<br />
Freundlichkeit/Großzügigkeit, Soziale Intelligenz)<br />
• Gerechtigkeit (Teamfähigkeit/Loyalität,<br />
Fairness/Gerechtigkeit, Führungsvermögen)<br />
• Mäßigung (Vergebungsbereitschaft, Bescheidenheit/Demut,<br />
Selbstregulation/<br />
Selbstkontrolle, Umsicht/Vorsicht)<br />
• Transzendenz (Sinn für das Schöne, Dankbarkeit,<br />
Hoffnung/Optimismus, Humor/<br />
Verspieltheit, Spiritualität/Glaube)<br />
Die Darstellung dieser Tugenden und Charakterstärken<br />
zeigt, dass es natürlich gewisse<br />
Gemeinsamkeiten mit den zuvor genannten<br />
Facetten der Persönlichkeit gibt. Während aber<br />
die jeweiligen und individuellen Persönlichkeitsausprägungen<br />
grundsätzlich wertneutral<br />
sind, zeigt sich bei den Charakterdimensionen<br />
und insbesondere bei den Tugenden eine<br />
Wertigkeit im Sinne eines humanistischen<br />
Menschenbildes. Aus diesem Grund taucht im<br />
Kontext der Charakterzüge auch der Begriff der<br />
Charakterstärken auf.<br />
Bei nüchterner Betrachtung zeigt sich, dass<br />
in der heutigen Gesellschaft der Begriff der<br />
Tugend auf viele antiquiert wirkt und Charakterstärken<br />
und Tugenden keinen allzu großen<br />
Stellenwert genießen. Werte und Ziele wie<br />
Leistung, Verdienst, Karriere sind gegenüber<br />
verschiedenen humanistischen Werten in den<br />
Vordergrund getreten. Es fällt auf, dass die Ausprägung<br />
von Charakterstärken ohne die ihnen<br />
zugrunde liegenden individuellen Werte kaum<br />
vorstellbar ist. Die Frage ist, welchen individuellen<br />
Nutzen die Ausprägung der zuvor genannten<br />
Charakterstärken in einer Gesellschaft mit<br />
überwiegend anderem Wertegerüst überhaupt<br />
hat.<br />
Zur Beantwortung dieser Frage kann eine Studie<br />
herangezogen werden, die einen klaren<br />
Zusammenhang zwischen der Ausprägung<br />
der genannten Charakterzüge und der allgemeinen<br />
Lebenszufriedenheit aufzeigt (Ruch et<br />
al., 2010). Hier wird deutlich, dass Menschen,<br />
die insbesondere ein hohes Ausmaß an Bindungsfähigkeit,<br />
Hoffnung, Enthusiasmus und<br />
Dankbarkeit aufweisen, mit ihrem Leben insgesamt<br />
glücklicher sind, als solche mit niedrigen<br />
Ausprägungen in diesen Kategorien. Bedenkt<br />
man den Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit<br />
und psychischer Gesundheit, dann<br />
bekommt die Auseinandersetzung mit Charakter<br />
und Tugend eine klinische und letztlich<br />
volkswirtschaftliche Dimension. Die dramatisch<br />
zunehmenden Fälle von Arbeitsunfähigkeit<br />
aufgrund psychischer Erkrankungen (Angststörungen,<br />
Depression, Burnout, u.a.) zeigen eindrucksvoll,<br />
dass unsere gegenwärtigen Lebensbedingungen<br />
in Arbeit und wahrscheinlich<br />
auch Familie unsere Vulnerabilität gegenüber<br />
psychischen Erkrankungen erhöhen. Allein<br />
die Depression führt innerhalb eines Jahres zu<br />
der unglaublichen Zahl von mehr als 150.000<br />
Jahren Arbeitsausfall, was neben den persönlichen<br />
Schicksalen die Dimension der indirekten<br />
Krankheitskosten alleine durch diese Krankheit<br />
verdeutlicht.<br />
Wenn nun die Ausbildung der genannten Charakterstärken<br />
die psychische Gesundheit verbessert,<br />
stellt sich natürlich die Frage, wie diese<br />
günstigen Wesenszüge weiter ausgebildet werden<br />
könnten. Die Theorie von Robert Cloninger<br />
(1993) geht davon aus, dass Charakter primär<br />
er worben wird, Temperament hingegen maßgeblich<br />
einer erblichen Komponente unterliegt.<br />
Wie Charakterstärken entwickelt werden, bleibt<br />
weitgehend unbeantwortet. Die Philosophie<br />
der Antike gab hierzu bereits Antworten und<br />
interessante Anregungen. Aristoteles (384-322<br />
v. Chr.) beschreibt in seiner Nikomachischen<br />
Ethik, dass Charakterstärken erworben werden,<br />
konkretisiert dies aber durch den Hinweis, dass<br />
dafür die Handlung essentiell sei. Charakterausprägung<br />
also nicht im Sinne von Appellen,<br />
Moralvorgaben oder anderen Aspekten pädagogischen<br />
Handelns, sondern durch die Ausübung<br />
von bestimmten, zu den Charakterzügen<br />
passenden Tätigkeiten selbst. Die moderne<br />
Hirnforschung bestätigt, was Aristoteles bereits<br />
wusste; unser Gehirn verändert sich in der Tat<br />
durch unser Handeln funktionell (siehe auch<br />
Plastizitätsbegriff der Hirnforschung). Tätigkeiten,<br />
die in diesen Bereich fallen, können sehr<br />
vielfältig sein, soziales und gesellschaftliches<br />
Engagement (z.B. im Ehrenamt) stehen hierbei<br />
sicher an vorderer Stelle.<br />
Inzwischen hat sich diese Erkenntnis auch im<br />
arbeits- und organisationspsychologischen<br />
Bezug durchgesetzt. Verstärkt wird gefordert,<br />
bei der Mitarbeiterauswahl (Recruiting) und<br />
Personal entwicklung besonders die Charakterstärken<br />
zu berücksichtigen. Im Zuge des<br />
bevorstehenden demografischen Wandels, der<br />
neben der Verursachung zahlreicher anderer<br />
Probleme auch die Verfügbarkeit von qualifizierten<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
reduzieren wird (siehe auch „war for talents“),<br />
wird deutlich, dass sich die Akzentuierung von<br />
Merkmalen im gesamten Personalmanagementprozess<br />
erweitert. Die Mitarbeiterloyalisierung<br />
steht zunehmend im Vordergrund, um<br />
die Besten zu behalten und allgemein die Fluktuation<br />
der Mitarbeitenden reduzieren zu können.<br />
Es ist aber auch klar, dass Maßnahmen zur<br />
Mitarbeiterloyalisierung nur bei denjenigen auf<br />
fruchtbaren Boden fallen, die überhaupt „loyalisierbar“<br />
sind. Entsprechende Merkmale hierfür<br />
sind in der Aufstellung von Charakterstärken<br />
(s.o.) zu finden.<br />
Aus meiner persönlichen Sicht wird die Auseinandersetzung<br />
mit Charakter und Tugend eine<br />
weiterhin wachsende Bedeutung erfahren, die<br />
sich in der Wissenschaft, aber auch in vielen<br />
anderen Bereichen unserer Gesellschaft zeigen<br />
wird. Bei kritischer Betrachtung zahlreicher<br />
Phänomene in Politik, Wirtschaft, Familie und<br />
Bildung, könnte man zu der Ansicht kommen,<br />
dass es dafür auch Zeit wird.<br />
***<br />
Jürgen Hennig<br />
Autorenprofil<br />
Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig studierte Psychologie und Humanbiologie und ist seit 2002 Lehrstuhlinhaber für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung<br />
an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf biologischen Grundlagen der Persönlichkeit sowie auf<br />
der Forschung zur Erbe-Umwelt-Interaktion. Prof. Hennig ist Autor von über 150 Fachartikeln in internationalen Journalen sowie mehreren Büchern und<br />
wurde mehrfach für Lehr- und Forschungsleistungen ausgezeichnet. Neben seiner universitären Arbeit geht er Tätigkeiten in der Unternehmens- und<br />
Personalberatung nach.<br />
Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig<br />
www.uni-giessen.de<br />
92 <strong>ZT</strong> | <strong>Dezember</strong> <strong>2013</strong> <strong>Dezember</strong> <strong>2013</strong> | <strong>ZT</strong> 93