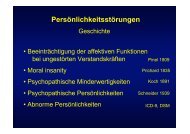STOFF/INHALT: - historischer Rückblick ... - Denkprozesse
STOFF/INHALT: - historischer Rückblick ... - Denkprozesse
STOFF/INHALT: - historischer Rückblick ... - Denkprozesse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Persönlichkeitstheorien und Menschenbilder VO SS 2002<br />
Dr. Friederike Rothe<br />
Mitschrift von Marion Harpf<br />
[Fechner (20. Jhr.): Seele ist ein durch eine Bewußtseinseinheit verknüpfter Zusammenhang und Außeinanderfluß von<br />
Erscheinungen; (≠ Begriff der Seele in Antike und MA) Fechner mißversteht den Begriff „Substanz“: „Wozu noch ein<br />
dunkles, festes Ding dahinter?“; HEUTE will man die Psyche nicht definieren. Man fragt nie, was dieses Bündel von<br />
Funktionen zusammenhält! Ab 19. Jhr.: es interessiert nur das, was wir messen können.]<br />
d. Begriff: PERSON in der NEUZEIT<br />
- der Begriff „Person“ taucht erst wieder im 19. Jhr. auf<br />
- die positive Bedeutung von „Person“ in der Antike und im MA geht jetzt auf den Begriff<br />
„PERSÖNLICHKEIT“ über; „Person“ bekommt jetzt eine immer negativere Bedeutung<br />
[Koch: „Persona“ = Schauspieler: in der Barockzeit waren Schauspieler als negativ/unehrlich angesehen, kein<br />
Sozialprestige! 18.-19. Jhr.: „Person“ negativ konnotiert! Das ändert sich in der Phänomenologie, die von E. Husserl<br />
gegründet wurde: die Person wird jetzt Thema der Philosophie]<br />
- zum 1. Mal wird der Mensch ausdrücklich als in der Welt seiend betrachtet ⇒ Verwiesenheit auf andere<br />
Menschen (vgl. Bedeutung des Umweltschutzes im letzten Jahrhundert! – die Verwiesenheit auf andere<br />
Menschen begriff man JETZT!)<br />
à<br />
à<br />
Person: das 1. Mal Thema der Philosophie!!! (unter Begriff: philosophische Anthropologie!)<br />
Psychiatrischer Bereich: machten sich jetzt auch (eigene) Gedanken – auch dort taucht jetzt der Begriff der<br />
Person auf:<br />
D. Wyss [integrierte gedanklich das Problem der 2 Substanzen Leib und Seele]<br />
Wilhelm Stern, William Stern [jüdischer Emigrant; 1871-1938; war maßgeblich an der Einführung des Personenbegriffs in der<br />
Psychologie im 20. Jhr. beteiligt; Versuch, Trennung zwischen Leib und Seele aufzuheben und durch den Begriff ‚Person‘ zu<br />
integrieren; Mensch als Einheit/Ganzes zu denken und in seiner Funktionsweise zu erklären; Seele = „Substrat der Person“,<br />
ganzheitliche Konzeption von Seele und Leib; Seele ist etwas „vor der Scheidung“ zwischen Psyche und Leib; Person ist auf die Welt<br />
bezogen]<br />
e. Begriff: CHARAKTER<br />
- der Begriff war lange Tradition; schon in der griechischen Antike; Blütezeit im 20. Jhr.; HEUTE: im<br />
moralisch wertenden Sinne gebraucht, ambivalenter Begriff, der heute out ist (vgl.: „Ist er ein sturer Hund<br />
oder charakterfest?“)<br />
- Charakter = griech. = das Eingedrückte, Eingeprägte, Eingegrabene (= Vorstellung von etwas Bleibendem,<br />
Dauerndem!) = Eigentümlichkeit einer Person, wodurch sie sich von anderen unterscheidet<br />
à der Einzelne hat eine feste Rolle im Spiel des Lebens; geprägter Typ, unabänderliche Mischung („Er ist<br />
halt so...“)<br />
Ludwig Klages (20. Jhr.):<br />
[1926; war Gründer der Grundlagen der Charakterkunde; hat x Bücher über den Charakter geschrieben, u.a.<br />
„Lebensphilosophie“ und „Prinzipien der Charakteriologie“- es gibt Modeströmungen auch in der Psychologie...]<br />
- Der Charakterbegriff taucht nochmals auf (Charakterkunde); Klages verwendete den Begriff zunächst<br />
wertfrei, dann (1930-45): man unterschied zwischen ‚wahrem‘ und ‚falschem‘ Charakter; bildliche Versuche,<br />
Charakteren darzustellen<br />
f. Begriff: Temperament + Typus<br />
Temperatmentum (lat.) = das richtige Verhältnis gemischter Dinge<br />
- meint eine „Wohltemperiertheit von allen Teilen + im richtigen Verhältnis zueinander“<br />
- Hypokrates (460 – 347 v. Chr. ): Säftelehre (lat. Humoral-Medizin):<br />
Bild vom Verhältnis zwischen Schleim + gelbe und schwarzer Galle + Blut, d.h. den vier Säften des Körpers;<br />
wenn einer der Säfte zuviel, zuwenig oder zu wenig mit anderen vermischt ist, dann ist der Mensch krank<br />
- Eiseng (ca. 1850) beschäftigte sich auch mit dieser Vermischtheit:<br />
er nennt 4 Typen: den Sanguiniker (optimistisch, gut gelaunt, Motto „was kostet die Welt“),<br />
den Phlegmatiker (langsam, schwerfällig),<br />
den Choleriker (leicht erregbar),<br />
den Melancholiker (pessimistisch, negativ)<br />
Persönlichkeitstheorien und Menschenbilder SS2002 Seite 10