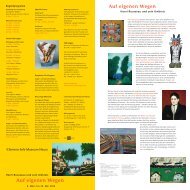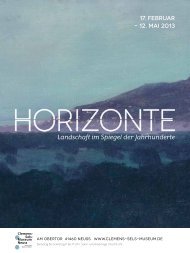Altbier-Magazin - Clemens-Sels-Museum
Altbier-Magazin - Clemens-Sels-Museum
Altbier-Magazin - Clemens-Sels-Museum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
40<br />
Jüdischer Gastwirt und Bierbrauer<br />
Simon Cohen<br />
Als Bernhard Klein-Hitpaß vom Heimatverein Dingden im März<br />
2004 bei der Restaurierung die alten Holzdielen in einem Raum im<br />
Erdgeschoss entfernt, findet er eine merkwürdig behauene Steinplatte.<br />
Die einzelnen auseinander gebrochenen Teile aus Sandstein<br />
fügen sich Stück für Stück wieder zu einem Ganzen zusammen.<br />
Schon bald ist die Darre zu erkennen. Auf ihr wurden Körner (z.B.<br />
Sommergerste) zum Keimen gebracht und dieser Vorgang nach<br />
wenigen Tagen durch eine starke Trocknung unterbrochen. Hierzu<br />
legte man die Darre auf glühende Asche. So entstand Malz, das nun<br />
geschrotet bzw. gemahlen und für das Bierbrauen weiterverwendet<br />
werden konnte. Malz ist nach dem deutschen Reinheitsgebot von<br />
1515 – neben Hopfen und Wasser – die Hauptzutat für Bier.<br />
Die Darre hat eine Größe von ca. 75 x 100 cm bei einer Dicke von 7,5<br />
cm. Auf der Unterseite befinden sich 35 quadratische Felder, die aus<br />
dem Stein herausgearbeitet wurden und durch ca. 2,0 – 3,0 cm<br />
breite Stege unterteilt sind. In der Fläche der Felder befinden sich<br />
jeweils 16 kegelförmige Löcher, die auf der Unterseite einen Durchmesser<br />
von ca. 2 cm und auf der Oberseite von 0,5 cm haben.<br />
Durch das Erhitzen beim Trocknungsvorgang hat sich der Stein teilweise<br />
dunkel verfärbt. 1931 bezieht der aus Böhmen stammende<br />
Simon Cohen das Haus Nummer 13 (heute Humberghaus).<br />
Cohen ist viel beschäftigt: Er handelt mit Ellenware und Gerberlohe<br />
(gerbstoffreiche Baumrinde). Daneben betreibt er eine Metzgerei –<br />
und ebenso eine Schenkwirtschaft. Bierverlage, wie wir sie heute<br />
kennen, gibt es damals nicht. Gastwirte im 19. Jahrhundert brauen<br />
üblicherweise ihr eigenes Bier. So auch Simon Cohen. Dazu braucht<br />
er die wiederentdeckte Darre.<br />
Doch Anfang der 1830er Jahre laufen seine Geschäfte schlecht.<br />
Die Schenkwirtschaft muss er schon 1831 schließen. 1834 eröffnet<br />
er sie wieder, allerdings ohne Genehmigung. Sie wird daraufhin<br />
erneut behördlich geschlossen und Cohen wird bestraft. 1836 ist er<br />
dem Konkurs nahe, weil er sich mit Gerberlohe verspekuliert hat.<br />
In dieser Situation brennt am 11. August 1837 sein Haus. Der<br />
Wiederaufbau des Hauses überfordert ihn finanziell und es muß<br />
zwangsverkauft werden. Cohen verlässt daraufhin Dingden, zieht<br />
nach Bocholt und stirbt dort verarmt am 14. November 1846 an<br />
Schwindsucht.<br />
Die Darre wie alles andere aus der Zeit der Familien Cohen und<br />
Humberg kann im »Geschichtsort Humberghaus Dingden«<br />
im Rahmen der Dauerausstellung besichtigt werden.<br />
Humberghaus Dingden, Hohe Straße 1, 46499 Hamminkeln-Dingden<br />
Öffnungszeiten: sonntags und mittwochs 14 – 17 Uhr und nach Vereinbarung<br />
Die Schuster in Kleve<br />
Der »Blaue Montag«<br />
Arbeit und Alkohol<br />
Armut, Alkohol und harte Arbeit – all das prägte den Alltag der<br />
Klever Schuster. Unabhängig davon, ob der »Schluffenschuster«<br />
mit seiner Familie und seinen Gesellen das Handwerk in<br />
seiner Wohnung betrieb oder später als Fabrikarbeiter, billiger<br />
Alkohol (besonders Bier und Korn) war in den Jahren vor<br />
1900 ein ständiger Begleiter. Das alltägliche Leben war,<br />
Berichten aus der Zeit zufolge, so ärmlich, dass die Schuster<br />
keine Steuern zahlen mussten, weil sie kein entsprechendes<br />
Einkommen vorweisen konnten.<br />
Die »Schüsterkes« in Kleve haben den Montag häufig<br />
genutzt, um sich zu betrinken und den Rausch besonders im<br />
Tiergarten auszuleben – und das zum Entsetzen der dort<br />
spazierenden sogenannten Bürgerschaft und der Badegäste,<br />
die hierfür wenig Verständnis zeigten. Nichts Genaues weiß<br />
man nicht. Doch eines ist gewiss: »Blau machen« und »Blau<br />
sein«, beides hat eng miteinander und viel mit Alkohol zu tun<br />
und beides geschieht häufig an einem »Blauen Montag«,<br />
was gemeinhin ein Tag ist, an dem nicht gearbeitet wird. Die<br />
Wortverbindung taucht erstmals 1571 in zeitgenössischen<br />
Dokumenten auf. Vielfach wird sie auf die am Rosenmontag<br />
beginnende Verhängung der Altäre mit blauen Tüchern<br />
zurückgeführt.<br />
Doch wahrscheinlicher ist, dass die Blaufärber für diese Sitte<br />
verantwortlich sind. Blau war einfach zu färben, der wichtigste<br />
Grundstoff war das aus Indien stammende Indigo oder<br />
die auch »Deutscher Indigo« genannte Pflanze Färberwald.<br />
Die Blaufärberei erforderte schönes Wetter. An Gerätschaften<br />
war lediglich ein Bottich nötig, der in der Sonne stehen<br />
musste. Die Pflanzenblätter wurden mit Flüssigkeit bedeckt.<br />
Dazu eignete sich aus chemischer Sicht am besten menschlicher<br />
Urin, der in der Sonne schnell zu gären beginnt. Dabei<br />
entsteht Alkohol, der den Farbstoff Indigo aus den Blättern<br />
löst. In alten Rezepten ist vermerkt, dass die Farbe<br />
besonders intensiv wird, wenn ihr zuvor der Urin von Männern<br />
zugeführt wird, die viel Alkohol getrunken haben.<br />
Aber noch sind die Stoffe nicht blau, sie haben nur die unappetitliche<br />
Farbe der Brühe. Die blaue Farbe entsteht erst,<br />
während die Stoffe im Sonnenlicht trocknen. Die Färber<br />
hatten nichts anderes zu tun, als morgens und abends die<br />
Brühe vorsichtig umzurühren, den von der Sonne verdunsteten<br />
Urin aufzufüllen - und vor allem weiterhin für den Alkoholzusatz<br />
zu sorgen. Immer wenn die Färbergesellen am<br />
Montag betrunken in der Sonne lagen, um auf das Ergebnis<br />
zu warten, wusste jeder, dass blau gefärbt wurde, die Färber<br />
waren »blau« und »machten blau«. Auch der Begriff »Blauer<br />
Montag« findet hier seinen Ursprung.<br />
Schüsterkes Traumwasser<br />
Billigen Schnaps sollte heute niemand mehr trinken. Deswegen<br />
bietet das Klever Schuhmuseum einen hochwertigen<br />
Trester an, von dem die Schüsterkes nur träumen konnten.<br />
»Schüsterkes Traumwasser« gibt es in einer edlen Verpackung,<br />
in einer dreieckigen Flasche mit einem von einem<br />
Klever Designer entwickelten Etikett und einem Holzverschluss.<br />
Damit kann aus einem <strong>Museum</strong>sbesuch auch ein<br />
hochprozentig edler Kunstgenuss werden.<br />
Klever Schuhmuseum, Siegertstr. 3, 47533 Kleve<br />
Öffnungszeiten: An Samstagen & Sonntagen: 14:00 bis 17:00 Uhr