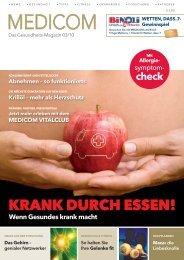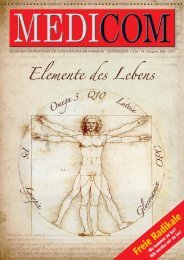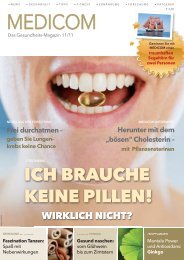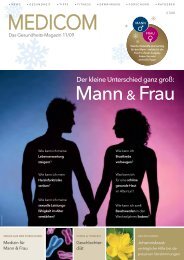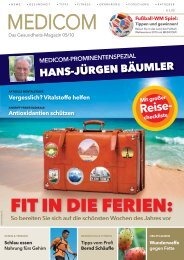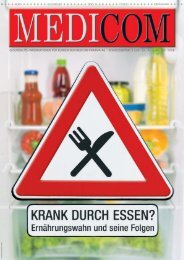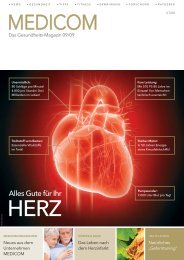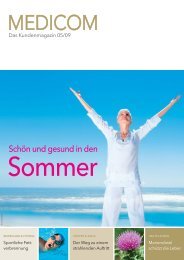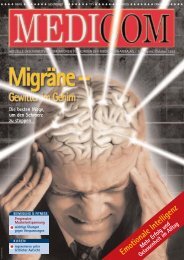MENTAL– MENTAL– MENTAL– MENTAL - Medicom
MENTAL– MENTAL– MENTAL– MENTAL - Medicom
MENTAL– MENTAL– MENTAL– MENTAL - Medicom
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TITELMONTAGE: DPNY<br />
NEWS GESUNDHEIT TIPPS FITNESS ERNÄHRUNG<br />
AKTUELLE GESUNDHEITS-INFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER MEDICOM PHARMA AG . 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Bewegung & Fitness<br />
Yoga<br />
Der Weg zur Harmonie<br />
Körper & Seele<br />
Die neue Einfachheit<br />
Überfluss schafft Überdruss<br />
Glutamat<br />
und das<br />
China-Restaurant-Syndrom
FOTO: BOTANICA<br />
Editorial<br />
A<br />
us dem Bauch heraus. Was das bedeutet,<br />
wissen wir alle. Und doch<br />
eben auch nicht, weil wir es aus dem<br />
Bauch heraus wissen und nicht vom<br />
Kopf aus. „Das, was ich weiß, von<br />
dem ich nicht weiß, dass ich es weiß,<br />
beeinflusst mich mehr, als ich weiß.“<br />
Dieser nur scheinbar paradoxe Satz<br />
trifft das Wesen des „Bauchdenkens“.<br />
Denn tatsächlich „wissen“ wir etwas<br />
da ganz tief unten im Körper. Wissenschaftler<br />
haben ein „Bauchhirn“ entdeckt.<br />
Mit dessen erstaunlichen Fähigkeiten<br />
beschäftigt sich nun ein ganzer<br />
Forschungszweig, die Neurogastroenterologie.<br />
In Studien konnte bereits<br />
bewiesen werden, dass das Darmhirn<br />
das Verdauungssystem kontrolliert,<br />
die Immunabwehr koordiniert, seinen<br />
Nachbarorganen Anweisungen gibt und<br />
sogar über ein Gedächtnis verfügt.<br />
Reisen Sie mit uns durch die faszinierende<br />
Welt des Verdauungssystems und<br />
begleiten Sie einen Apfel durch alle<br />
Stationen unseres Körpers.<br />
Doch was ist, wenn „tief da unten“ doch<br />
nicht alles so „glatt läuft“? Leider hören<br />
wir oft erst auf den Bauch, wenn dieser<br />
Ärger macht. Verdauungsstörungen sind<br />
wohl niemandem unbekannt. Wenn sie<br />
dauerhaft sind, sollten sie ernst genommen<br />
werden, auch wenn oft eine Krankheit<br />
dahinter steckt, die eigentlich gar<br />
keine ist: das Reizdarmsyndrom. Rund<br />
die Hälfte aller Patienten mit Magen-<br />
Darm-Problemen leidet daran.<br />
Unter der Überschrift „Wenn der Bauch<br />
rebelliert und der Arzt nichts findet“<br />
sind wir einem Phantom auf der Spur.<br />
Schmerzen, Unwohlsein, Verdauungsprobleme<br />
– ohne organische Ursache.<br />
Was das ist, wie es sich äußert und was<br />
man dagegen unternehmen kann: Im<br />
Titelthema finden Sie die Fakten.<br />
Unter anderem hilft Entspannung. Und<br />
die lernen Sie besonders gut beim Yoga.<br />
Auf Seite 18 erfahren Sie warum. Dass<br />
der beinahe schon „alte Hut“ unter den<br />
Entspannungstechniken im Moment so<br />
ein fulminantes Revival feiert, kommt<br />
nicht von ungefähr. Es gibt kaum körperliche<br />
und seelische Beschwerden und<br />
Erkrankungen, die von der Unfähigkeit<br />
zur Entspannung nicht negativ beeinflusst<br />
würden.<br />
Viel Spaß beim Lesen wünscht<br />
Ihnen Ihre<br />
Petra Wons<br />
Vorstand der <strong>Medicom</strong> Pharma AG<br />
Entspannung ist heutzutage ein hohes<br />
Gut geworden, denn kaum noch jemand<br />
kann es sich leisten, krank zu werden.<br />
Wie es weitergeht mit der Gesundheitsreform,<br />
bleibt auch weiterhin Thema für<br />
die MEDICOM. Was auf die Versicherten<br />
der gesetzlichen Krankenkassen zukommt:<br />
Sie finden Rechenbeispiele und<br />
Vorschläge zum Geldsparen, damit<br />
Ihnen die Kosten nicht „auf den Magen<br />
schlagen“.<br />
Doch das Magengrimmen kann auch andere<br />
Ursachen haben. Vertragen Sie zum<br />
Beispiel das Essen in Asiarestaurants<br />
nicht gut? Dann kann Glutamat die Ursache<br />
sein – ein Geschmacksverstärker,<br />
der so einigen, vor allem vorgefertigten<br />
Nahrungsmitteln ihre „Würze“ verleiht.<br />
Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind<br />
jedoch weniger weit verbreitet, als man<br />
annimmt. Ob Glutamat zu Gesundheitsschäden<br />
führt oder nicht, lesen Sie im<br />
Beitrag „Glutamat und das China-<br />
Restaurant-Syndrom“.<br />
Ein auf jeden Fall „magenfreundliches“<br />
Vitalstoff-Rezept haben wir für Sie<br />
zusammengeköchelt. Guten Appetit auf<br />
Seite 41.<br />
Nicht nur die Auswahl der Nahrungsmittel<br />
hat Einfluss auf unser Wohlbefinden,<br />
wie Sie sicher wissen. Man kann auch<br />
sein Leben und seine Umgebung so<br />
„vollstopfen“, dass man sich schließlich<br />
selbst blockiert. Wie Sie sich von aufgestautem<br />
Krempel befreien, erfahren Sie<br />
auf der Seite 38 unter dem Motto „Die<br />
neue Einfachheit. Überfluss schafft<br />
Überdruss“.
Inhalt<br />
18<br />
Ab Seite<br />
Neues aus der Forschung:<br />
Glutamat<br />
Er ist fast in jedem vorgefertigten Lebensmittel<br />
zu finden: der Geschmacksverstärker Glutamat.<br />
Besonders häufig wird er in der Asiaküche verwendet.<br />
Ist er wirklich gesundheitsschädlich und gibt<br />
es tatsächlich ein China-Restaurant-Syndrom?<br />
Hier lesen Sie die Fakten.<br />
Körper & Seele:<br />
Die neue Einfachheit<br />
Überfluss schafft Überdruss. Das Leben wird immer komplizierter.<br />
Es gibt immer mehr Dinge, die man beachten muss<br />
und die unsere Aufmerksamkeit fordern. Zeit, sich selbst das<br />
Leben zu erleichtern und mit dem großen Aussortieren zu<br />
beginnen. Entscheiden Sie sich, was in Ihrem Leben gut und<br />
wichtig ist, und verabschieden Sie sich von dem Rest. Das<br />
gilt für Kleider, Möbel und Gegenstände genauso wie für<br />
negative Denkmuster und hinderliche Überzeugungen.<br />
Titelthema: Aus dem Bauch heraus:<br />
Gibt es tatsächlich ein Bauchgefühl?<br />
Der Bauch ist sensibel. Er Was man über Jahrhunderte<br />
ist das Zentrum des Kör- vermutet hatte, konnten Wispers<br />
und auch der Gradsenschaftler jetzt beweisen.<br />
messer für unser Wohlbe- Der Bauch denkt mit. Hier<br />
22<br />
finden. Man „hat die Wut sitzt ein „zweites Gehirn“ –<br />
im Bauch“, „Schmetter- die größte Ansammlung<br />
linge im Bauch“ oder „es von Nervenzellen außerhalb<br />
rutscht einem vor Angst des Kopfes.<br />
das Herz in die Hose“. Ab Seite<br />
12<br />
Ab Seite<br />
Bewegung & Fitness:<br />
Yoga – der Weg zur Harmonie<br />
Prominente wie Cindy Crawford, Uma Thurman, Sting,<br />
Wolfgang Joop und Ursula Karven machen es vor und viele<br />
andere folgen ihnen. Sie finden mit Yoga einen Weg zu<br />
körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit. Yoga trainiert<br />
Körper und Geist, und das für jeden in angemessener Form.<br />
Yoga ist, neben Computerexperten, Indiens begehrtester<br />
Exportartikel in der westlichen Welt.<br />
Ab Seite<br />
38<br />
Kurzmeldungen:<br />
Gicht durch Bier?<br />
Alzheimer: Diabetes des Gehirns?<br />
Statine und Coenzym Q10<br />
Gesundheitsmeldungen<br />
Kopfschmerzen von<br />
Kopfschmerztabletten?<br />
Wie sich Prophezeiungen<br />
selbst erfüllen<br />
Gesundheit & Recht:<br />
Gerichtsurteile<br />
Reform des Gesundheitssystems,<br />
Teil 7<br />
Neues aus der Forschung:<br />
Glutamat und das China-<br />
Restaurant-Syndrom<br />
Mental-Serie:<br />
Aufmerksamkeit:<br />
Grenzenlos? Eingeschränkt?<br />
MEDICOM informiert:<br />
Braunhirse: nichts für Magenund<br />
Darmempfindliche<br />
Bewegung & Fitness:<br />
Yoga – der Weg zur Harmonie<br />
Titelthema:<br />
Aus dem Bauch heraus<br />
Körper & Seele:<br />
Die neue Einfachheit –<br />
Überfluss schafft Überdruss<br />
Essen & Trinken:<br />
Vitalstoff-Rezept<br />
Rubriken:<br />
Editorial<br />
Impressum<br />
Leserbriefe<br />
Rätselseite<br />
4<br />
4<br />
5<br />
5<br />
6<br />
8<br />
9<br />
10<br />
12<br />
15<br />
17<br />
18<br />
22<br />
38<br />
41<br />
2<br />
42<br />
42<br />
43
B<br />
Gicht durch Bier?<br />
ereits zwei Bier am Tag erhöhen<br />
das Risiko, an Gicht zu erkranken,<br />
um das 2,5-Fache im Vergleich zu<br />
keinem Bierkonsum. Zu diesem Ergebnis<br />
kamen Forscher im Rahmen einer<br />
Studie des Massachusetts General<br />
Hospital mit rund 47.000 Männern.<br />
In den Industrienationen leiden etwa<br />
20 Prozent der Männer unter einem<br />
erhöhten Harnsäurespiegel. Sie sind<br />
damit deutlich häufiger von der Gicht<br />
betroffen als Frauen und das Risiko<br />
steigt mit zunehmendem Alter. Doch<br />
die Gicht ist kein unabwendbares<br />
Schicksal, sondern häufig ernährungsbedingt.<br />
Sie galt früher als Krankheit<br />
der Reichen, denn vor allem eine<br />
energie- und fleischreiche Ernährunsgsweise<br />
begünstigt die Entstehung<br />
der Erkrankung.<br />
Betroffene sollten sich daher weitgehend<br />
vegetarisch ernähren und folgende<br />
Ernährungsempfehlungen beachten:<br />
purinreiche Lebensmittel wie Fleisch,<br />
Fisch oder Hülsenfrüchte meiden, auf<br />
Innereien verzichten<br />
purinarme Eiweißlieferanten wie<br />
Milch und Milchprodukte bevorzugen<br />
weitgehender Verzicht auf Alkohol,<br />
vor allem auf Bier<br />
Körpergewicht im Normalbereich<br />
halten<br />
regelmäßige körperliche Bewegung<br />
4<br />
Gichtanfälle treten oft nach gehaltvollem Essen<br />
und reichlichem Alkoholgenuss auf. Betroffene<br />
sollten wenig Fleisch essen und auf Alkohol,<br />
besonders auf Bier, weitgehend verzichten.<br />
FOTO: PHOTODISC<br />
Alzheimer:<br />
Diabetes des Gehirns?<br />
Möglicherweise ist ein Insulinmangel im Gehirn für die Alzheimerkrankheit<br />
verantwortlich. Gibt es den Diabetes Typ 3?<br />
D<br />
iabetespatienten haben ein bis zu<br />
65 Prozent höheres Risiko, an Alzheimer<br />
zu erkranken. Die Wissenschaftler<br />
vermuteten deshalb seit längerer Zeit<br />
einen Zusammenhang zwischen der Alzheimerkrankheit<br />
und einem niedrigen<br />
Insulinspiegel, der für Zuckerkranke<br />
typisch ist. US-amerikanische Forscher<br />
von der Brown Universität in Providence<br />
haben jetzt entdeckt, dass Nervenzellen<br />
im Gehirn nicht nur auf Insulin reagieren<br />
– die Nervenzellen können es selbst produzieren.<br />
Bislang wurde angenommen,<br />
dass nur die Bauchspeicheldrüse Insulin<br />
produzieren kann. Doch die Fähigkeit des<br />
Gehirns, selbst Insulin zu bilden, scheint<br />
sogar sehr wichtig für das Überleben von<br />
Gehirnzellen zu sein. Denn Menschen, die<br />
an der Alzheimerkrankheit leiden, produzieren<br />
sehr viel weniger davon als gesunde<br />
Menschen. Diese Abweichung lässt<br />
sich den Forschern zufolge jedoch nicht<br />
mit den üblichen Stoffwechselerkrankungen<br />
Diabetes Typ 1 und Typ 2 erklären,<br />
sondern hat ihren Ursprung im zentralen<br />
Diabetiker<br />
leiden öfter an<br />
Alzheimer als<br />
gesunde Menschen.<br />
Ist Alzheimer<br />
gar eine<br />
besondere Form<br />
des Diabetes?<br />
Nervensystem. Auch hat diese Form der<br />
Stoffwechselerkrankung keine Auswirkungen<br />
auf den Blutzuckerspiegel. Daher<br />
wird sie von ihnen als Diabetes Typ 3<br />
bezeichnet. Das erhöhte Alzheimerrisiko<br />
von Diabetespatienten wird schon seit<br />
Jahren begleitend dokumentiert. Mediziner<br />
von der Rush Universität in Chicago<br />
beobachteten 824 katholische Nonnen,<br />
Priester und Ordensbrüder, die zu Beginn<br />
der Studie älter als 55 Jahre alt waren.<br />
Jährlich analysierten sie die klinischen<br />
Daten und machten neuropsychologische<br />
Tests, anhand derer man eine Alzheimererkrankung<br />
feststellen kann. Alle Teilnehmer<br />
hatten sich zudem bereiterklärt,<br />
ihre Gehirne nach ihrem Ableben der<br />
Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.<br />
Während der fünfjährigen Studie erkrankten<br />
151 Studienteilnehmer an der<br />
Alzheimerkrankheit, 31 davon litten an<br />
Diabetes. Gleichzeitig war das Alzheimerrisiko<br />
für Diabetiker um 65 Prozent<br />
höher als für ihre nichtzuckerkranken<br />
Glaubensbrüder und -schwestern.<br />
FOTO. PHOTOS.COM
Statine mit Coenzym Q10<br />
kombinieren<br />
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: Cholesterinsenkende<br />
Medikamente, so genannte Statine, sollten zusammen<br />
mit einem Coenzym-Q10-Präparat angewendet werden.<br />
E<br />
in hoher Cholesterinspiegel ist der<br />
größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,<br />
insbesondere für Arteriosklerose.<br />
Zur Senkung des zu hohen<br />
Cholesterinspiegels werden meistens<br />
Statine verordnet, denn die Medikamente<br />
hemmen die körpereigene Produktion<br />
von Cholesterin sehr wirkungsvoll. Fast<br />
vier Millionen Deutsche sind bereits auf<br />
diese Medikamente angewiesen.<br />
Da Statine jedoch nicht nur die körpereigene<br />
Produktion von Cholesterin, sondern<br />
auch die körpereigene Produktion<br />
von Coenzym Q10 hemmen, sollten<br />
Patienten, die Statine einnehmen, auf eine<br />
gute Versorgung mit Coenzym Q10 achten<br />
und täglich 30 mg Coenzym Q10 zu sich<br />
nehmen. Das rät Dr. med. Markus Look,<br />
Internist und Autor des Beitrages der<br />
Arzneimittelkommission der deutschen<br />
Ärzteschaft. Der gesamte menschliche<br />
Körper ist auf das Coenzym Q10 angewiesen,<br />
wegen seines hohen Energiebedarfs<br />
trifft das jedoch ganz besonders<br />
auf den Herzmuskel zu. Ein Mangel<br />
kann hier zu einer Verminderung der<br />
Herzleistung führen. Coenzym Q10 kommt<br />
in fast allen Zellen des menschlichen<br />
Organismus vor. Mit diesem bedeutenden<br />
Element des Stoffwechsels macht der<br />
Körper sich die in Lebensmitteln steckende<br />
Energie nutzbar. Rund 95 Prozent<br />
der gesamten Körperenergie werden<br />
dadurch aktiviert.<br />
Neben seiner Funktion als Energielieferant<br />
schützt das Coenzym Q10 das LDL-<br />
Cholesterin vor dem Angriff durch Freie<br />
Radikale. Erst wenn LDL-Cholesterin<br />
durch die Freien Radikale oxidiert wird,<br />
ist es gefährlich und Ursache für die<br />
Verkalkung und den Verschluss der<br />
Blutgefäße. Das bedeutet, dass das Cholesterin<br />
mit den Statinen zwar gesenkt,<br />
aber bei einem Mangel an Coenzym Q10<br />
auch vermehrt oxidiert wird, was wiederum<br />
extrem gefährlich für die Blutgefäße<br />
ist. Um Herz und Adern doppelt<br />
zu schützen, sollten daher Statine und<br />
Coenzym Q10 zusammen eingenommen<br />
werden.<br />
Coenzym Q10 ist ein notwendiger Bestandteil der Zellen<br />
und unterstützt diese wesentlich bei der Produktion von<br />
Energie. Es bindet die Energie aus den Nährstoffen in ein<br />
Molekül, das ATP (Adenosintriphosphat) genannt wird.<br />
Da das Herz einen ganz besonders hohen Energieumsatz<br />
hat, ist Coenzym Q10 besonders für die Herzzellen von<br />
großer Bedeutung.<br />
GRAFIK: DPNY<br />
Gesundheitsmeldungen<br />
GANZ KURZ<br />
Krebs seltener ein Todesurteil<br />
Eine schlechte und eine gute Nachricht. Die<br />
schlechte Nachricht: Immer mehr Menschen<br />
erkranken an Krebs. Die gute Nachricht:<br />
Immer weniger Krebskranke sterben daran.<br />
Der Grund für die Zunahme der Erkrankungen:<br />
Die Bevölkerung wird immer älter und<br />
damit steigt auch die Zahl der Krebskranken.<br />
Der Grund für die besseren Überlebenschancen:<br />
Schnellere und genauere Diagnoseverfahren,<br />
mehr Menschen nutzen<br />
Vorsorgeuntersuchungen sowie neue und<br />
verbesserte Therapiemöglichkeiten. Heute<br />
werden Tumore oft schon in einem Stadium<br />
erkannt, in dem sie noch gut heilbar sind.<br />
++++++++++++++++++++++++++++++<br />
Lakritze gegen Herpesviren<br />
Herpesviren bleiben nach einer akuten<br />
Infektion in bestimmten Körperzellen im<br />
„Schlummerzustand“. Sobald das Immunsystem<br />
des Betroffenen geschwächt ist,<br />
flammt die Infektion erneut auf. Ein Wirkstoff<br />
der Lakritze lässt die Tarnung der<br />
versteckten Viren auffliegen, worauf die<br />
Zellen mit einem Schutzprogramm reagieren<br />
und sich selbst zerstören. Lakritze wirkt<br />
bislang als erstes Mittel gegen die „schlummernden“<br />
Viren.<br />
++++++++++++++++++++++++++++++<br />
Grüner Tee hält schlank<br />
Die im grünen Tee enthaltenen Substanzen<br />
– die Polyphenole – reduzieren die Zunahme<br />
von Körperfett (bei Mäusen). Das haben<br />
Wissenschaftler vom Deutschen Institut<br />
für Ernährungsforschung (DIfE) Potsdam<br />
herausgefunden. Sie vermuten, dass dieser<br />
Effekt nicht auf eine Appetitminderung,<br />
sondern auf eine verringerte Aufnahme der<br />
Nahrung im Darm und eine gesteigerte<br />
Fettverbrennung zurückzuführen ist.<br />
++++++++++++++++++++++++++++++<br />
Liebesfilme wecken Romantik bei Männern<br />
Sowohl bei Frauen als auch bei Männern<br />
steigt beim Schauen von Liebesfilmen der<br />
Spiegel des weiblichen Geschlechtshormons<br />
Progesteron. Die Männer gaben in der<br />
Studie an, in der Folge habe ihr Bedürfnis<br />
nach Anlehnung und Zärtlichkeit zugenomen.<br />
Actionfilme dagegen treiben den<br />
Testosteronwert (männliches Geschlechtshormon)<br />
von Männern in die Höhe. Bei<br />
Frauen sinkt er.<br />
++++++++++++++++++++++++++++++<br />
Späteres Gebäralter, längeres Leben<br />
Die Lebenserwartung von Frauen, die in<br />
einem höheren Lebensalter gebären, ist<br />
höher als die von Frauen, die jung Kinder<br />
bekommen. Das ergaben Untersuchungen<br />
von finnischen Familienstammbäumen. Die<br />
Forscher vermuten, dass Frauen Anlagen<br />
für das Alter ihrer Erstgeburt und die Zahl<br />
der Kinder von ihrer Mutter erben. Auch<br />
das Lebensalter werde davon beeinflusst.<br />
Die Biologen nehmen an, dass die Evolution<br />
die Langlebigkeit der Frauen, die früher<br />
Kinder bekommen, zugunsten ihrer Fortpflanzungsfähigkeit<br />
opfert.
FOTO: PHOTOS.COM<br />
FOTO: PHOTODISC<br />
Kopfschmerzen<br />
von Kopfschmerztabletten?<br />
In Deutschland leiden etwa drei Millionen Menschen unter täglichen<br />
Kopfschmerzen. Auch Schmerzmittel können Kopfschmerzen<br />
verursachen.<br />
D<br />
er medikamenteninduzierte Kopfschmerz<br />
tritt hier neben anderen<br />
Kopfschmerzformen besonders häufig auf.<br />
So leiden hierzulande etwa 100.000 Menschen<br />
unter diesem dumpf-drückenden<br />
Kopfschmerz. Frauen sind<br />
fünf- bis zehnmal häufiger<br />
betroffen als Männer.<br />
Neuere Studien belegen<br />
eindrucksvoll, wie wichtig<br />
der sorgsame Umgang mit<br />
Schmerzmitteln ist. Oft<br />
verleiten häufige Kopfschmerzen<br />
den Patienten<br />
6<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
dazu, „vorsichtshalber“ ein Schmerz- oder<br />
Migränemittel zu nehmen. Menschen,<br />
die häufig unter Kopfschmerzen leiden,<br />
sollten Kopfschmerzmedikamente aber<br />
nicht länger als drei Tage hintereinander<br />
und auch nicht häufiger als an zehn Tagen<br />
pro Monat einnehmen, sonst kann der<br />
medikamenteninduzierte Kopfschmerz die<br />
Folge sein. Der Kopfschmerz tritt meist<br />
beidseitig auf. Betroffene beschreiben ihn<br />
als dumpf-bohrenden, manchmal auch<br />
pulsierenden Schmerz, der oft von Übelkeit<br />
und leichter Lärm- und Lichtempfindlichkeit<br />
begleitet wird.<br />
Was deutet auf den Teufelskreis<br />
aus Schmerz und Tabletten hin?<br />
Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft<br />
hat Diagnosekriterien erstellt, die<br />
auf einen von Medikamenten verursachten<br />
Kopfschmerz hindeuten. Wenn<br />
folgende Punkte zutreffen, ist die Wahrscheinlichkeit<br />
hoch, dass es sich um<br />
einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz<br />
handelt:<br />
Die Betroffenen leiden pro Monat mehr<br />
als 20 Tage unter Kopfschmerzen<br />
Sie nehmen an mehr als zehn Tagen pro<br />
Monat regelmäßig Schmerzmittel ein<br />
(Mutterkornalkaloide und Triptane oder<br />
auch Schmerzmittelmischpräparate)<br />
Sowohl die Schwere als auch die Häufigkeit<br />
des Kopfschmerzes verschlechtern<br />
sich während dieser Zeit<br />
Grundsätzlich können alle zur<br />
Kopfschmerzbehandlung eingesetzten<br />
Schmerzmittel zum medikamenteninduzierten<br />
Dauerkopfschmerz führen. Vor<br />
allem aber sind Patienten gefährdet, die<br />
ein kombiniertes Schmerzmittel mit<br />
verschiedenen Wirkstoffen regelmäßig<br />
einnehmen. Sicher ist die Diagnose<br />
medikamenteninduzierter Kopfschmerz<br />
jedoch erst, wenn der Kopfschmerz nach<br />
Absetzen der Medikamente entweder ganz<br />
verschwindet oder zu seiner früheren<br />
Häufigkeit zurückkehrt. Darauf weisen<br />
Experten der Deutschen Migräne- und<br />
Kopfschmerz-Gesellschaft hin. „Nur der<br />
Entzug der eingenommenen Präparate<br />
kann den Dauerschmerz wieder nehmen“,<br />
betonen die Experten.<br />
Bei oft auftretenden und lange anhaltenden<br />
Kopfschmerzen sollten Sie von einem Neurologen<br />
die Ursachen abklären lassen<br />
FOTO: STONE
Unterschiedliche Kopfschmerzen<br />
und ihre Symptome<br />
Fast jeder hat einmal Kopfschmerzen.<br />
Etwa 70 Prozent aller Menschen leiden<br />
zeitweise daran. Doch Kopfschmerzen<br />
sind nicht gleich Kopfschmerzen. Migräne<br />
und Spannungskopfschmerz lauten<br />
die häufigsten Diagnosen. Insgesamt<br />
sind aber 165 verschiedene Formen von<br />
Kopfschmerzen bekannt.<br />
Was unterscheidet die Migräne vom<br />
Spannungskopfschmerz?<br />
Migräne<br />
Migräne tritt in Attacken auf und äußert<br />
sich zumeist in einseitigen pulsierenden<br />
Kopfschmerzen, die bei körperlicher<br />
Betätigung zunehmen. Fast immer ist sie<br />
von Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen,<br />
Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit und der<br />
Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten<br />
Gerüchen begleitet. Die Attacken<br />
dauern zwischen vier und 72 Stunden.<br />
Bei ungefähr zehn bis 15 Prozent der<br />
Betroffenen tritt vor den eigentlichen<br />
Schmerzen die so genannte „Migräneaura“<br />
auf. Darunter verstehen Fachleute<br />
neurologische Störungen wie Sehstörungen,<br />
Wahrnehmung von Lichtblitzen und<br />
gezackten Lichtlinien und Gesichtsfeldeinschränkungen.<br />
Auch Gleichgewichtsoder<br />
Gefühlsstörungen können auftreten.<br />
Die Aura entwickelt sich zumeist über<br />
einen Zeitraum von zehn bis 30 Minuten<br />
und geht dann wieder zurück.<br />
Bei der Migräne treten<br />
die Schmerzen häufig<br />
einseitig auf. Sie werden<br />
als pulsierend oder<br />
pochend beschrieben.<br />
Begleitet werden sie<br />
von Appetitlosigkeit<br />
(fast immer), Übelkeit<br />
(80 %), Erbrechen<br />
(40–50 %) , Lichtscheu<br />
(60 %), Lärmempfindlichkeit<br />
(50 %) und<br />
Überempfindlichkeit<br />
gegenüber bestimmten<br />
Gerüchen (10 %).<br />
Eine genaue Diagnose ist die wichtigste<br />
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung<br />
der Migräne. Sie kann am besten<br />
in einem ausführlichen Gespräch mit<br />
Ihrem Arzt gestellt werden. Sonderuntersuchungen<br />
wie die Computertomografie<br />
sind nur bei bestimmten zusätzlichen<br />
Symptomen notwendig. Sie werden<br />
durchgeführt, um eine Hirnblutung oder<br />
einen Tumor auszuschließen.<br />
Spannungskopfschmerz<br />
Der Spannungskopfschmerz äußert sich<br />
durch leichte bis mäßige Schmerzen beidseitig<br />
im Kopf. Die Schmerzen beginnen<br />
häufig im Nacken und breiten sich dann<br />
über die Kopf- und Schläfenregion bis in<br />
das Gesicht aus. Der Schmerz ist dumpf,<br />
drückend oder ziehend. Manchmal können<br />
auch Übelkeit, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit<br />
oder Schwindel vorkommen,<br />
sie sind aber in der Regel schwächer<br />
ausgeprägt als bei der Migräne. Spannungskopfschmerz<br />
kann Minuten oder<br />
Tage anhalten. Man unterscheidet zwischen<br />
gelegentlichem und chronischem<br />
Schmerz. Wenn der Kopfschmerz an<br />
wenigstens 15 Tagen im Monat auftritt,<br />
spricht man von einem chronischen<br />
Spannungskopfschmerz. Bewegung und<br />
Ablenkung können den Schmerz lindern.<br />
Treten die Schmerzen häufiger auf, sollte<br />
man einen Arzt aufsuchen.<br />
Der Spannungskopfschmerz<br />
tritt meist<br />
beidseitig auf und<br />
wird durch körperliche<br />
Aktivität nicht verstärkt.<br />
Er kann Minuten oder<br />
Tage dauern. Übelkeit,<br />
Geräusch- und Lichtempfindlichkeit<br />
können<br />
(schwächer ausgeprägt)<br />
auftreten.<br />
FOTO: PHOTOS.COM<br />
Thomas Spengler<br />
GESUNDHEIT DURCH VITALSTOFFE<br />
Informationen und Studien<br />
zum Nutzen von Vitalstoffen<br />
für den menschlichen Körper<br />
Bewahren uns Antioxidantien vor Krebs?<br />
Können Vitamine vor Arteriosklerose schützen?<br />
Verhindern Vitalstoffe Herz-Kreislauf-Erkrankungen?<br />
Oft gestellte Fragen, die niemand eindeutig beantworten<br />
kann. Auch in diesem Buch spielen diese<br />
Fragen eine große Rolle. Der Autor verspricht Ihnen<br />
keine Antworten, aber Sie werden sich nach dem<br />
Lesen dieses Buches sicher ein besseres Bild von der<br />
Leistungsfähigkeit von Vitalstoffen machen können.<br />
Neben einem kurzen einführenden Teil zur allgemeinen<br />
Funktion von Vitalstoffen werden über<br />
50 Studien zu ausgewählten Vitalstoffen kurz zusammengefasst.<br />
Lesen Sie in den Originalstudien,<br />
was es wirklich mit Vitalstoffen auf sich hat.<br />
Der Nutzen von Nahrungsergänzungen für die<br />
Gesundheit wird oft zwiespältig diskutiert. Der Autor<br />
stellt die derzeitige Rolle von Nahrungsergänzungen<br />
dar, zeigt die Möglichkeiten und Grenzen von<br />
Nahrungsergänzungen auf und beleuchtet, warum<br />
Vitalstoffe – sei es aus der Ernährung oder aus<br />
Nahrungsergänzungen – so wichtig für den<br />
Menschen sind.<br />
Bestellung über:<br />
IB Logistics GmbH<br />
Kennwort: Buchversand<br />
Rudolf-Diesel-Weg 10<br />
30419 Hannover<br />
Telefax: 0511 9843433<br />
ISBN 3-00-012604-X<br />
Preis: € 12,95<br />
Anzeige
FOTO: BRAND X PICTURES, DPNY<br />
Schon Voraussagungen können ausreichen, damit das Vorausgesagte<br />
tatsächlich eintritt. Psychologische Studien haben jetzt<br />
die destruktive Kraft von so genannten „self-fulfilling-prophecys“<br />
bewiesen.<br />
I<br />
Prophezeiungen<br />
n einer neuen Studie befragten US-<br />
Psychologen 115 Elternpaare, wie<br />
viel Alkoholkonsum sie bei ihren Teenagerkindern<br />
in Zukunft vermuteten. Die<br />
Kinder selbst füllten zur gleichen Zeit<br />
Fragebogen aus, in denen sie ihre derzeitigen<br />
Trinkgewohnheiten angaben.<br />
Ein Jahr später wurden die Kinder erneut<br />
befragt. Das Ergebnis: Hatten die Eltern<br />
die Trinkgewohnheiten des Kindes überschätzt,<br />
näherte sich der Konsum des Betroffenen<br />
im Laufe eines Jahres der Schätzung<br />
der Eltern an. Zu diesem Ergebnis<br />
kamen die Forscher, nachdem sie alle<br />
anderen Risikofaktoren für einen hohen<br />
Alkoholkonsum ausgeschlossen hatten.<br />
Die „sich selbst erfüllende Prophezeiung“<br />
war noch stärker, wenn sowohl der Vater<br />
als auch die Mutter von ihrem Kind einen<br />
stärkeren Alkoholkonsum erwarteten.<br />
Im Gegensatz dazu kam es zu keinem<br />
Anstieg des Konsums, wenn die Eltern<br />
den Konsum des Kindes unterschätzten.<br />
8 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Wie sich<br />
selbst erfüllen<br />
Das Phänomen der „sich selbst erfüllenden<br />
Prophezeiung“ (engl.: self-fulfillingprophecy)<br />
ist nicht neu. Der Psychotherapeut<br />
Paul Watzlawick hat folgende Definition<br />
dafür gefunden:<br />
„Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung<br />
ist eine Annahme oder Voraussage,<br />
die rein aus der Tatsache heraus, dass<br />
sie gemacht wurde, das angenommene,<br />
erwartete oder vorhergesagte Ereigniss<br />
zur Wirklichkeit werden lässt und so ihre<br />
eigene `Richtigkeit´ bestätigt.“<br />
Mit anderen Worten: Wenn ich der Überzeugung<br />
bin, dass etwas eintritt, sorge<br />
ich – oft unbewusst – dafür, dass dies<br />
tatsächlich geschieht. So erfüllt sich meine<br />
Vorhersage von selbst. Sind Eltern zum<br />
Beispiel der Ansicht, ihr Kind bleibe<br />
dumm, dann wird es das aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach auch – unabhängig<br />
von seiner tatsächlichen Intelligenz – bleiben.<br />
Zum einen weil es versucht, den<br />
Erwartungen und Überzeugungen seiner<br />
„Wer es glaubt, wird selig“,<br />
meinen Zweifler. „Was man<br />
glaubt, wird wahr“, haben<br />
Wissenschaftler jetzt bewiesen.<br />
Eltern in jeder Form gerecht zu werden,<br />
und zum anderen, weil es höchstwahrscheinlich<br />
nicht so gefördert wird wie ein<br />
Kind, von dem man annimmt, dass es<br />
besonders intelligent sei. So entsteht ein<br />
Teufelskreis aus Überzeugung und der<br />
Bestätigung der Überzeugung. Schon<br />
immer wurde vermutet, dass sich selbst<br />
erfüllende Prophezeiungen gerade bei der<br />
Entwicklung von Kindern eine große<br />
Rolle spielen. Bislang gab es jedoch noch<br />
sehr wenige aussagefähige Studien zu<br />
dem Thema. Eine weitere Studie hat jetzt<br />
zudem gezeigt, dass negative Erwartungen<br />
auch die Leistung mindern können.<br />
Was man bisher nur vermutete, konnte<br />
jetzt bewiesen werden: Abwertende Vorurteile<br />
beeinflussen Menschen so, dass sie<br />
den geringeren an sie gestellten Erwartungen<br />
letztlich entsprechen. Anders<br />
gesagt: Negative Vorurteile wirken sich<br />
auf destruktive Weise auf die Betroffenen<br />
aus – auch wenn diese davon überzeugt<br />
sind, dass das Vorurteil unberechtigt ist.<br />
Ein Forschungsprojekt über die Wirkung<br />
von „Blondinenwitzen“ hat bestätigt,<br />
dass blonde Frauen, mit dem Urteil<br />
„Blondinen sind dumm“ konfrontiert,<br />
tatsächlich Leistungseinbußen aufweisen.<br />
Der Sozialpsychologe Professor Jens<br />
Förster von der Internationalen Universität<br />
Bremen hat 80 Frauen, die Hälfte<br />
davon blond, mit Witzen – zum Teil über<br />
Blondinen – konfrontiert und danach<br />
zum Intelligenztest gebeten. Das überraschende<br />
Ergebnis der Studie: Diejenigen<br />
blonden Frauen, die Blondinenwitze<br />
gelesen hatten, lösten weniger Prüfungsaufgaben<br />
als ihre blonden Geschlechtsgenossinnen,<br />
die an den Test gingen,<br />
ohne derartige Witze gelesen zu haben.
§<br />
GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT §GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT GERICHTSURTEILE IN SACHEN GE<br />
Chefarztbehandlung<br />
nicht ohne Chefarzt<br />
Hat ein Klinikpatient einen Wahlleistungsvertrag<br />
für eine Chefarztbehandlung<br />
unterschrieben, diesen während<br />
seines Krankenhausaufenthaltes jedoch<br />
nie zu Gesicht bekommen, muss der<br />
Patient auch nicht für die Spezialbehandlung<br />
bezahlen. Um eine<br />
Privatrechnung zu schreiben, muss<br />
der Chefarzt schon selbst behandeln.<br />
LG Konstanz,<br />
AZ: 2 0 58/02<br />
�<br />
Taube Zunge nach<br />
Zahnarztbesuch<br />
Nach einer Betäubungsspritze beim<br />
Zahnarzt klagte eine Patientin über<br />
ein dauerhaftes Taubheitsgefühl in<br />
der rechten Zungenhälfte. Der Zahnarzt<br />
hatte beim Spritzen den Zungennerv<br />
beschädigt. Dies kommt selten<br />
vor, dennoch hätte der Mediziner<br />
seine Patientin über dieses Risiko im<br />
Vorfeld aufklären müssen. Das Gericht<br />
sprach der Klägerin 6.000 Euro<br />
Schmerzensgeld zu.<br />
OLG Koblenz,<br />
�<br />
AZ: 5 U 41/03<br />
Verdauungsprobleme<br />
kein Grund für Schadenersatz<br />
im Urlaub<br />
Eine ganze Familie litt während eines<br />
Urlaubsaufenthaltes in der Türkei an<br />
Durchfall. Wie ihnen ging es von<br />
900 Hotelgästen noch 22 weiteren<br />
Urlaubern. Deshalb vermutete die<br />
Familie mangelnde Hygiene in der<br />
Hotelküche und klagte auf Schadenersatz.<br />
Die Klage wurde jedoch<br />
abgewiesen, weil Vermutungen nicht<br />
ausreichen und Durchfall im Orient<br />
nicht ungewöhnlich ist.<br />
AG Hannover,<br />
AZ: 502 C 1714/02<br />
GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT GERICHTSURTEILE IN SACHEN GESUNDHEIT<br />
Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität<br />
können wir nicht übernehmen.<br />
Kassenwechsel bei<br />
Beitragserhöhungen<br />
Ein Versicherter der Taunus Betriebskrankenkasse<br />
(Taunus BKK) sollte<br />
nach deren Zusammenschluss mit der<br />
Novartis BKK einen höheren Versicherungsbeitrag<br />
zahlen. Er kündigte unter<br />
Berufung auf das Recht, bei Beitragserhöhungen<br />
wechseln zu können.<br />
Seine alte Kasse und ihr neuer Partner<br />
akzeptierten die Kündigung nicht, da<br />
es sich um eine „erstmalige Beitragsfestsetzung“<br />
einer „neuen Kasse“ handeln<br />
würde. Das Bundessozialgericht<br />
gab jedoch dem Versicherten Recht.<br />
Die Kassen dürfen nach einem Zusammenschluss<br />
und einer Beitragserhöhung<br />
den Mitgliedern das Sonderkündigungsrecht<br />
nicht verwehren.<br />
BSG,<br />
AZ: B 12 KR 15/04<br />
�<br />
Schlingern: bei<br />
Kreuzfahrten normal<br />
Die Reisenden auf einem Kreuzfahrtschiff<br />
müssen auf Schlingerbewegungen<br />
des Schiffes bei starkem Seegang<br />
gefasst sein. Stürzen die Passagiere<br />
an Bord bei einem Sturm und verletzen<br />
sich dabei, ist der Veranstalter<br />
dafür nicht haftbar.<br />
LG Bremen,<br />
AZ: 7 0 124/03<br />
Gut festhalten heißt es bei der Kreuzfahrt,<br />
wenn das Schiff mächtig<br />
schaukelt. Für „Sturmschäden“<br />
am Passagier ist der<br />
Veranstalter nicht<br />
haftbar.<br />
Alternative Therapien<br />
werden nicht immer<br />
erstattet<br />
Eine privat versicherte Patientin nahm<br />
nach einer überwundenen Brustkrebserkrankung<br />
über die normale<br />
Nachsorge hinaus zwei alternative<br />
Therapien in Anspruch (Kohlendioxidbehandlung,<br />
vaginale Moortherapie).<br />
Da private Krankenkassen alternative<br />
Therapieformen oft auch erstatten,<br />
ging die Patientin davon aus, dass ihre<br />
Kasse dies auch in diesem Falle tun<br />
würde. Die Kasse lehnte ab und bekam<br />
Recht. Begründung: Bei alternativen<br />
Methoden muss es sich um solche<br />
Verfahren handeln, die den Nachweis<br />
klinischer Wirksamkeit erbringen<br />
können. Außenseitermethoden, die auf<br />
spekulativen Denkmodellen beruhen,<br />
sind davon abzugrenzen und daher<br />
nicht erstattungsfähig.<br />
OLG Köln,<br />
AZ: 5 U 211/01<br />
9<br />
FOTO: PHOTODISC<br />
ILLUSTRATION: NILS WASSERMANN
D<br />
Sparen trotz höherer Gesundheitsausgaben?<br />
Herr Meyer hat es durchgerechnet<br />
und zeigt Ihnen,<br />
wie es geht.<br />
Reform<br />
as ist schon skandalös: Einige<br />
Kassen erwirtschaften im Zuge der<br />
Gesundheitsreform hohe Gewinne, senken<br />
aber nicht die Beiträge der Versicherten,<br />
sondern erhöhen die Gehälter<br />
ihrer Vorstände um erhebliche Summen.<br />
Kein Wunder, dass eine repräsentative<br />
Umfrage der Zeitschrift Stern ergeben<br />
hat, dass 47 Prozent aller gesetzlich<br />
Krankenversicherten der Meinung sind,<br />
dass die Hauptgewinner der Gesundheitsreform<br />
2004 die Krankenkassen<br />
sind. Ziel der Gesundheitsreform war es,<br />
die Beitragszahler zu entlasten, aber<br />
10 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Herr Meyer, die Internetapotheke und<br />
der Hausarzt<br />
lediglich ein Prozent der Befragten gaben<br />
an, dass sie sich als Begünstigte sehen.<br />
Die im Jahr 2004 erwirtschafteten Überschüsse<br />
der gesetzlichen Krankenkassen<br />
von zirka vier Milliarden Euro sollen<br />
nämlich nach Angaben der Kassen<br />
zum Schuldenabbau verwendet werden.<br />
40 Prozent der Studienteilnehmer fordern<br />
jedoch die von den Politikern in<br />
Aussicht gestellte Beitragssenkung.<br />
Das wird jetzt geschehen. Die Kassen<br />
werden ab dem 1. Juli 2005 per Gesetz<br />
dazu verpflichtet, die Beiträge der Versicherten<br />
um 0,9 Prozentpunkte zu senken.<br />
Teil 7<br />
des Gesundheitssystems<br />
Im Durchschnitt zahlte jeder Bundesbürger<br />
seit der Gesundheitsreform 150 Euro<br />
mehr im Jahr.<br />
Auch wenn die Kassen ab Juli ihre<br />
Beiträge senken müssen: Die künftigen<br />
neuen Zuzahlungen für Zahnersatz und<br />
Krankengeld machen für den Versicherten<br />
ab dem 1. Juli 2005 diese Ersparnis<br />
von 0,9 Prozent wieder zunichte – dabei<br />
ist der Arbeitgeberanteil, der dann zum<br />
Teil auch vom Arbeitnehmer übernommen<br />
werden muss, noch nicht einmal<br />
berücksichtigt.<br />
ILLUSTRATIONEN AUF DEN SEITEN 10 UND 11: NILS WASSERMANN
Was ändert sich ab dem 1. Juli 2005 ?<br />
Arbeitnehmer Meyer hat ein Bruttogehalt von 2.500 Euro.<br />
Der Beitragssatz seiner Krankenkasse beträgt im Moment 14 Prozent<br />
seines Einkommens. Er zahlt für seine Krankenversicherung<br />
im Moment also einen Arbeitnehmeranteil von 175 Euro. Sein<br />
Arbeitgeber zahlt die andere Hälfte, ebenfalls 175 Euro.<br />
Ab dem 1. Juli 2005 sinken die Krankenkassenbeiträge<br />
um 0,9 Prozentpunkte.<br />
Davon profitieren Arbeitnehmer Meyer<br />
und sein Arbeitgeber jeweils zur Hälfte.<br />
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen ab<br />
jetzt 163,75 Euro, sie sparen also jeweils<br />
11,25 Euro. Ab Juli muss Herr Meyer aber<br />
auch einen zusätzlichen Beitrag für Zahnersatz<br />
in Höhe von 0,4 Prozentpunkten<br />
zahlen. In seinem Fall sind dies 10 Euro.<br />
1.<br />
Die meisten Krankenkassen bieten bereits ein Hausarztmodell<br />
an oder testen es gerade. Das Programm<br />
bedeutet für Herrn Meyer, dass er im Krankheitsfall<br />
immer erst zu seinem Hausarzt geht. Der Hausarzt<br />
koordiniert seine Behandlung, überweist ihn im<br />
Bedarfsfall an Fachärzte und Kliniken und sammelt<br />
seine Unterlagen. Wenn er an einem Hausarztprogramm<br />
teilnimmt, winken für Herrn Meyer, je nach<br />
Kasse, bei der er versichert ist, Vergünstigungen wie<br />
zum Beispiel der Wegfall der<br />
Praxisgebühr. Herr Meyer<br />
und andere Versicherte<br />
können sich freiwillig für<br />
ein solches Programm<br />
entscheiden. Fragen Sie<br />
bei Ihrer Kasse nach,<br />
wenn Sie wissen möchten,<br />
welche Bedingungen<br />
Ihre Kasse anbietet.<br />
Zudem muss er künftig auch den neuen<br />
Beitrag zum Krankengeld in Höhe von<br />
0,5 Prozentpunkten allein übernehmen,<br />
der Arbeitgeber trägt hier nicht die<br />
Hälfte. Herr Meyer zahlt für das neue<br />
Krankengeld also zusätzlich 12,50 Euro.<br />
Der Krankenkassenbeitrag von Herrn<br />
Meyer erhöht sich demnach insgesamt<br />
auf 186,25 Euro, während der Arbeitgeberbeitrag<br />
bei 163,75 Euro bleibt.<br />
TIPP Das Hausarztmodell<br />
TIPP Die Internetapotheke<br />
3.<br />
TIPP<br />
Die Bonusprogramme<br />
Herr Meyer kann Bonusprogramme in Anspruch<br />
nehmen. Ein Bonus können beispielsweise eine Ermäßigung<br />
bei Zuzahlungen oder niedrigere Beiträge<br />
sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kasse nach Boni<br />
Spartipps<br />
2.<br />
Herr Meyer muss also zusätzlich den<br />
Beitragsanteil (11,25 Euro) tragen, um den<br />
sich der Anteil seines Arbeitgebers verringert.<br />
Höchste Zeit für Herrn Meyer, sich<br />
nach Möglichkeiten zum Sparen umzusehen!<br />
Neben einem Wechsel in eine<br />
günstigere Kasse bieten sich ihm und<br />
anderen gesetzlich Krankenversicherten<br />
einige Möglichkeiten. Wir stellen Ihnen<br />
hier drei Varianten vor.<br />
Herr Meyer kann seine apothekenpflichtigen<br />
Arzneimittel<br />
auch bei einer Versandapotheke<br />
bestellen – per Post,<br />
per Telefon oder per Internet.<br />
In Internetapotheken<br />
zu bestellen, kann sich<br />
lohnen. Besonders, wenn<br />
Herr Meyer regelmäßig<br />
Medikamente braucht.<br />
Finden Sie das interessant?<br />
Klären Sie mit Ihrer Krankenkasse, welche<br />
Versandapotheken sie anerkennt, und<br />
lassen Sie sich ein Verzeichnis zuschicken.<br />
Informieren Sie sich bei den einzelnen<br />
Versandapotheken ganz genau nach den<br />
Preisen, Lieferbedingungen, -zeiten und wie<br />
Sie Ihre Rezepte einreichen müssen.<br />
für gesundheitsbewusstes Verhalten,<br />
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen<br />
oder für die Teilnahme an zugelassenen<br />
strukturierten Behandlungsprogrammen<br />
(so genannten Diseasemanagementprogrammen).<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
11
FOTO: IMAGESOURCE<br />
Auch in Tomaten enthalten: Glutamat.<br />
Von vielen wird er wegen seiner<br />
geschmacklichen Eigenschaften und der<br />
Möglichkeit der Salzreduktion geschätzt.<br />
12 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Glutamat<br />
und das China-<br />
Restaurant-Syndrom<br />
Der Geschmacksverstärker Glutamat gerät erneut in die Schlagzeilen.<br />
Ist er wirklich gesundheitlich bedenklich oder doch unschädlich?<br />
N<br />
ach dem Essen in China- und anderen<br />
Asiarestaurants verspüren manche<br />
Menschen immer wieder seltsame<br />
Symptome: Kribbeln oder Taubheitsgefühl<br />
im Nacken, in den Armen und im<br />
Rücken, Schwächegefühl, Herzklopfen,<br />
Schwindel, Kopfschmerzen, Engegefühl<br />
in der Brust. Als Auslöser<br />
verdächtigt:<br />
der Geschmacksverstärker<br />
Glutamat, der in der<br />
asiatischen Küche besonders reichlich<br />
zum Würzen verwendet wird. Als<br />
Verursacher des China-Restaurant-<br />
Syndroms geriet Glutamat so bereits in<br />
den 70er-Jahren in die Schlagzeilen.<br />
Zahlreiche Untersuchungen konnten<br />
diese Unverträglichkeitsreaktionen<br />
jedoch nicht<br />
direkt mit dem Glutamat im Essen in<br />
Verbindung bringen, zumal in der<br />
Asiaküche auch andere, für Europäer<br />
fremde Zutaten und Gewürze verwendet<br />
werden, die theoretisch ebenfalls Allergien<br />
oder pseudoallergische Reaktionen<br />
auslösen können. Im Gegenteil: Die<br />
Ernährungsministerien fast aller Länder<br />
stufen den Geschmacksverstärker, der<br />
auch unter den E-Nummern E 620 bis<br />
E 625 bekannt ist, auf Basis verschiedener<br />
Studien als unbedenklich ein. Inzwischen<br />
hat Glutamat seinen Weg auch in die<br />
europäische Küche gefunden. Keineswegs<br />
nur beim Chinesen begegnen wir dem<br />
von Glutamat erzeugten Geschmack,<br />
den Japaner<br />
als „umami“, als<br />
„köstlich“ bezeichnen.<br />
Glutamat wird also nicht nur wegen seiner<br />
geschmacksverstärkenden Wirkung<br />
eingesetzt, sondern gilt inzwischen neben<br />
süß, sauer, salzig und bitter als fünfte<br />
Geschmacksrichtung. Sie ähnelt dem<br />
Geschmack einer Bouillon und schmeckt
Ob Roquefort, Parmesan, Gouda,<br />
Camembert oder Brie – als natürlicher<br />
Bestandteil ist Glutamat reichlich in<br />
Käse enthalten<br />
würzig-pikant. Vor allem industriell vorgefertigten<br />
Lebensmitteln wie Fertiggerichten<br />
wird zusätzlich Glutamat zugegeben.<br />
Allen voran: Brühwürfeln und Tütensuppen.<br />
Auch Knabbereien wie Kartoffelchips<br />
und Würzmitteln wird viel Glutamat<br />
zugefügt. (Welche weiteren Lebensmittel<br />
viel Glutamat enthalten, entnehmen Sie<br />
bitte der nebenstehenden Tabelle.)<br />
Nun wurde ein neuer Verdacht geäußert,<br />
nach dem Glutamat das Risiko, an einer<br />
bestimmten Art von grünem Star<br />
zu erkranken (Normaldruckglaukom),<br />
erhöhen soll. Diese spezielle Glaukomerkrankung,<br />
die besonders oft in Asien<br />
vorkommt, wo viel Glutamat konsumiert<br />
wird, könne jedoch auch genetisch<br />
bedingt sein, räumen die Forscher ein.<br />
Was ist nun von Glutamat zu halten?<br />
Nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft<br />
für Ernährung (DGE) ist die Verwendung<br />
von Glutamat zur Würzung von Speisen<br />
für die Allgemeinheit unbedenklich.<br />
Glutamat findet sich von Natur aus in<br />
fast allen Lebensmitteln und auch in<br />
der Muttermilch. Die wissenschaftlich<br />
korrekt als Glutaminsäure bezeichnete<br />
Aminosäure und ihre Salze, die Glutamate,<br />
geben zum Beispiel Käse und<br />
Tomaten ihren besonders würzigen<br />
Geschmack. Auch der Körper selbst bildet<br />
Glutaminsäure, die als Botenstoff im<br />
Gehirn eine wichtige Rolle spielt. Als<br />
Neurotransmitter, also als Nervenboten-<br />
FOTO: IMAGESOURCE<br />
stoff, ist Glutaminsäure unter anderem<br />
an der Schmerzübertragung, am Körperwachstum,<br />
an der Gewichtsregulierung<br />
und an der Appetitsteuerung beteiligt. Im<br />
Gehirn wird Glutamat (Glutaminsäure)<br />
von den Hirnzellen selbst produziert. Die<br />
überwiegende Zahl der Experten ist der<br />
Ansicht, dass das über die Nahrung aufgenommene<br />
Glutamat nicht ins Gehirn<br />
vordringen kann, weil es die so genannte<br />
Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann.<br />
Die Blut-Hirn-Schranke sorgt dafür, dass<br />
keine unerwünschten Stoffe aus dem Blut<br />
ins Gehirn vordringen können.<br />
Hier setzen die Kritiker an und stell<br />
e n<br />
infrage, ob Glutamat bei<br />
Sojasoße enthält<br />
besonders viel<br />
Glutamat und<br />
wird in der Asia-<br />
Küche reichlich<br />
verwendet.<br />
Unser Körper enthält<br />
von Natur aus etwa<br />
zehn Gramm freies<br />
Glutamat. Der größte<br />
Anteil ist im Gehirn,<br />
in den Muskeln, der<br />
Leber und in den<br />
Nieren zu finden.<br />
Gehirn 2,3 g<br />
Muskeln 6,0 g<br />
Leber 0,7 g<br />
Nieren 0,7 g<br />
Blut 0,04 g<br />
Menschen mit Erkrankungen, die die<br />
Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigen –<br />
wie zum Beispiel bei Morbus Alzheimer<br />
oder nach einem Schlaganfall – tatsächlich<br />
nicht ins Gehirn vordringen und<br />
wichtige Nervenvorgänge beeinflussen<br />
kann. Selbst bei gestörter Blut-<br />
Hirn-Schranke kann eine schädigende<br />
Wirkung jedoch, wenn überhaupt, nur<br />
bei extrem hohen Dosen auftreten. Und<br />
diese sind bei normalen Ernährungsgewohnheiten<br />
nur sehr<br />
schwer<br />
Welche Lebensmittel<br />
enthalten viel Glutamat?<br />
Als natürlichen Bestandteil:<br />
Tomaten, Tomatensaft<br />
Käse (Roquefort, Parmesan, Gouda, Camembert, Brie)<br />
Als Zusatzstoff:<br />
pikantes Knabbergebäck aus Kartoffeln oder Getreide<br />
wie Käsestangen, Kartoffelchips usw.<br />
Sojasoße, Tomatenketchup, Würzsoßen, Worcestersoße,<br />
Brühwürfel, Hefeextrakte, Fleischextrakte<br />
Fisch, Fleischpasteten, Dosen- und Tütensuppen<br />
GRAFIK: DPNY
FOTO: IMAGESOURCE<br />
z u<br />
erreichen. Eine andere Risikogruppe sind<br />
Menschen, die pseudoallergisch auf<br />
Glutamat reagieren.<br />
Zur Erklärung<br />
Allergie und Pseudoallergie<br />
Bei einer „echten“ Allergie wird das<br />
Krankheitsbild durch eine fehlgeleitete<br />
Antikörperfreisetzung des Immunsystems<br />
verursacht. Bei einer Pseudoallergie ist<br />
der Wirkmechanismus direkter und<br />
erfolgt ohne Antikörperfreisetzung. Die<br />
Pseudoallergie wird vor allem durch<br />
Lebensmittelzusatzstoffe (z. B. Glutamat,<br />
Azofarbstoffe) ausgelöst, aber auch durch<br />
bestimmte Lebensmittelbestandteile (z. B.<br />
Histamin). Fakt ist, dass einzelne Personen<br />
möglicherweise tatsächlich extrem<br />
sensibel auf Glutamat reagieren können.<br />
Was tun?<br />
Sollten Sie der Ansicht sein, auf Glutamat<br />
empfindlich zu reagieren – zum Beispiel<br />
nach dem Besuch eines Asiarestaurants –,<br />
sollten Sie beim Allergologen prüfen lassen,<br />
ob bei Ihnen eine Glutamatempfindlichkeit<br />
vorliegt. Es empfiehlt sich, vorher<br />
ein Ernährungssymptomtagebuch zu<br />
führen, in dem alle eventuellen Verdachtsmomente<br />
festgehalten werden. So können<br />
Sie der Unverträglichkeit besser auf die<br />
Spur kommen und dem Allergologen bei<br />
Natürlich vorkommendes<br />
Glutamat (z. B. in der Tomate)<br />
und industriell gewonnenes<br />
Glutamat (z. B. in Brühwürfeln)<br />
werden vom Körper gleich<br />
behandelt und unterscheiden<br />
sich weder in der Aufnahme<br />
noch in ihren Stoffwechseleigenschaften.<br />
Chips schmackhaft gemacht: Die<br />
Geschmacksintensivierung durch den<br />
Zusatz von Glutamat spielt bei der<br />
Auswahl von Lebensmitteln eine<br />
entscheidende Rolle<br />
seiner Diagnosestellung<br />
behilflich sein. Im<br />
gegebenen Fall sollten<br />
Sie von mit Glutamat<br />
gewürzten Speisen absehen<br />
und<br />
Lebensmittel mit einem<br />
hohen natürlichen Anteil<br />
an Glutamat mit<br />
Vorsicht genie-ßen.<br />
Am besten mei-den<br />
Sie Fertiggerichte<br />
völlig. Wie bereits<br />
erwähnt ist Glutamat, wenn es Lebensmitteln<br />
hinzugefügt wird, üblicherweise<br />
mit den<br />
E-Nummern E 620 bis<br />
E 625 auf der Zutaten-liste aufgeführt.<br />
Es kann sich jedoch auch hinter Bezeichnungen<br />
wie Hefeextrakt, Geschmacksverstärker,<br />
Würze oder Würzmittel verbergen.<br />
Ein<br />
Hinweis: Oft wird Glutamat Lebensmitteln<br />
zugegeben, denen vorher Wasser entzogen<br />
wurde und die dadurch an<br />
natürlichem Geschmack verloren haben<br />
(z. B. Tütensuppen).<br />
Gefährlich oder nicht?<br />
Gesunden Personen, die keine Glutamatunverträglichkeit<br />
haben, werden eine<br />
gelegentliche Tütensuppe und ein paar<br />
Kartoffelchips oder der Besuch eines<br />
Asiarestaurants sicher nicht schaden,<br />
wenn sie sich ansonsten gesund und ausgewogen<br />
ernähren. Und das ist der springende<br />
der Punkt. Zu gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen kann es dann kommen,<br />
wenn man sich nur noch von<br />
Fertigprodukten, Knabbergebäck und Tütensuppen<br />
ernährt. Denn der Geschmack<br />
von Glutamat verleitet dazu, zu viel zu<br />
essen, außerdem gewöhnt man sich an<br />
ihn. Gerade Kinder und Jugendliche soll-<br />
FOTO: DPNY
Hier ausschneiden<br />
Manchmal hat man das Gefühl, die ganze Welt habe sich gegen einen verschworen.<br />
Das Leben scheint in Schleifen zu verlaufen und uns immer<br />
wieder mit denselben unliebsamen Ereignissen zu konfrontieren.<br />
Sosehr man sich auch bemüht, man<br />
gerät doch immer wieder an die<br />
falsche Frau oder den falschen Mann, man<br />
wird bei Beförderungen ständig übergangen<br />
oder man fühlt sich von allen falsch<br />
verstanden. Auch wenn es schwer fällt,<br />
das zu glauben: Man ist niemals hilflos<br />
den Umständen ausgeliefert – meist steht<br />
man sich selbst im Weg. Wie merkt man,<br />
ob das tatsächlich so ist und man selbst<br />
die Ursache für die eigenen Missgeschicke<br />
ist? Man muss sich selbst und sein Verhalten<br />
aufmerksam beobachten können. Im<br />
zweiten Teil dieser Reihe zur mentalen<br />
Gesundheit sind wir bereits auf die Bedeutung<br />
der Aufmerksamkeit eingegangen.<br />
Jetzt wollen wir dieses Thema noch ein<br />
wenig vertiefen.<br />
Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt.<br />
Wollten wir alle Informationen, die unser<br />
Umfeld bietet, vollständig aufnehmen<br />
und verarbeiten, würde es uns schwer<br />
fallen, gezielte Entscheidungen zu treffen,<br />
da unser Gehirn mit der Fülle der<br />
Informationen überfordert wäre. Das<br />
wäre dann etwa so, als wäre man auf<br />
einem orientalischen Basar, auf dem<br />
man von so vielen Händlern gleichzeitig<br />
angesprochen wird, dass man bei den<br />
vielen Angeboten gar nicht mehr weiß,<br />
welches man nun annehmen soll.<br />
Um bei unserer mehr oder weniger<br />
begrenzten Aufnahmefähigkeit einigermaßen<br />
sichergehen zu können, dass wir<br />
die Dinge erfassen, die von Bedeutung für<br />
uns sind, hat unser Verstand Aufmerksamkeitsraster<br />
für bestimmte Situationen<br />
3.<br />
TEIL<br />
AUFMERKSAMKEIT<br />
GRENZENLOS? EINGESCHRÄNKT?<br />
entwickelt. Diese<br />
Aufmerksamkeitsraster nehmen situationsbezogen<br />
nur bestimmte Informationen<br />
wahr, andere Informationen werden ausgeblendet.<br />
Stellen Sie sich vor, Sie lesen<br />
aufmerksam in einem Buch. Während Sie<br />
lesen, steht die Welt um Sie herum nicht<br />
still, eine Uhr tickt, ein Flugzeug fliegt<br />
in weiter Ferne am Fenster vorbei, die<br />
Feuerwehr fährt mit lauter Sirene vorbei.<br />
Doch diese Dinge nehmen Sie während<br />
des Lesens nicht wahr, sie werden aus<br />
Ihrer Wahrnehmung ausgeblendet.<br />
Wie entstehen Aufmerksamkeitsraster,<br />
und wie entscheidet unser Verstand,<br />
welche Informationen wichtig sind und<br />
welche nicht? Er hat aus vergangenen<br />
Ereignissen gelernt, aus der gebotenen<br />
Informationsfülle bestimmte Kombinationen<br />
von Informationen herauszufiltern –<br />
sie wiederzuerkennen. Dann kann er sie<br />
zuordnen und Reaktionen auslösen, die<br />
<strong><strong>MENTAL</strong>–</strong> <strong><strong>MENTAL</strong>–</strong> <strong><strong>MENTAL</strong>–</strong> <strong><strong>MENTAL</strong>–</strong><br />
SERIE<br />
sich in der Vergangenheit<br />
in dieser Situation als erfolgreich<br />
erwiesen haben. Wir wissen dann sofort,<br />
was zu tun ist, wenn bestimmte Umstände<br />
eintreten. Entscheidungen, die wir<br />
intuitiv treffen, unterscheiden sich hiervon,<br />
weil unsere Intuition keine klaren<br />
Anweisungen erteilt. Sie gibt lediglich<br />
eine Empfehlung oder Einschätzung ab.<br />
Man hat dann „ein Gefühl“ dafür, was in<br />
der betreffenden Situation richtig ist, und<br />
unser Verstand kann demgemäß handeln<br />
oder eine andere Entscheidung treffen.<br />
Aufmerksamkeitsraster sind lernfähig,<br />
denn im Laufe unseres Lebens ändert sich<br />
die Bedeutung bestimmter Informationen<br />
und unsere Reaktionen passen sich daran<br />
an. Die Schritte unseres strengen Grundschullehrers<br />
zu hören, hat uns im Kindesalter<br />
möglicherweise geängstigt, während<br />
sie uns im Erwachsenenalter mit einem<br />
Lächeln an vergangene Zeiten denken<br />
lassen. So wie mit dem strengen Grundschullehrer<br />
verhält es sich mit fast allen<br />
Dingen. Wir bewerten im Laufe unseres<br />
Lebens viele Situationen neu, weil wir mit<br />
zunehmendem Alter andere Prioritäten<br />
ZUM AUSSCHNEIDEN UND SAMMELN<br />
ILLUSTRATION: NILS WASSERMANN<br />
FOTO: DPNY
„ Es gibt Menschen, die ihre ungeteilte<br />
Aufmerksamkeit ihrem Leid und ihren<br />
Widrigkeiten widmen und glauben,<br />
“<br />
nur<br />
dadurch wirklich zu leben ...<br />
(Rose von der Au)<br />
setzen. Es kann aber aus<br />
den unterschiedlichsten Gründen<br />
dazu kommen, dass ein Aufmerksamkeitsraster<br />
seine Anpassungsfähigkeit<br />
verliert. Wie und warum das passiert, darauf<br />
wollen wir hier nicht näher eingehen,<br />
das würde den Rahmen dieses Beitrages<br />
sprengen. Ist ein Aufmerksamkeitsraster<br />
unflexibel geworden, wird es zu einer<br />
Überzeugung, über die unser Verstand<br />
keine Kontrolle mehr hat. Vorurteile oder<br />
Voreingenommenheit gegenüber Personen<br />
oder Dingen sind ebenfalls Überzeugungen.<br />
Eine Überzeugung nutzt die<br />
Aufmerksamkeit als „Sucher“, der nach<br />
Informationen Ausschau hält, die der<br />
Überzeugung entsprechen und das zugehörige<br />
Reaktionsmuster auslösen. Wäre<br />
das Aufmerksamkeitsraster für die Schritte<br />
unseres Grundschullehrers starr geblieben,<br />
würden wir auch im hohen Alter<br />
noch erschrecken. Wir wären dann der<br />
Überzeugung, dass wir immer noch Angst<br />
haben müssten, wenn er sich nähert. Die<br />
Reaktionen aufgrund unserer unflexiblen<br />
Überzeugungen sind uns meist nicht bewusst,<br />
daher reagieren wir in bestimmten<br />
Situationen oft unangebracht, ohne es<br />
zu merken. Überzeugungen können unser<br />
Leben in eine Sackgasse führen, ohne<br />
dass uns das bewusst ist.<br />
Was können wir tun, um solch starre<br />
Aufmerksamkeitsraster und die dahinterliegenden<br />
Überzeugungen zu entlarven?<br />
Wir müssen unsere Aufmerksamkeit<br />
schulen und verbessern. Denn nur wer<br />
sich selbst aufmerksam und wertfrei<br />
beobachten kann, ist in der Lage, Überzeugungen<br />
zu entdecken. Sie finden auf<br />
dieser Seite zwei einfache Übungen, die<br />
Ihnen helfen können, an Ihrer Aufmerksamkeit<br />
zu arbeiten. Bei regelmäßiger<br />
Anwendung werden Ihnen die Übungen<br />
auch helfen, unflexible Aufmerksamkeitsraster<br />
und Überzeugungen zu entdecken<br />
und insgesamt bewusster zu werden.<br />
ZUM AUSSCHNEIDEN UND SAMMELN<br />
<strong><strong>MENTAL</strong>–</strong> <strong><strong>MENTAL</strong>–</strong> <strong><strong>MENTAL</strong>–</strong> <strong><strong>MENTAL</strong>–</strong><br />
SERIE<br />
ZWEI LINKE HÄNDE<br />
„ Am Tage des Jüngsten Gerichtes wird<br />
man uns nicht fragen, was wir gelesen,<br />
“<br />
sondern was wir getan haben.<br />
(Thomas von Kempen)<br />
Führen Sie Dinge, die Sie tagtäglich wie<br />
selbstverständlich ausführen, mit der anderen<br />
Hand aus. Wenn Sie Ihre Zähne<br />
immer mit der Rechten putzen – nehmen<br />
Sie die Linke. Nehmen Sie Ihr Glas mit<br />
der anderen Hand und tauschen Sie<br />
beim Essen Gabel und Messer. Sie<br />
müssen diese alltäglichen Dinge, die Sie<br />
immer wie selbstverständlich ausgeführt<br />
haben, nun mit mehr Aufmerksamkeit<br />
erledigen. Halten Sie diese neue Angewohnheit<br />
mindestens eine Woche bei und versuchen Sie, auch in anderen Bereichen Ihres<br />
Lebens die „linke Hand“ zu benutzen. Versuchen Sie so zu reagieren, als wären Sie zum<br />
ersten Mal mit einer Situation konfrontiert. Wie reagieren Sie, wenn Sie verärgert sind?<br />
Wie verhalten Sie sich, wenn Sie viel zu tun haben?<br />
GESCHMACKSTEST<br />
Essen Sie drei Äpfel gleicher Sorte auf<br />
unterschiedliche Art und Weise. Essen Sie<br />
einen Apfel aus der Hand, während Sie<br />
fernsehen. Schneiden Sie den zweiten<br />
Apfel klein, legen Sie ihn auf einen Teller<br />
und essen Sie ihn dann. Nehmen Sie den<br />
dritten Apfel mit in einen Park und verzehren<br />
Sie ihn auf einer Parkbank. Achten<br />
Sie jedes Mal auf das Geschmackserlebnis.<br />
Sie werden überrascht sein, wie<br />
unterschiedlich Sie den Geschmack des<br />
Apfels ein und derselben Sorte erleben, wenn Sie ihn ganz bewusst wahrnehmen. Was<br />
können wir daraus lernen? Diese Übung kann Ihnen einen Eindruck davon vermitteln, wie<br />
fassettenreich Dinge sind, von denen wir das nicht erwartet hätten. Versuchen Sie auch<br />
diese Übung auf andere Bereiche Ihres Lebens auszudehnen. Sie haben Ansichten oder<br />
Meinungen zu bestimmten Dingen, sei es in der Politik, in Beziehungen oder in Glaubensfragen.<br />
Versuchen Sie den „Geschmack“ dieser Meinung anders zu erleben.<br />
B U C H - T I P P S<br />
Eckhart Tolle:<br />
Jetzt! Die Kraft der<br />
Gegenwart,<br />
J. Kamphausen Verlag,<br />
240 Seiten<br />
€ 19,50<br />
Harry Palmer: Avatar.<br />
Die Kunst befreit<br />
zu leben,<br />
J. Kamphausen Verlag<br />
170 Seiten<br />
€ 17,80<br />
ILLUSTRATIONEN : NILS WASSERMANN
MEDICOM informiert MEDICOM informiert MEDICOM informiert<br />
MEDICOM informiert<br />
informiert<br />
informiert<br />
INFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER MEDICOM PHARMA AG 35. AUSGABE, MAI 2005<br />
Braunhirse:<br />
nichts für Magen- und<br />
Darmempfindliche<br />
Sie wird als „Heilgeschenk der Natur“ gepriesen: die Braunhirse.<br />
Neuerdings in Reformhäusern, Naturkostläden und im Internet<br />
angepriesen, soll die angebliche „Urform“ unserer Speisehirse bei<br />
den verschiedensten Beschwerden heilsam sein.<br />
D<br />
ie Bundesforschungsanstalt<br />
für Ernährung und<br />
Lebensmittel (BFEL) in Detmold<br />
warnt jedoch vor einem<br />
allzu sorglosen und übermäßigen<br />
Verzehr der Braunhirse.<br />
Denn es ist nicht auszuschließen,<br />
dass die Braunhirse<br />
auch gesundheitsbedenkliche<br />
Stoffe enthält.<br />
Hirse ist wegen ihrer harten,<br />
kieselsäurehaltigen Schale<br />
eigentlich nur geschält<br />
genießbar und bekömmlich.<br />
Die gelbe Speisehirse wird<br />
deshalb von ihren Spelzen<br />
befreit und geschält, bevor<br />
sie in den Handel kommt.<br />
Durch das Kochen der Hirse<br />
wird dann auch ihre gute<br />
Verdaulichkeit gewährleistet.<br />
Im Gegensatz dazu soll die<br />
Braunhirse aber ungeschält<br />
verwendet werden. Die Körner<br />
werden vom Hersteller lediglich<br />
durch ein spezielles<br />
Enthält viele Gerbstoffe: Braunhirse. Zudem kann sie die Magen- und<br />
Darmschleimhaut reizen. Vor dem übermäßigen Verzehr wird daher gewarnt.<br />
Mahlverfahren zu Mehl verarbeitet. Dieses gelangen, betont die BFEL. So ist bekannt,<br />
Braunhirsemehl soll nach Empfehlung der dass die Schale braun gefärbter Hirse-<br />
Anbieter sogar – eingerührt in Speisen sorten besonders viel Tannine (Gerbstoffe)<br />
und Getränke – roh verzehrt werden. Da enthält. Die tanninhaltigen phenolischen<br />
die Braunhirse samt ihrer Schale vermah- Pigmente der braunen Schale haben die<br />
len wird, können aber auch bedenkliche Eigenschaft, Proteine an sich zu binden,<br />
Inhaltsstoffe der Schale mit in das Mehl und werden daher als gesundheits-<br />
beeinträchtigend angesehen. Zwar ist die<br />
botanische Herkunft der Braunhirse noch<br />
nicht endgültig geklärt. Es ist aber davon<br />
auszugehen, dass die schädlichen Tannine<br />
auch in der Schale und somit im Mehl<br />
der Braunhirse enthalten sind.<br />
Außerdem vermutet man, dass die extrem<br />
harten Bestandteile der Hirseschale die<br />
Magen- und Darmschleimhaut reizen<br />
können. Magen- und darmempfindliche<br />
Personen sowie Zöliakiekranke sollten<br />
die Braunhirse daher auf keinen Fall verzehren.<br />
In den Randschichten von Hirse ist<br />
außerdem Phytinsäure enthalten, eine<br />
Substanz, die Mineralstoffe wie Eisen,<br />
Zink und Calcium aus der Nahrung fest an<br />
sich bindet, sodass sie vom Körper nicht<br />
mehr genutzt werden können.<br />
Auch Oxalsäure, die Calcium<br />
bindet, kommt in der Schale<br />
vor. Das aus der ungeschälten<br />
Braunhirse hergestellte Mehl<br />
enthält nun wesentlich höhere<br />
Mengen an Phytinsäure und<br />
Oxalsäure als die handelsübliche<br />
Speisehirse – nicht nur<br />
wegen der Schale, sondern<br />
weil bei der Speisehirse durch<br />
die Zubereitung (Einweichen,<br />
Keimen, Kochen) die negativen<br />
Effekte des Oxalats und<br />
der Phytinsäure noch zusätzlich<br />
minimiert werden. Deshalb<br />
hält die BFEL den Rohverzehr<br />
des Braunhirsemehls<br />
für besonders problematisch.<br />
Kritisiert wird außerdem das<br />
spezielle Zentrofan-Mahlverfahren,<br />
mit dem die ungeschälte<br />
Braunhirse zermahlen<br />
FOTO: CAMBRIDGE 2000<br />
wird. Nach Ansicht der BFEL<br />
ist die Zentrofan-Vermahlung<br />
für die fettreichen Hirsekörner<br />
grundsätzlich ungeeignet,<br />
denn der starke Luftkontakt<br />
während des Mahlvorgangs fördert die<br />
Oxidation und damit den Verderb der<br />
in der Hirse enthaltenen ungesättigten<br />
Fettsäuren. Das gemahlene Mehl ist<br />
deshalb im Grunde nur zum Sofortverzehr<br />
geeignet. Wird es nicht umgehend verbraucht,<br />
schmeckt es schnell ranzig.<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
17
FOTO: PHOTOGRAPHER`S CHOICE<br />
Yoga– Yoga der Weg zur Harmonie<br />
18<br />
FOTO: PHOTOS.COM<br />
„Namasté“ ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet:<br />
„Ich verneige mich vor dem Göttlichen in dir“. Bei der Geste<br />
werden die Hände vor dem Herzen gegeneinander gehalten.
Die Geste signalisiert Respekt und<br />
Verständnis und wird in Yogaklassen<br />
zum Abschluss der Übungen<br />
verwendet.<br />
Schon dadurch wird deutlich, dass Yoga<br />
weit mehr als eine exotisch anmutende<br />
Gymnastikstunde ist. Yoga ist eine Lebensphilosophie<br />
für Geist und Körper,<br />
die zu mehr Zufriedenheit, Gelassenheit<br />
und Lebensfreude verhilft, die keine<br />
Vorkenntnisse erfordert und von jedem<br />
erlernt werden kann. Der Begriff Yoga<br />
hat seinen Ursprung im „yui“, was so viel<br />
bedeutet wie „verschmelzen“, „verbinden“,<br />
„vereinen“. Yoga ist in Indien seit etwa<br />
4.000 bis 5.000 Jahren in Schriften<br />
bekannt, obgleich man davon ausgeht,<br />
dass die Lehre noch viel älter ist. Seitdem<br />
haben sich viele Richtungen entwickelt,<br />
die aber alle das gleiche Ziel verfolgen:<br />
die Befreiung vom Leiden durch das bewusste<br />
Zusammenspiel zwischen Körper,<br />
Geist und Seele.<br />
Yoga ist keine Religion. Menschen aller<br />
Glaubensrichtungen und jeden Alters<br />
können es praktizieren. Wie in allen<br />
anderen Lebensbereichen kommt der<br />
Erfolg beim Yoga aus der Motivation,<br />
regelmäßig zu üben und aus der Erfahrung<br />
zu lernen.<br />
FOTOS: PHOTODISC<br />
„ Yoga geschieht,<br />
wenn die Gedankenbewegungen<br />
in der unteilbaren<br />
Intelligenz zur Ruhe kommen,<br />
ohne den Gedanken Ausdruck<br />
zu verleihen oder sie<br />
zu unterdrücken.<br />
(Patanjali,<br />
indischer Gelehrter)“<br />
Das Hatha-Yoga<br />
Von allen eingeschlagenen Richtungen<br />
hat das Hatha-Yoga die größte Verbreitung.<br />
Die Idee, die dem Hatha-Yoga<br />
zugrunde liegt, besagt stark vereinfacht,<br />
dass man ohne einen flexiblen und starken<br />
Körper keinen regen und klaren<br />
Geist haben kann.<br />
Die Grundlagen des Hatha-Yoga sind die<br />
Atmung, die Körperübungen, Entspannung,<br />
Meditation und eine gesunde<br />
Ernährung.<br />
Hatha spiegelt die Gegensätze wider:<br />
„Ha“ steht für Sonne, „tha“ für Mond.<br />
In die Praxis umgesetzt bedeutet das<br />
die Vereinigung von gegensätzlichen<br />
Energien. Die einströmenden und die<br />
ausströmenden Energien sollen im<br />
Gleichgewicht gehalten werden. Aus<br />
diesem Grund spielt die Atmung eine<br />
ganz besondere Rolle. Aus dem Zusammenwirken<br />
von Körperbewegung, Atmung<br />
und Konzentration wird der ganze<br />
Mensch positiv beeinflusst. Die Muskeln<br />
werden gestärkt, der Bewegungsapparat<br />
und die inneren Organe in Harmonie<br />
gebracht, der Kreislauf wird angeregt,<br />
das Nervensystem beruhigt, die Atmung<br />
verbessert und die Konzentrationsfähigkeit<br />
wird gestärkt.<br />
Im Mittelpunkt des Hatha-Yoga stehen die Körperübungen,<br />
die Asanas. Sie entstehen durch die Verbindung von<br />
Körperbewegung, Atmung und Konzentration.<br />
Die richtige Atmung<br />
Babys praktizieren es noch ganz natürlich:<br />
das gleichmäßige tiefe Atmen;<br />
viele Erwachsene haben diese Fähigkeit<br />
verloren. Verantwortlich dafür sind oft<br />
negativer Stress, seelische Anspannungen<br />
und körperliche Verspannungen.<br />
Jeder reagiert anders auf Belastung. Die<br />
einen bekommen Kopfschmerzen, andere<br />
Durchfall. Bei vielen wirkt sich der Stress<br />
allerdings auf die Atmung aus. Unbemerkt<br />
setzt eine Kurzatmigkeit ein, die<br />
zu einer flachen Atmung führt. Es stellt<br />
sich das Gefühl ein, keine Luft mehr<br />
zu bekommen. Folge einer schlechten<br />
Atmung ist der Sauerstoffmangel im<br />
Organismus. Die Leistungsfähigkeit der<br />
Organe reduziert sich. Müdigkeit und<br />
Konzentrationsschwäche sind oft die<br />
Folge. Doch das muss nicht sein, denn<br />
dagegen kann man etwas tun: Durch<br />
eine gezielte Atmung können die Energiereserven<br />
wieder aufgefüllt und die<br />
Sauerstoffversorgung verbessert werden.<br />
Wir zeigen Ihnen hier Übungen, die Sie<br />
leicht zu Hause ausführen können. Wenn<br />
Sie sich weitergehend mit Yoga beschäftigen<br />
möchten, empfehlen wir Ihnen,<br />
Yogaklassen zu besuchen, die vielerorts<br />
angeboten werden.<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
19
FOTO: PHOTOGRAPHER`S CHOICE<br />
Mit Yoga kann man auch ganz gezielt Beschwerden<br />
lindern. Ein erfahrener Yogalehrer<br />
wird Ihnen zeigen, welche Übungen<br />
für Sie speziell geeignet sind.<br />
Die vier großen Yogawege<br />
Karma-Yoga: Yoga des selbstlosen<br />
Tuns<br />
Jnana-Yoga: Yoga der spirituellen<br />
Erkenntnis<br />
Bhakti-Yoga: Yoga der selbstlosen<br />
Liebe<br />
Raja-Yoga: Yoga der Beherrschung<br />
20 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
FOTO: PHOTODISC<br />
„ Der Geist muss leer sein,<br />
“<br />
um klar zu sehen.<br />
(Krishnamurti,<br />
indischer Philosoph)<br />
Goldene Regeln<br />
Sie üben am besten auf nüchternen Magen<br />
nach dem Aufstehen. Wenn Sie sich<br />
für eine andere Tageszeit entscheiden,<br />
sollten Sie zwei Stunden vorher nichts<br />
mehr essen, weil ein voller Magen beim<br />
Üben behindert. Nehmen Sie sich Zeit,<br />
und stellen Sie alles ab, was Sie stören<br />
könnte: z. B. Radio und Fernseher.<br />
Üben Sie regelmäßig<br />
Beginnen Sie immer mit einer Atemübung<br />
Vergessen Sie jedes Leistungsdenken,<br />
und üben Sie so, wie Ihre Kräfte es<br />
erlauben. Sie werden mit zunehmender<br />
Übungserfahrung körperlich und geistig<br />
beweglicher werden<br />
Versuchen Sie jede Übung 20 Sekunden<br />
lang zu halten. Machen Sie mindestens<br />
zwei, höchstens vier Übungsreihen<br />
pro Tag<br />
Halten Sie durch, Übung macht den<br />
Meister<br />
Eine Atemübung<br />
Setzen Sie sich in einer bequemen Sitzhaltung<br />
auf einen Stuhl oder auf ein<br />
Sitzkissen. Der Oberkörper ist aufrecht,<br />
der Nacken gedehnt und der Kopf aufgerichtet.<br />
Beugen Sie nun den Zeige- und<br />
den Mittelfinger der rechten Hand zur<br />
Handfläche. Schließen Sie mit dem rechten<br />
Daumen das rechte Nasenloch und<br />
atmen Sie durch das linke Nasenloch ein.<br />
Jetzt schließen Sie das linke Nasenloch<br />
mit dem Ringfinger und nehmen<br />
den Daumen vom rechten Nasenloch.<br />
Während des Wechselns halten Sie den<br />
Atem an.<br />
Anschließend atmen Sie durch das rechte<br />
Nasenloch aus und ein. Zu Beginn<br />
führen Sie die Wechselatmung sechsmal<br />
durch, und dann steigern Sie die Anzahl<br />
der Übungen langsam.<br />
Diese Übung verbessert die Zellatmung,<br />
sie hilft bei kalten Füßen und Händen<br />
und wirkt entspannend. Bei verstopfter<br />
Nase sollte diese Übung nicht angewandt<br />
werden.
Körperübungen<br />
Asanas – Körperübungen – sind der<br />
Mittelpunkt des Yoga. Sie sind eine<br />
Mischung aus Dehn- und Streckübungen,<br />
Atem- und Konzentrationsübungen.<br />
Jedes Asana hat eine ganz bestimmte<br />
Wirkung und beeinflusst Körper, Geist<br />
und Seele des Menschen.<br />
Halber Drehsitz<br />
Sie benötigen eine weiche Unterlage (am<br />
besten eine Yogamatte oder eine Isomatte,<br />
wie man sie beim Zelten benutzt),<br />
bequeme Kleidung und, falls Sie zu<br />
kalten Füßen neigen, ein paar warme<br />
Socken. Setzen Sie sich mit gestreckten<br />
Beinen hin. Stellen Sie den rechten Fuß<br />
parallel an die Außenseite des linken<br />
Kniegelenkes. Drehen Sie Ihren Oberkörper,<br />
die Arme und das Gesicht nach<br />
rechts und stützen Sie sich mit der<br />
rechten Hand hinter dem Gesäß auf den<br />
Boden auf. Mit der linken Hand umfassen<br />
Sie das rechte Fußgelenk von außen.<br />
Jetzt drücken Sie mit dem linken Arm,<br />
möglichst dem Oberarm, das rechte Knie<br />
sanft nach außen. Den Blick richten Sie<br />
über die rechte Schulter nach hinten.<br />
Versuchen Sie, ruhig zu atmen und mit<br />
beiden Gesäßknochen den Bodenkontakt<br />
zu halten. Führen Sie diese Übung im<br />
Wechsel auf jeder Seite zwei- bis dreimal<br />
durch.<br />
FOTOS: PHOTODISC<br />
Die Übung dehnt die Rückenmuskulatur<br />
und löst Verspannungen im Nacken- und<br />
Schulterbereich. Bei regelmäßiger Anwendung<br />
verbessert die Übung die Beweglichkeit<br />
der Hüftgelenke.<br />
Wenn Sie Probleme mit der Hüfte<br />
und/oder dem Rücken haben, sollten Sie<br />
diese Übung nur besonders langsam und<br />
vorsichtig, ja behutsam durchführen.<br />
Konzentration<br />
Eine richtig durchgeführte Körperübung<br />
besteht aus der Verbindung der drei Elemente<br />
Atmung, Körperübung und Konzentration.<br />
Die Konzentration während<br />
jeder Übung bündelt die geistigen Kräfte<br />
und stärkt das positive Denken. Seien Sie<br />
nicht verzweifelt, wenn Ihre Gedanken<br />
zum Beginn der Übungen noch abschweifen,<br />
das ist für jeden Anfänger<br />
ganz normal. Es legt sich mit der Zeit!<br />
Durch regelmäßiges Üben intensivieren<br />
Sie Ihr Körpergefühl, das heißt, Sie<br />
gewinnen an Sensibilität für Bewegungsabläufe.<br />
Durch regelmäßige Übung erlangen<br />
Sie immer mehr Selbstsicherheit<br />
und Selbstbewusstsein; das wird auch<br />
Ihr Handeln im Alltag harmonisieren.<br />
Das letztendliche Ziel von Yoga ist es,<br />
mehr Selbstkontrolle und mehr Unabhängigkeit<br />
von äußeren Einflüssen zu<br />
erzielen.<br />
Behutsam, nach und nach und mit viel üben macht<br />
Yoga den Körper wieder so gelenkig, wie er gewesen<br />
ist, als wir ein Kind waren. Dabei gilt: der eine kann<br />
dies besser, und ein anderer etwas anderes. Das,<br />
was Ihnen am wenigsten gelingt, sollte Sie zu noch<br />
mehr üben anspornen.<br />
B U C H - T I P P S<br />
Harry Waesse:<br />
Yoga für Anfänger,<br />
Gräfe und Unzer<br />
Verlag,<br />
€ 12,90<br />
Ursula Karven:<br />
Yoga für die Seele,<br />
Rowohlt Taschenbuch<br />
Verlag,<br />
€ 9,90<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
21
Gibt es tatsächlich ein Bauchgefühl?<br />
Geahnt haben wir es immer schon: Der Bauch denkt mit.<br />
Wann immer sich dieses „Bauchgefühl“ bemerkbar macht,<br />
haben wir das Gefühl, etwas Bestimmtes tun oder etwas<br />
unterlassen zu müssen. Manchmal meldet sich unser Bauchgefühl<br />
auch mit „durchschlagenden“ Argumenten, und das<br />
meistens dann, wenn es am wenigsten passt. Der Durchfall<br />
vor einer wichtigen Prüfung oder die Bauchschmerzen beim<br />
Gedanken an einen dringenden Termin scheinen uns nicht<br />
gerade hilfreich zu sein. Leider schenken wir unserem Darm nur<br />
dann Aufmerksamkeit, wenn er Ärger macht. Zu Unrecht, denn<br />
der Darm ist ein Schwerstarbeiter, er ist ehrlich und er lässt sich<br />
nicht alles vorschreiben – nicht einmal vom Gehirn. Und wenn er<br />
sich bemerkbar macht, sollten wir ihm zuhören, denn der Darm hat<br />
mehr Einfluss, als wir glauben. Wie genau uns dieses Gefühl im<br />
Bauch zu etwas rät oder von etwas abrät, ist<br />
noch nicht erwiesen. Dass es jedoch<br />
ein zweites Gehirn im Bauch gibt,<br />
ist mittlerweile unumstritten.
Vom Magenpförtner, der Ausgangsklappe des<br />
Magens, bis zum Enddarm übernimmt eine<br />
andere Instanz als das Gehirn die Regie im Bauch:<br />
das Bauchhirn oder Darmhirn, medizinisch „enterisches<br />
Nervensystem“ (ENS) genannt. Lange<br />
glaubten die Wissenschaftler, das vegetative<br />
(unbewusste) Nervensystem, das die Funktion<br />
der inneren Organe ohne unsere Mitwirkung<br />
selbstständig steuert, würde nur aus zwei Teilen<br />
bestehen – dem sympathischen und dem parasympathischen<br />
Nervensystem. Jetzt weiß man:<br />
Es gibt auch noch einen dritten Bereich im<br />
vegetativen Nervensystem, der sogar unabhängig<br />
vom Gehirn agieren kann.<br />
Neurogastroenterologie<br />
Die Nervenforschung<br />
im Bauch<br />
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte<br />
der deutsche Nervenarzt Leopold Auerbach ein<br />
ungewöhnliches Netzwerk von Nervenzellen<br />
in der Darmwand. Doch erst Jahrzehnte später<br />
postulierten die englischen Mediziner William<br />
Bayliss und Ernest Starling das „Gesetz des<br />
Darmes“. Sie hatten entdeckt, dass die peristaltischen<br />
Reflexe des Darmes – also die wellenartigen<br />
Bewegungen der Darmmuskulatur, die<br />
den Darminhalt vorwärts schieben – allein auf<br />
Druck hin erfolgen und auch dann noch funktionieren,<br />
wenn keine Nervenverbindung mehr<br />
zwischen dem Darm und dem Gehirn besteht.<br />
Bayliss und Starling hegten schon die Vermutung,<br />
dass das von Leopold Auermann entdeckte<br />
Nervennetz den peristaltischen Reflex<br />
steuert. Aus dieser Vermutung ist inzwischen<br />
Gewissheit geworden und Fachleute wie<br />
der US-amerikanische Neurobiologe Michael<br />
Gershon bezeichnen das enterische Nervensystem<br />
heute sogar als „zweites Gehirn“. Mit<br />
den erstaunlichen Fähigkeiten des Bauchhirns<br />
beschäftigt sich nun ein ganzer Forschungszweig,<br />
die Neurogastroenterologie. Studien<br />
haben inzwischen erwiesen, dass das Darmhirn<br />
das Verdauungssystem kontrolliert, die<br />
Immunabwehr koordiniert, seinen Nachbarorganen<br />
Anweisungen gibt und sogar über ein<br />
Gedächtnis verfügt.
FOTO: NAS7BIOPHOTO ASSOCIATES/OKAPIA<br />
Der menschliche Darm ist von einem<br />
Netz von Nerven umhüllt. Mit über<br />
100 Millionen Nervenzellen verfügt es<br />
über mehr Neuronen als das gesamte<br />
Rückenmark. Das enterische Nervensystem<br />
(ENS) arbeitet mit exakt den<br />
gleichen Zelltypen, Wirkstoffen und Nervenrezeptoren<br />
wie das Gehirn, weshalb<br />
es auch „Bauchhirn“, „Darmhirn“ oder<br />
„zweites Gehirn“ genannt wird. Das ENS<br />
ist in der Lage, unabhängig vom Gehirn<br />
zu arbeiten, und sorgt zum Beispiel<br />
dafür, dass Sekrete in Magen und Darm<br />
ausgeschüttet werden, Nährstoffe ins<br />
Blut gelangen und die Darmbewegungen<br />
koordiniert ablaufen.<br />
Ständig tauscht es dabei mit dem Kopfhirn<br />
Informationen aus. Dabei gehen nur<br />
wenige Befehle vom Kopf zum Darm, das<br />
Kopfhirn wird jedoch mit einer Vielfalt<br />
von Informationen aus dem Bauchraum<br />
versorgt – nur dringen diese Informationen<br />
in der Regel nicht in unser<br />
24 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Bewusstsein vor. Lediglich Alarmzeichen<br />
wie Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen<br />
werden an unser Bewusstsein weitergeleitet.<br />
Diese Einschränkung ist durchaus<br />
sinnvoll, denn würden wir jede Regung<br />
des Darmes registrieren, dann wären wir<br />
nicht mehr in der Lage, zu denken oder<br />
ein sinnvolles Gespräch zu führen. Die<br />
Ausblendung der Darmaktivitäten ist<br />
deshalb ein wichtiger Reizschutz für unser<br />
Bewusstsein. Bei Menschen, die unter<br />
dem so genannten „Reizdarmsyndrom“<br />
leiden, scheint dieser Schutzmechanismus<br />
aber nicht mehr richtig zu funktionieren.<br />
(Mehr dazu auf Seite 30.)<br />
Das Gedächtnis im Bauch<br />
Wie das Gehirn, so entwickelt sich auch<br />
das Bauchhirn nach der Geburt weiter.<br />
Daher verfügt es auch über eine Art von<br />
Gedächtnis. Beispielsweise neigen Erwachsene,<br />
die als Babys unter Darmkoliken<br />
litten, häufig dazu, das Reizdarm-<br />
Die Darmschleimhaut (Mukosa), mit einem Rasterelektronenmikroskop<br />
vergrößert. Sie ist die innere Auskleidung des Darmes und enthält<br />
Drüsen zur Bildung von Darmsaft, Zellen zur Aufnahme von<br />
Nährstoffen aus dem Darm ins Blut und Zellen zur Abwehr von<br />
Krankheitserregern.<br />
Information<br />
zum Bauch<br />
Information<br />
zum Gehirn<br />
Neben dem Kopfhirn fanden Forscher auch ein Bauchhirn. Dieses befindet<br />
sich im Darm und hat ähnliche Eigenschaften wie das Gehirn. Beide Systeme<br />
kommunizieren miteinander, wobei wesentlich mehr Informationen vom<br />
Darm zum Hirn geleitet werden als umgekehrt.<br />
syndrom zu entwickeln. Die erlernte<br />
Fehlfunktion ist in Erinnerung geblieben.<br />
Doch das Bauchhirn merkt sich<br />
noch mehr: Da es sich schon im Mutterleib<br />
entwickelt, übernimmt es nach der<br />
Geburt sofort seine Aufgaben. Von da an<br />
merkt es sich alles: die Nahrungsstoffe,<br />
die es bekommen hat, und auch die zärtliche<br />
Zuwendung. Das Bauchhirn merkt<br />
sich auch Stimmungen und Gefühle.<br />
Denn in ständigem Kontakt mit dem<br />
Großhirn nimmt es an dessen Wahrnehmung<br />
teil.<br />
Die meisten Forscher sind sich darüber<br />
einig, dass die emotionalen Erinnerungen<br />
des Bauchhirns unsere Entscheidungen<br />
beeinflussen. Wie sie das jedoch<br />
genau tun, ist noch weitgehend unbekannt.<br />
Das bekannte Bauchgefühl entsteht<br />
vermutlich aus dem Wechselspiel<br />
der beiden Gehirne. Offenbar existiert<br />
im Kopfgehirn ein Bereich, der sich die<br />
vom Bauchhirn ausgesendeten Informa-<br />
GRAFIK: DPNY
Angst und andere starke Gefühle können die Verdauungsfunktionen<br />
beeinträchtigen. Man sagt nicht von ungefähr, dass sich<br />
einer „vor Angst in die Hosen macht“.<br />
tionen merkt. Zum Beispiel die Gefühle<br />
in beängstigenden Situationen. Jedes<br />
Mal, wenn eine Entscheidung gefordert<br />
ist, wird auch die „Bauchdatenbank“<br />
mit abgefragt. Kommt dem Bauchhirn<br />
schließlich eine Situation bekannt oder<br />
bedrohlich vor, rutscht einem buchstäblich<br />
„das Herz in die Hose“ und der<br />
Darm meldet „Alarmstufe eins“ – mit<br />
den bekannten Folgen. Das hat seinen<br />
biologischen Sinn, denn je besser wir<br />
uns an starke Gefühle wie die Angst<br />
erinnern, desto besser und schneller<br />
können wir das nächste Mal über das<br />
weitere Vorgehen entscheiden. Der<br />
Darm erzählt uns letztlich pausenlos<br />
Geschichten, doch wir hören sie nur,<br />
wenn die Stimme des Bauches künstlich<br />
lauter gestellt wird – zum Beispiel bei<br />
Stress. Bei andauerndem Stress wird der<br />
Mensch sensibler, und es wird ihm auch<br />
„von tief unten“ gemeldet, dass die<br />
Seele in Unordnung geraten ist.<br />
FOTO: THE IMAGE BANK<br />
Das vegetative<br />
Nervensystem<br />
Nervenzellen oder Neuronen<br />
sind Zellen im Körper, die für<br />
die Reizaufnahme sowie<br />
für die Weitergabe und<br />
Verarbeitung von Informationen<br />
zuständig sind<br />
Der menschliche Körper verfügt über<br />
zwei Nervensysteme: das somatische<br />
und das vegetative Nervensystem.<br />
Das somatische Nervensystem kann<br />
größtenteils durch den Willen kontrolliert<br />
werden. Damit koordiniert<br />
man zum Beispiel seine Bewegungen,<br />
wie das Heben einer Hand oder die<br />
Krümmung eines Fingers. Das vegetative<br />
Nervensystem wird auch als autonomes<br />
Nervensystem bezeichnet,<br />
weil es nicht direkt kontrolliert<br />
werden kann. Es regelt den inneren<br />
Betrieb des Körpers, hält alle lebenswichtigen<br />
Organtätigkeiten aufrecht<br />
und passt den Körper an wechselnde<br />
Umweltbedingungen an. Es steuert<br />
beispielsweise Kreislauf, Atmung,<br />
Stoffwechsel, Verdauung, Drüsentätigkeit,<br />
Temperatur, Ausscheidungen,<br />
Schlaf, Wachstum und die Sexualorgane.<br />
Beide, das vegetative und das somatische<br />
Nervensystem, arbeiten jedoch<br />
„Hand in Hand“. Außerhalb des Gehirns<br />
kann man die Nerven der beiden<br />
Systeme klar trennen, im Gehirn<br />
hingegen kann man beide Nervensysteme<br />
nicht mehr deutlich voneinander<br />
abgrenzen.<br />
Das vegetative Nervensystem untergliedert<br />
sich in drei verschiedene<br />
Untersysteme. Man unterscheidet den<br />
Sympathikus, den Parasympathikus<br />
und das enterische Nervensystem.<br />
Dieses Bauchhirn kann völlig unabhängig<br />
vom zentralen Nervensystem,<br />
also von Gehirn und Rückenmark,<br />
agieren.<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
25<br />
FOTO: VISUALS UNLIMITED
Leber<br />
Die Verdauung<br />
Gallenblase<br />
Kehldeckel<br />
Querdickdarm<br />
Aufsteigender<br />
Dickdarm<br />
26 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Mund<br />
Speiseröhre<br />
Magen<br />
Zwölffingerdarm<br />
Dünndarm
Hier geht die Reise los. Die Zähne zerkauen die Frucht und<br />
die Zunge mischt den Speichel bei, damit aus dem Bissen<br />
ein Brei wird, der heruntergeschluckt werden kann.<br />
und seine Reise durch den<br />
Verdauungstrakt<br />
Etwa 30 Tonnen an Nahrungsmitteln und 50.000 Liter Flüssigkeit durchwandern<br />
das Verdauungssystem in einem Menschenleben – keine Kleinigkeit. So<br />
wie wir die Nahrung zu uns nehmen, ist sie für unseren Körper nicht verwertbar.<br />
Sie muss erst vom Verdauungssystem aufbereitet werden, damit wir<br />
die enthaltenen Nährstoffe verwerten können. Bis zum Ausgang des Magens,<br />
dem Magenpförtner, erteilt das Gehirn hierzu die Befehle, bei Eintritt des<br />
Speisebreis in den Darm übernimmt das Bauchhirn die Regie.<br />
Essen wir zum Beispiel einen Apfel, so<br />
tritt er eine lange Reise durch unseren<br />
Körper an. Seine erste Station: der Mund.<br />
Hier wird er zerkleinert und der Speisebrei<br />
wird mit Speichel vermengt. Die Menge<br />
des hinzukommenden Speichels ist unter<br />
anderem auch abhängig vom Anblick der<br />
Speisen, von deren Geruch und vom<br />
Appetit, den man darauf hat. Der Verdauungsapparat<br />
arbeitet in zwei Phasen.<br />
1. Station<br />
Der Mund und die Speiseröhre<br />
FOTO: PHOTODISC<br />
Im Mund wird in der mechanischen Phase<br />
die Nahrung beim Kauen zerkleinert,<br />
mit Speichel versetzt und zu einem Brei<br />
verarbeitet, den wir schlucken können.<br />
Die chemische Phase beinhaltet die<br />
Spaltung der Nahrung in Stoffe, die<br />
vom Organismus aufgenommen werden<br />
können. Das geschieht durch mehrere<br />
Verdauungssäfte, die von verschiedenen<br />
Drüsen abgesondert werden.<br />
Einen Apfel essen. Sie finden das nicht<br />
weiter spektakulär? Dann begleiten<br />
Sie ihn einmal auf dem Weg durch<br />
das Verdauungssystem!<br />
Muskelschicht<br />
in<br />
der Speiseröhrenwand<br />
Bissen<br />
Die Speiseröhre<br />
Kontrahierte<br />
Muskeln<br />
Entspannte<br />
Muskeln<br />
Die Muskeln der Speiseröhre schieben<br />
den zerkauten Apfel mit wellenförmigen<br />
Bewegungen in Richtung Magen weiter<br />
Ist der Apfel ausreichend zerkleinert,<br />
schlucken wir ihn hinunter und übergeben<br />
ihn sozusagen an unser Verdauungssystem.<br />
Durch die Speiseröhre reisen die<br />
Apfelstücke jetzt in Richtung Magen. Die<br />
Speiseröhre ist ein Zentimeter langer<br />
Schlauch, der den Rachen mit dem Magen<br />
verbindet. Ihre Innenwände bestehen aus<br />
Muskeln, die sich in wellenförmigen<br />
Bewegungen zusammenziehen und die<br />
Apfelstücke durch die Speiseröhre hindurch<br />
vorwärts schieben. Diese Kontraktionen<br />
sind so stark, dass sie auch gegen<br />
die Schwerkraft wirken, wir also auch im<br />
Kopfstand schlucken können. Im oberen<br />
Teil der Speiseröhre befindet sich der<br />
Kehlkopfdeckel, eine kleine Klappe, die<br />
den Kehlkopf während des Schluckaktes<br />
verschließt – dies verhindert, dass der<br />
Speisebrei in die Atemwege gerät.<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
GRAFIK: DPNY<br />
27<br />
FOTO: PHOTS.COM
FOTO: EYE OF SCIENCE/AGENTUR FOCUS<br />
Zweite Station des Apfels: der Magen.<br />
Der Magen ist ein Hohlorgan, das<br />
zwischen Speiseröhre und Dünndarm im<br />
linken Oberbauch unter dem Zwerchfell<br />
liegt. Der Magen hat eine Länge von<br />
zirka 20 Zentimetern, einen Durchmesser<br />
von zirka zwölf Zentimetern und ein<br />
Fassungsvermögen von ungefähr 1,5 bis<br />
2,5 Litern. Wobei die Form und die Lage<br />
große funktionsbedingte Unterschiede<br />
aufweisen können.<br />
Der Muskel an der oberen Öffnung – der<br />
Magenmund – verhindert den Rückfluss<br />
der Nahrungsmittel in die Speiseröhre.<br />
Und ein weiterer Muskel an der unteren<br />
Öffnung des Magens, der Pförtner, sorgt<br />
dafür, dass immer nur kleine Mengen des<br />
Nahrungsbreis in den Dünndarm gelan-<br />
28 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
2. Station<br />
Der Magen<br />
Zwölffingerdarm<br />
Der Magen befindet sich in der Mitte der Bauchhöhle und erstreckt sich vom<br />
unteren Ende des Ösophagus (Speiseröhre) bis zum Duodenum (Zwölffingerdarm).<br />
Er sieht aus wie ein Beutel, der am oberen Teil weniger, am unteren mehr<br />
gekrümmt ist. Der Speisebrei gelangt von der Speiseröhre in den Magen und wird<br />
durch peristaltische Bewegungen durchgemengt. In der Magenschleimhaut sind<br />
kleine Drüsen, die Magensäure, Schleim und Enzyme freisetzen.<br />
Eine gesunde Magenschleimhaut sieht aus der<br />
Nähe betrachtet so aus. Die Magenschleimhaut, die<br />
das Mageninnere auskleidet, produziert die Magensäure, die<br />
verdauungsfördernd und keimabtötend ist. Durch die Bewegung<br />
der Magenwand wird der Magensaft mit der Nahrung vermischt.<br />
gen. Er fungiert als eine Art Schleuse. Der<br />
Magenpförtner kann sich unterschiedlich<br />
weit öffnen und so dafür sorgen, dass<br />
große Nahrungsstücke länger im Magen<br />
bleiben. Die Mageninnenwand ist von<br />
einer Membran, der Magenschleimhaut,<br />
überzogen, die den Magen vor seiner eigenen<br />
Säure, der aggressiven Magensäure,<br />
schützt.<br />
Der Magensaft, von dem etwa zwei bis<br />
drei Liter am Tag produziert werden,<br />
besteht im Wesentlichen aus Schleim,<br />
Salzsäure und Eiweiß spaltenden Enzymen.<br />
Die Aufgabe des Magens ist es, die<br />
bereits zerkaute und eingespeichelte<br />
Nahrung aufzunehmen, sie mit dem abgesonderten<br />
Magensaft zu vermischen,<br />
in der Nahrung befindliche Eiweiße<br />
Magenpförtner<br />
Magengrübchen<br />
Magendrüsen<br />
Magenwand<br />
Speiseröhre<br />
Kleine<br />
Magenkrümmung<br />
Der Magen<br />
Magenkörper<br />
Große<br />
Magenkrümmung<br />
enzymatisch aufzuspalten und den Speisebrei<br />
dann langsam durch den Pförtner<br />
weiter in den Darm zu leiten. Bei Flüssignahrung<br />
dauert das nur 20 Minuten,<br />
bei schlecht gekautem Fleisch hingegen<br />
bis zu fünf Stunden. Während des Verdauungsvorgangs<br />
bewegt der Magen den<br />
Speisebrei hin und her und gibt ihn dann<br />
nach unterschiedlich langer Verweildauer<br />
schubweise an den Dünndarm ab.<br />
Mit dem Magen verlässt unser Apfel den<br />
Einflussbereich des Gehirns. Schon im<br />
Magen hat das Bauchhirn ein wenig<br />
Einfluss, aber ab dem Magenpförtner<br />
verliert das Gehirn endgültig seine Befehlsgewalt,<br />
die es erst ganz am Ende<br />
des Dickdarms wiedergewinnt. Versuche<br />
haben gezeigt, dass der Darm selbst dann<br />
eigenständig weiterarbeiten kann, wenn<br />
er völlig vom Gehirn getrennt ist. Der<br />
vom Magen zu Brei verarbeitete Apfel<br />
tritt jetzt seine Reise durch den Darm an.<br />
GRAFIK: DPNY
Der Darm<br />
Aufnahme der Nährstoffe Mikroville<br />
Leber<br />
Dickdarm<br />
Zwölffingerdarm<br />
Magen<br />
Die Zotten des Dünndarmes ragen als winzige, fingerartige Ausstülpungen in<br />
den Hohlraum des Darmes hinein. An ihrer Oberfläche tragen sie eine dünne<br />
Zellschicht mit Schleim bildenden Zellen.<br />
Zunächst geht es für den Apfel durch<br />
den etwa vier Meter langen Dünndarm,<br />
der sich vom Magenpförtner bis zum<br />
Dickdarm erstreckt. Er gliedert sich in<br />
drei Abschnitte: den Zwölffingerdarm<br />
(Duodenum), den Leerdarm (Jejunum)<br />
und den Krummdarm (Ileum). In diesen<br />
Abschnitten kommt der zerkleinerte<br />
Apfel mit weiteren Verdauungssäften in<br />
Kontakt. Diese sind das Bauchspeicheldrüsensekret,<br />
das den Nahrungsbrei<br />
in seine Bestandteile zerlegt, und das<br />
Dünndarmsekret, das die Magensäure<br />
neutralisiert. Ein weiteres Hilfsmittel bei<br />
der Nahrungsverwertung ist die Gallenflüssigkeit,<br />
die die Fette aus der Nahrung<br />
verwertbar macht. Die dafür notwendigen<br />
Gallensalze werden in der Leber produziert<br />
und der Gallenflüssigkeit zugesetzt.<br />
3. Station<br />
Der Darm<br />
Dünndarmkrypte<br />
Gefäße<br />
Zotte<br />
Dünndarm<br />
Mastdarm<br />
After<br />
GRAFIK: DPNY<br />
Innen ist der Dünndarm mit einer<br />
Schicht mikroskopisch kleiner Fortsätze<br />
übersät – den so genannten Mikrovilli.<br />
Jeder dieser Fortsätze wird von einem<br />
dichten Netz aus kleinen Blutgefäßen<br />
umgeben, die sich zu den größten Adern<br />
des Dünndarmes vereinigen. Diese Millionen<br />
von Fortsätzen bilden zusammengenommen<br />
die Oberfläche eines halben<br />
Fußballfeldes. Sie nehmen die verdauten<br />
Nährstoffe in sich auf. Die vom Körper<br />
verwertbaren Nahrungsbestandteile (z. B.<br />
Aminosäuren, Zucker und Fettsäuren)<br />
werden dann durch die Dünndarmwand<br />
an das Blut und die Lymphflüssigkeit<br />
abgegeben und über ein weit verzweigtes<br />
Ader- und Lymphsystem zur Leber und<br />
dann zu anderen Körperregionen transportiert.<br />
Die oberste Schicht der Darmschleimhaut: Die eng<br />
nebeneinander liegenden Mikrovilli lassen den<br />
Nahrungsbrei mit schlagenden Bewegungen<br />
zwischen den Darmzotten zirkulieren<br />
Die letzte Station des Apfels ist der<br />
Dickdarm. Mit zirka 1,5 Metern Länge ist<br />
dieser vergleichsweise kurz, doch der<br />
Speisebrei verbringt hier die meiste<br />
Zeit – je nach Nahrungspartikel zwischen<br />
fünf und 70 Stunden.<br />
Für den Verdauungsvorgang benötigt<br />
der Mensch täglich neun Liter Flüssigkeit,<br />
mit denen die Drüsensekrete gebildet<br />
werden. Der Dickdarm entzieht dem<br />
Brei die Flüssigkeit wieder und führt sie<br />
dem Organismus wieder zu. Außerdem<br />
spalten die in der Dickdarmwand angesiedelten<br />
Mikroorganismen (Darmbakterien)<br />
viele im Speisebrei befindliche<br />
Ballaststoffe auf, also Nahrungsbestandteile,<br />
die von den menschlichen Enzymen<br />
nicht abgebaut werden können, und<br />
tragen somit zur Gesundheit des Menschen<br />
bei. (Mehr über die Darmbakterien<br />
erfahren Sie auf Seite 34.)<br />
Was jetzt noch vom Apfel im Darm übrig<br />
und nicht mehr verwertbar ist, wird<br />
schließlich ausgeschieden. Am Schließmuskel<br />
des Afters endet die Macht des<br />
Bauchhirns. Das Gehirn nimmt den<br />
Stuhldrang wahr und entscheidet, wann<br />
der Zeitpunkt gekommen ist, den Darm<br />
auf der Toilette zu entleeren.<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
29<br />
FOTO: EYE OF SCIENCE/AGENTUR FOCUS
FOTO: EYE OF SCIENCE/AGENTUR FOCUS<br />
Die Symptome reichen von Blähungen<br />
und Völlegefühl über Verstopfung<br />
und Durchfall bis hin zu<br />
Bauchkrämpfen. Einige Patienten leiden<br />
ständig unter Beschwerden, bei den<br />
meisten treten sie nur gelegentlich auf.<br />
Nachts verschwinden die Symptome in<br />
der Regel. Nicht bei allen Betroffenen<br />
sind die Beschwerden derart ausgeprägt,<br />
dass sie damit zum Arzt gehen. Wer<br />
jedoch stark darunter leidet, fürchtet<br />
häufig eine schwere Krankheit und begibt<br />
sich oft auf eine lange Odyssee von<br />
Arzt zu Arzt, bis es endlich zur richtigen<br />
Diagnose kommt. Oft ist es für die Patienten<br />
dann eine Erleichterung, zu wissen,<br />
dass es sich bei ihren Beschwerden<br />
„nur“ um ein Reizdarmsyndrom handelt.<br />
Was sich wie eine Lappalie anhört, kann<br />
den Alltag der Betroffenen sabotieren.<br />
Die Verdauung beginnt, den Tagesablauf<br />
zu diktieren. Arbeit, Freizeitgestaltung<br />
und das Verhältnis zu Mitmenschen<br />
können erheblich beeinträchtigt werden,<br />
wenn sich der Verdauungsapparat permanent<br />
schmerzhaft und unangenehm<br />
bemerkbar macht, und damit das Wohlbefinden<br />
stark einschränkt.<br />
Da Verdauungsbeschwerden in der Regel<br />
als Tabuthema gelten, werden sie zudem<br />
ungern angesprochen.<br />
Die gute Meldung: Das Reizdarmsyndrom<br />
an sich ist nicht gefährlich. Es<br />
ist nicht bösartig oder ansteckend und<br />
erhöht auch nicht das Risiko für<br />
Ein Parasit in der Darmschleimhaut:<br />
Nach bereits abgeklungenen<br />
Infektionen mit Parasiten oder<br />
anderen Mikroorganismen kann<br />
sich trotzdem später noch ein<br />
Reizdarmsyndrom entwickeln<br />
Beschwerden, bei denen Sie unbedingt<br />
den Arzt aufsuchen sollten:<br />
anhaltende Schmerzen im Bauchbereich<br />
andauernder heftiger Durchfall<br />
Schluckprobleme<br />
sehr starkes Erbrechen<br />
deutlicher Gewichtsverlust<br />
Gelbfärbung der Augen und der Haut<br />
schwarzer Stuhl (Teerstuhl)<br />
blasses Aussehen, Herzklopfen<br />
Wenn der Bauch rebelliert und der Arzt nichts findet<br />
Einem Phantom auf der Spur: Die Hälfte aller Patienten mit Magen-Darm-<br />
Problemen leiden am so genannten Reizdarmsyndrom. Rund 15 Prozent der<br />
Deutschen sind davon – mehr oder weniger – betroffen. Vor allem sind dies<br />
Menschen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren und zum Großteil Frauen.<br />
30 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Darmkrebs oder andere schwere Krankheiten.<br />
Obwohl das Reizdarmsyndrom<br />
oft über Monate und Jahre andauert und<br />
das Allgemeinbefinden stark beeinträchtigt,<br />
wird die Lebenserwartung nicht<br />
eingeschränkt. Im Gegenteil: Die Betroffenen<br />
leben laut Statistik sogar ein<br />
bisschen länger als der Durchschnitt der<br />
Bevölkerung. Der Grund: Menschen<br />
mit diesem Leiden leben oft wesentlich<br />
gesünder als der Durchschnitt, weil sie<br />
mehr auf ihren Körper hören, sich<br />
bewusster ernähren und meist auch die<br />
Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge<br />
besser nutzen, da sie häufiger zum Arzt<br />
gehen als der Durchschnittsbürger.<br />
Da die Symptome des Reizdarmsyndroms<br />
anderen Erkrankungen ähnlich sind,<br />
sollte ein Arzt zunächst schwer wiegende<br />
Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis<br />
ulcerosa oder Darmkrebs ausschließen.<br />
Auch Virusinfektionen, eine Magenschleimhautentzündung<br />
(Gastritis) oder<br />
Geschwüre können ähnliche Symptome<br />
erzeugen wie das Reizdarmsyndrom.
Heute Übelkeit, morgen aufgebläht und übermorgen<br />
Magenschmerzen: Der Reizdarm äußert sich durch wechselnde<br />
Beschwerden<br />
Krank – und doch nicht krank<br />
Noch gibt es keine eindeutig bewiesenen<br />
Ursachen für die Beschwerden des<br />
Reizdarmsyndroms. Da kein wirklicher<br />
Auslöser für die Fehlfunktion im Darm<br />
gefunden werden kann, galten die<br />
Beschwerden bislang häufig als rein<br />
psychosomatisch – also „von der Psyche<br />
ausgelöst“. Nicht selten wurden die<br />
Betroffenen hinter vorgehaltener Hand<br />
daher auch als Hypochonder bezeichnet.<br />
Seit der Entdeckung des Bauchhirns<br />
kann man sich inzwischen in der Fachwelt<br />
auch vorstellen, dass nicht nur das<br />
Kopfhirn falsche Befehle erteilen und so<br />
zu psychosomatischen Störungen führen<br />
kann, sondern dass auch das Bauchhirn<br />
falsche Entscheidungen trifft oder die<br />
Kommunikation zwischen Kopfhirn und<br />
Bauchhirn fehlerhaft sein kann. So<br />
nimmt man zum Beispiel an, dass die<br />
Informationen aus dem Bauchraum,<br />
die normalerweise nicht bewusst wahrgenommen<br />
werden, beim Reizdarmsyn-<br />
FOTO: STONE<br />
FOTO: STONE<br />
Wer unter einem Reizdarm leidet, wird des Öfteren plötzlich von<br />
Verdauungsbeschwerden heimgesucht. Das kann in manchen<br />
Situationen sehr unangenehm sein.<br />
FOTO: PHOTOS.COM<br />
drom ungefiltert ins Bewusstsein der<br />
Patienten dringen. Die Verdauungsvorgänge<br />
– die andere Menschen gar nicht<br />
wahrnehmen – können so bei diesen<br />
Menschen Beschwerden oder sogar<br />
Schmerzen auslösen. So haben Tests<br />
ergeben, dass Reizdarmpatienten einen<br />
im Darm aufgepusteten Ballon bereits<br />
in einer Größe spüren, die von nicht<br />
betroffenen Menschen noch gar nicht<br />
wahrgenommen wird.<br />
Doch warum ist bei manchen Menschen<br />
die Reizschwelle für Schmerzen im<br />
Bauchraum so niedrig? Darüber gibt es<br />
bis jetzt nur Vermutungen. Bekannt ist,<br />
dass die Schmerzschwelle bei Frauen im<br />
Laufe des weiblichen Zyklus schwanken<br />
kann. Frauen sind häufiger vom Reizdarmsyndrom<br />
betroffen als Männer.<br />
Auch Stress, Ängste und Ärger machen<br />
für Schmerzen empfindlicher. Die<br />
Schmerzen und die Angst vor einer<br />
schlimmen Krankheit treiben die Betroffenen<br />
dann zum Arzt – was gut ist –,<br />
Mit Röntgenbildern kann der Weg eines<br />
Kontrastmittels durch den gesamten<br />
Magen-Darm-Trakt verfolgt werden. So<br />
kann der Arzt genau<br />
erkennen, wo eine eventuelle Störung<br />
vorliegt. In diesem Fall ist alles<br />
in Ordnung.<br />
denn nur so kann festgestellt werden,<br />
ob ein organisches Leiden vorliegt oder<br />
ob der Patient organisch gesund ist. Es<br />
ist ebenfalls möglich, dass eine Fehlfunktion<br />
im Haushalt der Neurotransmitter<br />
(Nervenbotenstoffe) im Darm das<br />
Reizdarmsyndrom auslösen kann. Beispielsweise<br />
könnte ein Mangel an Serotonin,<br />
der im Gehirn zu Depressionen<br />
führen kann, im Darm ein Reizdarmsyndrom<br />
auslösen. Denn Neurotransmitter<br />
wirken gleichermaßen in Hirn und Darm.<br />
Das erklärt auch, warum bestimmte<br />
Antidepressiva – die ja eigentlich gezielt<br />
auf Neurotransmitter im Gehirn einwirken<br />
sollen – sich auch positiv auf das<br />
Reizdarmsyndrom auswirken können.<br />
Natürlich spielen auch Belastungen wie<br />
psychischer Stress eine große, wenn auch<br />
nicht die alleinige Rolle bei der Entwicklung<br />
eines Reizdarmsyndroms. Oft leiden<br />
Menschen darunter, die auch anfällig für<br />
depressive Verstimmungen oder Depressionen<br />
sind. Meist sind dies Personen, die<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
31
FOTO: T. PFLAUM/VISUM<br />
generell empfindlicher als andere sind.<br />
Nicht ganz klar ist allerdings, was am<br />
Anfang steht: die Verstimmung oder das<br />
Reizdarmsyndrom. Denn die Belastungen<br />
durch die Beschwerden sowie die<br />
Einschränkungen im Alltag, die damit<br />
einhergehen, schlagen wiederum auf die<br />
Stimmung. Auch kann das Gedächtnis<br />
des Bauchhirns für die Fehlfunktion verantwortlich<br />
sein. Wie bereits erwähnt,<br />
entwickeln besonders oft diejenigen das<br />
Reizdarmsyndrom, die bereits als Babys<br />
unter Darmkoliken litten. Das Bauchhirn<br />
hat die Koliken in Erinnerung behalten.<br />
Das Gleiche, so vermuten Forscher, kann<br />
nach schweren Magen-Darm-Infektionen<br />
passieren. Die Reaktionen des Darmes auf<br />
die Bakterien und Viren „brennen“ sich in<br />
das neuronale Netzwerk des ENS ein und<br />
bleiben diesem in Erinnerung. Auch wenn<br />
die Infektion abgeklungen ist, gibt das<br />
Bauchhirn noch Alarm, und der organisch<br />
Gesunde fühlt sich krank.<br />
32 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Was hilft?<br />
Um andere Erkrankungen auszuschließen,<br />
sollten Reizdarmpatienten<br />
einen Spezialisten aufsuchen, der mithilfe<br />
unterschiedlicher Untersuchungen<br />
die Diagnose „organisch gesund“ stellen<br />
kann. Schon dies ist eine große Erleichterung<br />
für Betroffene, die häufig befürchten,<br />
an schlimmeren Erkrankungen<br />
zu leiden. Wegen der Verschiedenartigkeit<br />
der Beschwerden ist eine medikamentöse<br />
Therapie oft schwierig, weil ein Arzneimittel,<br />
das das eine Symptom lindern<br />
kann, möglicherweise ein anderes verstärkt.<br />
Auch Ernährungsempfehlungen<br />
sind schwer zu geben, weil die Patienten<br />
recht unterschiedlich auf Lebensmittel<br />
reagieren. Wer allerdings weiß, auf<br />
welche Nahrungsmittel sein Verdauungstrakt<br />
empfindlich reagiert, sollte diese<br />
meiden. Hilfreich ist es deshalb auch,<br />
mögliche Lebensmittelunverträglichkeiten<br />
durch den Arzt ausschließen zu las-<br />
Mithilfe der Endoskopie kann<br />
im Darm nach der Ursache der<br />
Beschwerden gesucht werden.<br />
In manchen Fällen kann sie<br />
sogar beseitigt werden. Hier<br />
wird ein Darmpolyp mit einer<br />
Schlinge entfernt.<br />
Mit solchen kleinen Kameras schaut der Gastroenterologe<br />
in den Darmtrakt. Die Bilder werden gleichzeitig auf einen<br />
Monitor übertragen.<br />
sen. Doch hier sollten Sie aufmerksam<br />
sein, denn manche der angebotenen<br />
Tests auf Lebensmittelunverträglichkeiten<br />
sind umstritten in ihrer Aussagefähigkeit<br />
und zudem sehr teuer. Am<br />
besten suchen Sie daher einen Facharzt<br />
für Allergologie auf, wenn Sie eine<br />
Lebensmittelunverträglichkeit vermuten.<br />
Grundsätzlich wird Reizdarmpatienten<br />
zu einer ballaststoffreichen Ernährung<br />
geraten: viel Vollkornprodukte, Obst und<br />
Gemüse. Das kann zwar zunächst zu<br />
Blähungen führen, ist auf lange Sicht<br />
jedoch am gesündesten. Zu heilen ist das<br />
Reizdarmsyndrom bislang leider noch<br />
nicht. Betroffene sollten sich daher<br />
darauf einstellen, langfristig mit den<br />
Symptomen zu leben. Oft kann allerdings<br />
eine psychotherapeutische Behandlung<br />
oder eine alternative seelische<br />
Auseinandersetzung helfen. Weitere<br />
Tipps für einen gesunden Magen und<br />
Darm finden Sie am Ende des Textes.<br />
FOTO: JÖRG LANTELME
Das Helicobacter Pylori: Die Bakterien sind spiralförmig gewunden<br />
und haben bis zu sieben Geißeln. Sie besiedeln ausschließlich<br />
die Magenschleimhaut.<br />
Ein tückisches Bakterium<br />
ach Überzeugung des Spezialisten<br />
Dr. Manfred Stolte vom Klinikum<br />
Bayreuth gehört die Helicobacteriose zu<br />
den häufigsten Infektionskrankheiten<br />
der Welt. Allein in Deutschland sollen<br />
90 Prozent aller Magenschleimhautentzündungen<br />
auf eine Infektion mit<br />
Helicobacter Pylori zurückzuführen sein.<br />
Nach wie vor ist aber nicht eindeutig geklärt,<br />
warum es Menschen gibt, die sich<br />
mit Helicobacter Pylori infiziert haben,<br />
ohne je unter den genannten Symptomen<br />
zu leiden. Ebenfalls ist man sich noch<br />
nicht ganz im Klaren darüber, warum trotz<br />
der hohen Infektionsrate nicht jede Infektion<br />
zur Entstehung von Zwölffingerdarmgeschwüren<br />
oder Magenkrebs führt.<br />
Die Lebensbedingungen des<br />
Helicobacters Pylori<br />
Die Magensäure hat zwei wichtige Funktionen.<br />
Zum einen schützt sie den Magen<br />
vor vielen schädlichen Bakterien, die<br />
durch die Nahrung aufgenommen werden,<br />
FOTO: DR. GARY GAUGLER/OKAPIA<br />
Ist die Magenschleimhaut vom Bakterium<br />
befallen, kann eine Magenschleimhautentzündung<br />
(Gastritis) die Folge sein.<br />
Ähnliche Symptome wie beim Reizdarmsyndrom können sich auch bei einer Infektion des Magens mit dem<br />
Bakterium Helicobacter Pylori einstellen. Die Infektion führt jedoch leider in der Regel zu einer Magenschleimhautentzündung<br />
(Gastritis) und häufig auch zu Folgeerkrankungen, wie z. B. Magengeschwüren.<br />
N<br />
und zum anderen wird die Nahrung durch<br />
die Magensäure „angedaut“ und für die<br />
weitere Verdauung vorbereitet. Ist zu wenig<br />
Magensäure vorhanden, stellen sich<br />
Verdauungsprobleme sowie ein allgemeines<br />
Unwohlsein, ein Völlegefühl, Druckschmerzen<br />
im Oberbauch und zum Beispiel<br />
Übelkeit ein. Was für die Verdauung<br />
schlecht ist, ist für die Helicobacter Pylori<br />
von Vorteil. Das Bakterium fühlt sich in<br />
einem säurearmen Milieu so richtig wohl<br />
und findet die besten Voraussetzungen für<br />
eine Vermehrung vor. Aber auch bei einer<br />
normalen Magensäureproduktion hat der<br />
Krankheitserreger nicht nur gute Chancen,<br />
zu überleben, sondern kann sich auch<br />
noch vermehren. Dies schafft die Helicobacter<br />
Pylori, indem es mithilfe des Enzyms<br />
Urease Ammoniak bildet. Diese Lauge<br />
ist in der Lage, in der Umgebung des<br />
Helicobacters die aggressive Magensäure<br />
zu neutralisieren, sodass sich das Bakterium<br />
in den Schleimhautfalten des Magens<br />
einnisten kann. Der von diesen gebildete<br />
Schleim schützt das Bakterium zusätzlich<br />
vor der Magensäure. So kann sich das<br />
Helicobacter ungehindert in der Magenschleimhaut<br />
vermehren – und schädigt die<br />
Zellen der Magenschleimhaut, wodurch es<br />
zur Entzündung (Gastritis) kommt.<br />
Wie kann man eine Infektion<br />
mit dem Helicobacter Pylori<br />
feststellen?<br />
1) Gastroskopie (Magenspiegelung)<br />
Bei der Magenspiegelung wird durch den<br />
Mund ein Schlauch in den Magen eingeführt.<br />
Durch diesen Schlauch können<br />
eine kleine Kamera und spezielle medizinische<br />
Instrumente eingeführt werden.<br />
Dabei kann auch eine Gewebeprobe der<br />
Magenschleimhaut entnommen werden,<br />
die dann auf Helicobacter Pylori untersucht<br />
werden kann. Gleichzeitig kann<br />
über das Kamerabild festgestellt werden,<br />
ob das Helicobacter schon einen Schaden<br />
an der Magenschleimhaut angerichtet hat<br />
(z. B. Entzündungen, Geschwüre, Tumore).<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
33<br />
FOTO: EYE OF SCIENCE/AGENTUR FOCUS
FOTO: EYE OF SCIENCE/AGENTUR FOCUS<br />
2) Harnstoff-Atemtest<br />
Bei diesem Atemtest trinkt der Patient<br />
eine Lösung mit Harnstoff, dessen Kohlenstoffatome<br />
markiert sind. Liegt eine<br />
Infektion mit Helicobacter Pylori vor,<br />
verwandelt dessen Enzym Urease den<br />
Harnstoff in Ammoniak, dabei wird der<br />
markierte Kohlenstoff frei, den der<br />
Patient ausatmet. Nach halbstündiger<br />
Wartezeit bläst der Patient deshalb in<br />
ein Röhrchen und seine Atemluft wird<br />
im Labor mit bestimmten Messgeräten<br />
(Massenspektrometer) auf Kohlenstoffatome<br />
analysiert. Lassen sich markierte<br />
Kohlenstoffatome in der Atemluft feststellen,<br />
leidet der Betroffene an einer<br />
Helicobacterinfektion.<br />
Therapie<br />
Liegt eine Infektion mit Helicobacter<br />
Pylori vor, lässt sich das Bakterium in sehr<br />
kurzer Zeit abtöten. Drei verschiedene<br />
Präparate müssen hierzu sieben Tage lang<br />
eingenommen werden. Ein Säurehemmer<br />
(Antacidum) hemmt die Magensäureproduktion<br />
und zwei Antibiotika vernichten<br />
das Helicobacter Pylori. Wird die<br />
medikamentöse Behandlung konsequent<br />
sieben Tage lang durchgeführt, so ist das<br />
Bakterium abgetötet, und die Magenprobleme<br />
sind beseitigt.<br />
34 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Schon im Magen werden viele Krankheitserreger<br />
durch die Magensäure<br />
abgetötet. Weiter unten im Verdauungstrakt,<br />
im Dickdarm, unterstützt die so<br />
genannte Darmflora mit Billionen von<br />
Bakterien die Abwehr schädlicher Erreger<br />
und Pilze.<br />
Bakterien sind überall. Sie besiedeln<br />
unsere Haut und die Schleimhäute wie ein<br />
dicker Rasen. Mit unserer Geburt beginnt<br />
eine lebenslange Auseinandersetzung mit<br />
diesen Keimen, aber auch eine Lebensgemeinschaft<br />
mit der Bakterienmikroflora<br />
im Darm. Wir geraten häufig aus dem<br />
Gleichgewicht, wenn irgendein Einfluss<br />
dazu führt, dass sich die normale Zusammensetzung<br />
der Darmflora ändert. Das<br />
können Stress, Antibiotika oder Mikroorganismen<br />
wie Viren und Bakterien sein.<br />
Man kann dem Immunsystem helfen,<br />
indem man der Darmflora „freundliche“<br />
Bakterien zuführt, die unschädlich sind,<br />
weil sie ohnehin zur Darmflora gehören<br />
und diese deshalb bei ihrer Regeneration<br />
Bei den Bakterien der Gattung Enterobacter<br />
handelt es sich um eine Gruppe<br />
von Stäbchenbakterien, die in fast allen<br />
Lebensräumen einschließlich des<br />
mensch-lichen Darmes vorkommen. Dort<br />
gehören sie zur normalen Darmflora.<br />
Das Magenbakterium Helicobacter Pylori kann auch über<br />
Küsse übertragen werden – allerdings sehr selten bei<br />
Erwachsenen. Oft überträgt es die Mutter auf ihr Baby.<br />
Über die Nahrung nehmen wir nicht nur Nützliches für unsere Gesundheit<br />
auf. Tagtäglich gelangen auch Gifte und Krankheitserreger in unseren Körper.<br />
Doch unser Organismus ist darauf bestens vorbereitet.<br />
unterstützen. Zu den wirkungsvollsten<br />
Helfern der Darmflora gehören die Milchsäurebakterien<br />
(z. B. Lactobacillen, Bifidobakterien).<br />
Der Lactobacillus beispielsweise<br />
haftet bevorzugt an der Darmwand<br />
und regt dort die Produktion von Antikörpern<br />
an, die gezielt fremde Substanzen<br />
binden, und stimuliert die natürliche<br />
Schutzfunktion körpereigener Zellen.<br />
Die Milchsäurebakterien können auch<br />
nachweislich die Ansiedlung des Helicobacters<br />
Pylori verhindern. Damit sie ihre<br />
gesundheitliche Wirkung im Darm entfalten<br />
können, müssen die Bakterien eine<br />
hohe Resistenz gegenüber Magensäure<br />
und Verdauungsenzymen aufweisen, um<br />
lebend und in aktiver Form im Darmtrakt<br />
anzukommen. Deshalb empfiehlt sich der<br />
Verzehr von Produkten mit probiotischen<br />
Kulturen, d.h. Bakterien, die resistent<br />
gegen die Magensäure sind. Hierfür bieten<br />
sich möglichst frische probiotische Jogurts<br />
und Milchprodukte an oder aber hochwertige<br />
Nahrungsergänzungen mit probioti-<br />
FOTO: DIGITALVISION
schen Kulturen. Nehmen Sie probiotische<br />
Kulturen in Kapselform ein, etwa durch<br />
ein Multivitalstoff-Präparat, können Sie<br />
sicher sein, dass Sie stets eine fest definierte<br />
Menge der Milchsäurebakterien aufnehmen.<br />
Mit diesen probiotischen Kulturen<br />
können Sie die Verdauung fördern und<br />
sogar Durchfallerkrankungen verkürzen.<br />
Studien zufolge steigt die Zahl der<br />
„guten“ Darmbakterien nach dem Verzehr<br />
probiotischer Produkte deutlich an. Diese<br />
Lebensmittel können ihre spezifische Wirkung<br />
aber nur dann entfalten, wenn Sie<br />
sie regelmäßig, das heißt täglich, verzehren.<br />
Im Zusammenhang mit Probiotika<br />
fällt häufig auch das Schlagwort Prebiotika.<br />
Während es sich bei den Probiotika<br />
wie beschrieben um lebende Bakterien<br />
handelt, sind Prebiotika besondere Ballaststoffe<br />
wie Oligofructose oder Inulin.<br />
Sie können von den menschlichen Verdauungsenzymen<br />
zwar nicht abgebaut<br />
werden, aber sie dienen den nützlichen<br />
Darmbakterien als Nahrung. Damit<br />
fördern die Prebiotika das Wachstum der<br />
probiotischen Keime, wodurch sich deren<br />
positive gesundheitliche Wirkung verstärkt.<br />
Mit einem Multivitalstoff-Präparat,<br />
das sowohl Probiotika als auch Prebiotika<br />
enthält, können Sie Ihre Darmflora somit<br />
besonders gut unterstützen.<br />
MEDICOM-Tipps<br />
Ingwer – Schutzschild<br />
für Magen und Darm<br />
Die ätherischen Öle und Scharfstoffe<br />
des Ingwers regen die Galleproduktion<br />
an und unterstützen so die Fettverdauung.<br />
Außerdem fördert Ingwer<br />
die Erhaltung der Darmflora, schützt<br />
die Magenschleimhaut und stärkt<br />
die körpereigenen Abwehrkräfte. Bei<br />
warmen Gerichten sollte Ingwer einige<br />
Minuten mitgaren, um sein volles<br />
Aroma zu entfalten. Zum Würzen mit<br />
frischem Ingwer drücken Sie ihn am<br />
besten durch eine Knoblauchpresse,<br />
dann bleiben die harten Fasern<br />
zurück. Sie können sich auch einen<br />
schmackhaften Ingwertee zubereiten,<br />
indem Sie die Knolle mit kochendem<br />
Wasser übergießen.<br />
FOTO: DIGITALVISION<br />
Bei Magen- und Darmbeschwerden<br />
ist es sehr wichtig, viel zu trinken.<br />
Besonders gut ist Wasser. Ganz<br />
besonders bei Verstopfung.<br />
Artischocke<br />
bringt die<br />
Fettverdauung auf Touren<br />
Artischocken schmecken nicht nur<br />
gut, sondern sie sind auch sehr gut<br />
für die Gesundheit. Die Artischocke<br />
unterstützt die Leber bei der Fettverdauung,<br />
kann den Cholesterinspiegel<br />
senken und bei der Entwässerung des<br />
Organismus helfen. Ein so aktivierter<br />
Stoffwechsel wirkt sich positiv auf<br />
den Darm aus, Blähungen und Völlegefühl<br />
verschwinden.<br />
Diese Effekte lassen sich aber weniger<br />
durch den Verzehr handelsüblicher<br />
Artischockenherzen erreichen, sondern<br />
viel besser durch die Anwendung<br />
von Artischockenpräparaten.<br />
Denn diese Arzneimittel enthalten<br />
meist einen Trockenextrakt, der aus<br />
den Kelchblättern der Blüte von<br />
Artischocken gewonnen wird – dem<br />
Pflanzenbestandteil, der üblicherweise<br />
gar nicht verzehrt wird.<br />
FOTO: PHOTOS.COM<br />
Hilfe für Magen und Darm<br />
Achten Sie auf eine ballaststoffreiche<br />
Nahrung (Vollkorn, Obst, Gemüse)<br />
und meiden Sie fettige Speisen<br />
Trinken Sie täglich 1,5 bis zwei<br />
Liter Flüssigkeit<br />
Vermeiden Sie Fastfood und vorgefertigte<br />
Lebensmittel<br />
Machen Sie Ihre Ernährungsansichten<br />
jedoch nicht zur „Religion“:<br />
Hin und wieder darf man auch mal<br />
etwas „Falsches“ essen – man sollte<br />
sich dessen nur bewusst sein<br />
Vermeiden Sie Genussgifte wie<br />
Kaffee, Alkohol und Nikotin<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
35<br />
FOTO: PHOTODISC
Hausmittel bei Magen- und Darmbeschwerden<br />
Durchfall<br />
Meistens geht Durchfall auf eine Darminfektion<br />
zurück, die von selbst wieder<br />
abklingt. Wenn er länger anhält, sollten<br />
Sie allerdings einen Arzt aufsuchen.<br />
Medikamente, die den Durchfall stoppen,<br />
sind nur sinnvoll, um einen erhöhten<br />
Wasserverlust zu vermeiden. Ansonsten<br />
sollte der Durchfall nicht mit Medikamenten<br />
unterbunden werden (außer auf<br />
Anweisung des Arztes). Denn in der Regel<br />
handelt es sich dabei um eine natürliche<br />
Reaktion des Körpers. Der Durchfall ist<br />
eine Art Reinigungsmechanismus, der den<br />
Körper möglichst schnell von Krankheitserregern<br />
oder schädlichen Substanzen befreien<br />
soll. Wird der Durchfall unterbunden,<br />
verbleiben die schädlichen Keime im<br />
Magen-Darm-Trakt. Bei Durchfall sollten<br />
Sie sehr viel Wasser oder Kräutertee<br />
trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.<br />
Den Kräutertee können Sie<br />
auch mit etwas schwarzem Tee mischen,<br />
um den Kreislauf zu unterstützen.<br />
36 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
Bei Sodbrennen kann<br />
Pfefferminztee<br />
beruhigend wirken<br />
Aus Omas Apotheke: Altbekannt ist Kamillentee sehr wirksam bei Magenschmerzen. Gegen<br />
einen aufgeblähten Bauch helfen Tees aus Fenchel oder Kümmel.<br />
Verstopfung<br />
Von einer Verstopfung kann erst nach<br />
Ablauf von drei Tagen ohne Stuhlgang<br />
gesprochen werden. Die Einnahme<br />
von Abführmitteln darf höchstens zwei<br />
Wochen lang erfolgen, weil man sonst<br />
Gefahr läuft, dass die Medikation nicht<br />
mehr anschlägt. Missbrauch von Abführmitteln<br />
verstärkt die Darmträgheit nur<br />
noch zusätzlich. Man sollte es daher<br />
zunächst mit natürlichen „Abführhilfen“<br />
versuchen.<br />
Natürliche Alternative zu<br />
Abführmitteln: Leinsamen<br />
Für die Anwendung von Leinsamen als<br />
Abführmittel wird von der Sachverständigenkommission<br />
E des Bundesgesundheitsamtes<br />
eine Dosierungsanleitung angegeben.<br />
Für Erwachsene wird zwei- bis<br />
drei mal täglich ein Esslöffel (zirka zehn<br />
Gramm) ganzer oder nur angestoßener<br />
(nicht geschroter) Leinsamen mit ausreichend<br />
Flüssigkeit (mind. die zehnfache<br />
Menge des Leinsamens) empfohlen. Kinder<br />
von sechs bis zwölf Jahren sollen bei<br />
Verstopfung die Hälfte der Erwachsenendosierung<br />
einnehmen. Auch ein Glas<br />
Wasser nach dem Aufstehen kann helfen,<br />
die Darmtätigkeit anzuregen.<br />
Bauch- und Magenschmerzen<br />
Bauchschmerzen können eine Fülle von<br />
Ursachen haben. Halten sie länger an,<br />
sollten Sie einen Arzt konsultieren. Gegen<br />
Magenschmerzen hilft Kamillentee. Bei<br />
Bauchschmerzen, die auf einen aufgeblähten<br />
Darm zurückgehen, verschaffen<br />
Kümmel- und Fencheltee Linderung.<br />
Sodbrennen<br />
Verzichten Sie bei Sodbrennen auf Kaffee<br />
und Alkohol (insbesondere Sekt und<br />
Weißwein), denn diese fördern die<br />
Bildung von Magensäure, die bei Sodbrennen<br />
schmerzhaft in die Speiseröhre<br />
eintritt. Kamillen- oder Pfefferminztee<br />
können beruhigend wirken.<br />
FOTOS: PHOTODISC/PHOTOS.COM
Medikamente<br />
Vitalstoffe für Magen<br />
und Darm<br />
Vitamin A und Vitamin C sind gut für<br />
die Erhaltung der Darmschleimhäute<br />
Vitamin B1 ist gut für die Darmmuskulatur<br />
Alle B-Vitamine sind wichtig für Patienten<br />
mit Darmerkrankungen<br />
Magnesium hilft bei Verstopfung<br />
Eisen ist wichtig bei entzündlichen<br />
Darmerkrankungen, bei Blutungen<br />
im Magen-Darm-Bereich und nach<br />
Magen- oder Darmresektionen<br />
Wie bereits erwähnt ist die Therapie des<br />
Reizdarmsyndroms mit Medikamenten<br />
wegen der Unterschiedlichkeit der Beschwerden<br />
nicht einfach. In Zukunft soll<br />
der Wirkstoff Cilansetron, der sich noch<br />
in der Testphase befindet, Reizdarmpatienten<br />
helfen können. Man rechnet mit<br />
einer Markteinführung noch in diesem<br />
Jahr. Der Wirkstoff soll die gestörte<br />
Koordination im Darm durch eine gezielte<br />
Beeinflussung des Darmhirns positiv<br />
beeinflussen und auch gegen Durchfall<br />
helfen. Bis dahin helfen bei sehr starken<br />
Beschwerden andere Medikamente. Die<br />
Behandlung richtet sich dabei nach den<br />
Beschwerden: Schmerzen, Verstopfung,<br />
Durchfall oder Blähungen.<br />
Gegen die Schmerzen helfen Krampflöser,<br />
wie Mebeverin oder Butylscopolamin.<br />
Verstopfung kann man mit<br />
Abführmitteln wie Lactulose oder Tegaserod<br />
behandeln. Gegen Durchfall hilft<br />
Loperamid. Dieser Wirkstoff bremst die<br />
Darmbewegung.<br />
Gegen Blähungen helfen entschäumende<br />
Medikamente (Wirkstoff: Dimeticon).<br />
Sodbrennen ist in den meisten Fällen auf<br />
zu üppiges Essen zurückzuführen. Isst<br />
man wieder normal, ist das Sodbrennen<br />
vorbei. Doch es gibt auch Menschen, die<br />
gesund essen und dennoch ständig unter<br />
Sodbrennen leiden. Hier spricht man von<br />
einem Reflux. Dagegen helfen so genannte<br />
Antacida, die die Magensäure binden.<br />
Außerdem helfen Präparate, die einen<br />
Film über die Magenschleimhaut legen<br />
(Gaviscon). Vom Arzt verschrieben werden<br />
H2-Blocker und Protonenpumpenblocker,<br />
die jedoch nicht rezeptfrei sind.<br />
Entspannter Geist –<br />
entspannter Bauch<br />
Tipps für körperliches und<br />
geistiges Wohlbefinden<br />
Treiben Sie mindestens einmal die Woche<br />
Sport!<br />
Bewegen Sie sich so oft wie möglich an<br />
der frischen Luft – auch wenn es regnet<br />
oder schneit!<br />
Genießen Sie schöne Stunden, ohne sie<br />
sich durch unbegründete Sorgen zu vermiesen!<br />
Achten Sie beim Sitzen auf eine gerade<br />
Haltung! Wer krumm sitzt, behindert<br />
Magen und Darm bei der Verdauung<br />
Benutzen Sie immer die Treppe statt<br />
den Aufzug!<br />
Auch wenn Obst und Gemüse bei manchen<br />
Beschwerden wie Durchfall mit Vorsicht zu<br />
genießen sind – auf Dauer ist eine ausgewogene<br />
Mischkost mit viel Vitaminen und Mineralstoffen<br />
das Beste für unser Verdauungssystem.<br />
Lernen Sie mit Stress umzugehen – zum<br />
Beispiel durch Entspannungsübungen,<br />
Meditation oder Yoga (siehe Seite 18)!<br />
Lassen Sie öfter die Seele baumeln und<br />
träumen Sie von schönen Dingen!<br />
Sorgen Sie für ausreichend Schlaf!<br />
Meiden Sie enge, einschnürende Kleidung,<br />
weil sie die Darmbewegungen behindert!<br />
Legen Sie kurze Strecken zu Fuß oder<br />
mit dem Fahrrad zurück!<br />
B U C H - T I P P S<br />
Michael Gershon:<br />
Der kluge Bauch.<br />
Die Entdeckung des<br />
zweiten Gehirns,<br />
Goldmann,<br />
479 Seiten,<br />
€ 10,—<br />
Dr. med. Amrei Pfeiffer:<br />
Magen und Darm<br />
natürlich behandeln,<br />
Gräfe und Unzer<br />
Verlag, 45 Seiten,<br />
€ 12,90<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
37<br />
FOTO: PHOTODISC
Die vielen neuen Ratgeber<br />
zum Thema „Einfacher leben“<br />
zeigen: Einfachheit und „Ballast<br />
abwerfen“ liegen im Trend. Immer<br />
mehr Menschen sind der Auffassung<br />
„Weniger ist mehr“ und entrümpeln<br />
ihr Leben. Das große Ausmisten bezieht<br />
sich nicht nur auf angesammelten<br />
Kram und überflüssigen Ballast,<br />
sondern auch auf angestaubte Überzeugungen<br />
und sperrige Denkmuster.<br />
Man muss nicht alles haben – und<br />
man muss nicht alles können.<br />
38 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
DIE NEUE<br />
EINFACHHEIT<br />
EINFACHHEIT<br />
ÜBERFLUSS SCHAFFT<br />
ÜBERDRUSS<br />
B<br />
„ Wenn einer das rechte<br />
Maß überschreitet,<br />
kann ihm das<br />
“<br />
Erfreulichste zum<br />
Unerfreulichsten werden.<br />
(Demokrit,<br />
griechischer Philosoph)<br />
Ballast macht unfrei.<br />
Wer mit schwerem<br />
Gepäck durchs Leben reist,<br />
wird unbeweglich.<br />
Es handelt sich nicht nur um eine<br />
vorübergehende Mode. Studien von<br />
Zukunftsforschern kommen zu dem<br />
Ergebnis, dass ein weit reichender Wertewandel<br />
hin zur Einfachheit stattfindet.<br />
Die Idee ist nichts Neues. Schon die alten<br />
Griechen suchten nach dem richtigen<br />
Maß. „Pan metron ariston“ – alles in<br />
Maßen – lautete eine der zentralen Botschaften<br />
ihrer Lebensphilosophie.<br />
A
Was ist wirklich wichtig?<br />
Was ist wirklich wichtig im Leben?<br />
Studien zufolge wird diese Frage immer<br />
zentraler für die Menschen. Und sie führt<br />
zu den einfachen Dingen: Liebe, Freundschaft,<br />
Gelassenheit und Zufriedenheit.<br />
Doch das Einfache ist oft gar nicht so<br />
einfach.<br />
„Einfachheit ist das Resultat der Reife“,<br />
wusste auch Friedrich von Schiller.<br />
Wer sich auf das Wesentliche reduziert,<br />
erhöht die Lebensqualität und vermindert<br />
Stress und Abhängigkeiten. Tipps für<br />
Strategien, wie Sie Ihr Leben zufriedener<br />
gestalten können, finden Sie hier.<br />
Strategien zum Ausmisten<br />
Entrümpeln Sie Ihren Besitz. Wer mit<br />
schwerem Gepäck durchs Leben reist,<br />
wird unbeweglich<br />
Welche Dinge in Ihrer Wohnung oder<br />
in Ihrem Haus mögen oder benötigen<br />
Sie wirklich? Was hat sich im Laufe der<br />
Jahre nur angesammelt?<br />
Gegenstände, Kleider und Möbel, die<br />
nicht ständig gebraucht werden, müssen<br />
gepflegt werden. Das kostet Zeit. Was zwei<br />
Jahre lang nutzlos war, werden Sie auch<br />
die nächsten Jahre nicht vermissen. Verschenken<br />
Sie es, werfen Sie es weg oder<br />
verkaufen Sie es zum Beispiel auf dem<br />
Flohmarkt<br />
Wenn Sie meinen, dafür zu beschäftigt<br />
zu sein, sollten Sie sich daran erinnern,<br />
dass Sie die Zeit hatten, sich alles zuzulegen.<br />
Daher werden Sie sicher auch die<br />
Zeit finden, es wieder loszuwerden<br />
G<br />
TIPPS ZUM ENTRÜMPLEN<br />
Eine Liste erstellen<br />
Machen Sie in Gedanken eine Tour durch<br />
Ihre Wohnung und notieren oder merken<br />
Sie sich die unordentlichen Stellen. Sie<br />
werden feststellen: Sie wissen genau, wo<br />
der Krempel steckt.<br />
Fangen Sie klein an<br />
Nehmen Sie sich zunächst die kleineren<br />
Bereiche vor und arbeiten Sie sich langsam<br />
zu den großen Zonen vor. Kleinere<br />
Bereiche sind etwa einzelne Schubladen,<br />
Badezimmerschränkchen, Handtaschen<br />
oder Werkzeugkästen. Mittelgroße Zonen<br />
sind Kleider-, Küchen- und Wäscheschränke<br />
und Schreibtische. Große<br />
Zonen sind Rumpelkammern, Keller,<br />
Speicher, Gartenschuppen oder Garagen.<br />
Übung macht den Meister<br />
Am Anfang mag Ihnen das Ausmisten<br />
noch etwas schwer fallen, nach und nach<br />
wird es Ihnen leichter fallen und sogar<br />
Spaß machen. Und am Ende bleibt ein<br />
Gefühl der Befreiung.<br />
Seien Sie konsequent!<br />
Alles, was Sie seit zwei Jahren nicht benutzt<br />
haben, fliegt raus!<br />
EINE HEIKLE ANGELEGENHEIT<br />
UNGELIEBTE GESCHENKE<br />
Allein schon der Gedanke, sie wegzuwerfen<br />
oder sie anderweitig loszuwerden,<br />
ist für manche Menschen<br />
erschreckend. Doch wenn man jemandem<br />
etwas schenkt, gibt man<br />
dem Empfänger auch die Freiheit,<br />
damit zu machen, was er möchte.<br />
Wenn Sie mit einem Geschenk nicht<br />
mehr anfangen können, als es in den<br />
Mülleimer zu werfen, ist das in Ordnung.<br />
Wenn Sie das nicht „übers Herz<br />
bringen“, können Sie damit ja auch<br />
anderen Menschen, die es gebrauchen<br />
können, eine Freude machen.<br />
Glaubenssätze, die Sie über Bord werfen sollten:<br />
Nur wenn ich perfekt bin, werde ich geliebt!<br />
Ich muss immer 100%ige Leistung bringen!<br />
K<br />
Ich darf nie die Kontrolle verlieren!<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
39
Ich kaufe, also bin ich?<br />
Konsumfreuden hinterfragen<br />
Viele Konsumgüter versprechen Entspannung.<br />
In Wirklichkeit aber sind sie<br />
Freizeitfresser! Das neue Handy will<br />
beherrscht werden, die edle Kleidung<br />
braucht Platz und muss gepflegt werden.<br />
Stellen Sie Kosten und Zeit dem Nutzen<br />
gegenüber. Rentiert sich das Konsumgut<br />
für Sie, oder geht es nur um die kurze<br />
Befriedigung der Konsumgelüste, dem<br />
der Konsumkater folgt, wenn das Erworbene<br />
seinen Reiz verloren hat? Wer beim<br />
Konsumieren ein wenig zögert, erhält<br />
oft die richtige Antwort. Wenn Sie das<br />
begehrte Gut zwei Wochen später immer<br />
noch haben möchten, könnte es die<br />
richtige Entscheidung sein.<br />
WAS BRINGT WIRKLICH GENUSS?<br />
Vorstellungen überprüfen<br />
Ist es das Essen im Nobelrestaurant oder<br />
die Karibikreise? Werden sie Ihnen den<br />
Genuss verschaffen, den Sie sich davon<br />
versprechen? Versuchen Sie Ihre Vorstellungen<br />
hin und wieder zu überprüfen,<br />
und finden Sie heraus, was Ihnen<br />
wirklich Freude bereitet. Diesen Dingen<br />
sollten Sie so viel Zeit wie möglich einräumen.<br />
Oft sind dies die einfachen und<br />
weniger spektakulären Freuden wie der<br />
Spaziergang am Morgen, ein Schaumbad<br />
bei Kerzenlicht oder ein Telefongespräch<br />
mit einem Freund.<br />
N<br />
40 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
MEDICOM-TIPP<br />
WAS MACHT MICH<br />
GLÜCKLICH?<br />
Das Leben zu vereinfachen heißt,<br />
Unwichtiges und Unnützes aus dem<br />
Leben zu verbannen, sodass mehr Zeit<br />
für das Wesentliche bleibt. Doch das<br />
ist individuell. Um herauszufinden,<br />
was Ihnen wirklich Freude macht,<br />
sollten Sie sich die drei folgenden<br />
Fragen stellen:<br />
Welche Ziele, Pläne, Tätigkeiten,<br />
Aufgaben und Hobbys gibt es in<br />
meinem Leben?<br />
Welche davon sind mir wirklich<br />
wichtig, sodass ich sie vermissen<br />
würde, wenn sie nicht mehr da<br />
wären?<br />
Was könnte ich problemlos aus<br />
meinem Leben verbannen, ohne dass<br />
ich es vermissen würde?<br />
R<br />
„ Vollkommenheit entsteht nicht dann,<br />
wenn man nichts mehr hinzufügen<br />
kann, sondern wenn man nichts<br />
“<br />
mehr wegnehmen kann.<br />
(Antoine de Saint-Exupéry)<br />
Auszeiten nehmen<br />
Muße zur Muße. Für Muße braucht es<br />
Zeit: um sich treiben zu lassen und<br />
tagzuträumen. Das klärt den Geist, erholt<br />
den Körper und fördert neue Ideen.<br />
Nehmen Sie mindestens einen Tag in der<br />
Woche als bewusste Auszeit. Nutzen Sie<br />
diesen Tag als Ruhetag, also als einen<br />
Tag, an dem Sie wirklich zur Ruhe kommen<br />
und nichts tun, was Sie anstrengt.<br />
Machen Sie generell weniger –<br />
dies aber mit mehr Engagement.<br />
Sie werden bemerken, dass das<br />
zufriedener macht.<br />
M
Vitalstoff-Rezept<br />
Dies Gericht ist der Beweis, dass eine magenfreundliche und<br />
bekömmliche Küche nichts mit fader „Schonkost“ zu tun<br />
haben muss. Im Gegenteil: Es darf sogar ein wenig pikant<br />
zugehen! Das liegt zum Beispiel am Fenchel, dessen<br />
Früchte in der Heilkunde vor allem bei Husten und<br />
Blähungen eingesetzt werden. Die fleischige Knolle<br />
kann man als Gemüse essen. Beide haben<br />
diesen typischen Fenchelgeruch bzw.<br />
-geschmack, der diesem Rezept<br />
seine besondere Note<br />
verleiht.<br />
Spaghetti mit Garnelen<br />
und Fenchel<br />
(Für 4 Personen)<br />
Zubereitung<br />
Die Garnelen in kleine Stücke schneiden<br />
und zusammen mit den kleingeschnittenen<br />
Knoblauchzehen in einer beschichteten<br />
Pfanne mit Olivenöl anbraten. Den<br />
Fenchel in kleine Streifen schneiden, zu<br />
den Garnelen geben und mit Salz und<br />
Pfeffer gut abschmecken. Zwei Minuten<br />
aufkochen lassen, anschließend die saure<br />
Sahne und die Tomatenhälften hinzugeben<br />
und weitere fünf Minuten kochen.<br />
Währenddessen die Spaghetti<br />
in gesalzenem Wasser bissfest<br />
garen. Anschließend die Spaghetti<br />
auf einen Pastateller<br />
geben und mit der<br />
Soße anrichten.<br />
FOTOS AUF DER SEITE 41: DPNY<br />
§<br />
Zutaten<br />
350 g Spaghetti<br />
200 g Tomaten (z. B. Cocktailtomaten),<br />
halbiert<br />
150 g Garnelen<br />
150 g Fenchel<br />
150 ml saure Sahne, 20 %<br />
50 ml Milch, 1,5 %<br />
1 EL Olivenöl zum Anbraten<br />
1 Zehe Knoblauch<br />
Salz und Pfeffer<br />
§<br />
§<br />
Nährwertangaben<br />
(Pro Portion)<br />
Energie 475 kcal<br />
Eiweiß 23 g<br />
Fett 15 g<br />
Kohlenhydrate 60 g<br />
Ballaststoffe 5 g<br />
Vitamin A 548 µg<br />
Vitamin B1 0,2 mg<br />
Vitamin B2 0,3 mg<br />
Vitamin B6 0,3 mg<br />
Vitamin C 27 mg<br />
Vitamin E 5,8 mg<br />
Calcium 160 mg<br />
Carotin 2 mg<br />
Folsäure 36 µg<br />
Magnesium 60 mg<br />
Eisen 4 mg<br />
Zink 2 mg<br />
Cholesterin 238 mg<br />
MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
§<br />
41
Leserbriefe<br />
Liebe MEDICOM-Leser,<br />
möchten Sie kritisch oder zustimmend zu einzelnen Themen im Heft<br />
Stellung nehmen? Oder interessante Tipps zum Thema „Gesund<br />
werden – gesund bleiben“ an andere Leser weitergeben? Dann schreiben<br />
Sie uns! Unsere Anschrift lautet: MEDICOM-Redaktion, Sedemünder 2,<br />
Altenhagen I, 31832 Springe.<br />
MEDICOM 32<br />
Aus dem Schlaflabor<br />
Liebe Redaktion,<br />
mit Interesse lese ich immer die<br />
MEDICOM und möchte Ihnen und anderen<br />
Lesern gern meine Erfahrungen zum<br />
Thema „Die Bedeutsamkeit des Schlafes“<br />
mitteilen. Ich war eine junge Frau, Kriegerwitwe<br />
mit einem Kind und Heimatvertriebene<br />
aus Schlesien. Beruflich war ich<br />
zudem sehr im Stress, sodass ich in die<br />
Angewohnheit verfiel, abends im Bett<br />
immer noch über alle Probleme nachzudenken.<br />
So wurde mein Schlaf immer<br />
schlechter, bis ich merkte, dass es so nicht<br />
weitergehen durfte, weil ich immer früh<br />
um fünf Uhr wieder aufstehen musste. So<br />
ließ ich mir vom Arzt ein Schlafmittel<br />
verschreiben. Zu der Zeit las ich zufällig<br />
einen Artikel über Bauchatmung bei<br />
Schlafstörungen. Die führte ich nun konsequent<br />
nach Vorschrift 20 Minuten<br />
abends im Bett durch. So hatte ich keine<br />
Zeit mehr, Probleme zu wälzen. Bald<br />
merkte ich, dass ich allmählich besser<br />
einschlafen konnte. Nach zirka sechs bis<br />
sieben Wochen hatte ich es geschafft,<br />
dass ich nach den Atemübungen sofort<br />
einschlafen konnte, ohne weitere Schlaf-<br />
42 MEDICOM 35. Ausgabe, Mai 2005<br />
mittel einnehmen zu müssen.<br />
Seit damals habe ich mir niemals<br />
wieder angewöhnt,<br />
abends im Bett über etwas<br />
nachzudenken. Stattdessen<br />
mache ich wegen inzwischen<br />
aufgetretener Krampfadern<br />
seit langem fünf Minuten<br />
Venengymnastik und kann<br />
danach sofort gut schlafen.<br />
Wie man morgens dann<br />
schnell und mühelos aus<br />
dem Bett kommt – diesen<br />
Tipp möchte ich auch noch<br />
weitergeben: Seit zirka 40<br />
Jahren mache ich Chirogymnastik nach<br />
Dr. Laabs. Es handelt sich dabei um ein<br />
Programm von fünf Minuten, das man<br />
mit geschlossenen Augen beginnen kann.<br />
Diesen Leitfaden gibt es auch heute noch<br />
unverändert. Die Übungen halten auch<br />
arthrotische Gelenke beweglich. Inzwischen<br />
bin ich 84 Jahre alt und konnte<br />
mein Leben bisher ohne Kaffee und<br />
sonstige Aufputschmittel meistern und<br />
bin schon recht zufrieden mit mir.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Lotte Wolff-Lorke, Weißenstadt<br />
Sehr geehrte Frau Wolff-Lorke,<br />
herzlichen Dank für Ihre sehr persönlichen<br />
Ratschläge zum Thema „besser schlafen“.<br />
Die MEDICOM-Redaktion möchte den<br />
Lesern gern auch ein paar Tipps mit auf<br />
den Weg in den gesunden Schlaf geben,<br />
denn fast jeder Dritte hat Ein- oder Durchschlafprobleme.<br />
Versuchen Sie es mit<br />
täglich wiederholten Einschlafritualen wie<br />
zum Beispiel einem kleinen Spaziergang,<br />
ruhiger Musik, einem heißen Bad oder<br />
auch einem Stückchen Schokolade vor dem<br />
Schlafengehen. Es gibt auch Hilfe aus der<br />
Natur. Ob als Tee oder in Tablettenform,<br />
Baldrian, Melisse und Johanniskraut<br />
helfen ins Reich der Träume.<br />
Liebe MEDICOM-Redaktion,<br />
ich kann von meinen zahlreichen Alterskameraden<br />
eine Erfahrung mitteilen, die<br />
zu einem erholsamen Schlaf verhilft.<br />
Abends am besten immer zur gleichen<br />
Zeit ins Bett gehen, da ein regelmäßiger<br />
Schlafrhythmus beruhigend wirkt.<br />
Ferner sollte man sich gut zudecken und<br />
den Kopf so bequem aufs Kissen legen,<br />
dass es nirgends drückt. Falls Licht ins<br />
Schlafzimmer scheint, sollte man sich<br />
zur dunklen Seite drehen. Dann die Augenlider<br />
schließen und bewusst ein- und<br />
ausatmen. Nun jeden Atemzug dabei für<br />
sich im Stillen zählen und, auch wenn es<br />
länger dauert, weiterzählen. Irgendwann<br />
beginnt man einzuschlafen. Diese Methode<br />
ist einfach und erfolgreich und so<br />
benötigt man keine Schlafmittel. Sie<br />
wird im Übrigen auch in Kinderheimen<br />
zum besseren Einschlafen praktiziert.<br />
Mit freundlichen Gesundheitsgrüßen<br />
aus Bielefeld<br />
Peter Pankratz<br />
Sehr geehrter Herr Pankratz,<br />
auch Ihnen recht herzlichen Dank für<br />
Ihre Einschlaftipps, die sicher ebenfalls<br />
sehr wirkungsvoll sind.<br />
Da das Thema „gesund schlafen“ offensichtlich<br />
sehr bedeutsam für die MEDI-<br />
COM-Leser ist, planen wir für die nächste<br />
<strong>Medicom</strong> erneut einen Artikel rund<br />
um das entspannte Schlummern. Dabei<br />
wird es zudem um das Schnarchen gehen.<br />
Da eine gute Nachtruhe wichtig für<br />
Körper und Seele ist, finden wir es sehr<br />
wichtig, dass die MEDICOM-Leser ausgeschlafen<br />
in ihren Tag starten. Deshalb<br />
freuen wir uns auch besonders über<br />
Ihre persönlichen Tipps.<br />
Impressum<br />
Herausgeber: <strong>Medicom</strong> Pharma AG<br />
Sedemünder 2, Altenhagen I<br />
31832 Springe<br />
Tel. 05041 78-0<br />
Fax 05041 78-1169<br />
Verlag,<br />
Redaktion,<br />
Gestaltung: DPNY communications<br />
Druck: Westermann-Druck<br />
„MEDICOM“ ist eine Kundenzeitschrift der<br />
<strong>Medicom</strong> Pharma AG; sie erscheint fünfmal<br />
jährlich. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit<br />
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.<br />
Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen kann keine Haftung übernommen werden.
Kreuzworträtsel<br />
Liebe Rätselfreunde, diesmal geht es um<br />
etwas, was unter einem anderen Namen<br />
den Zucker einer Rebfrucht bezeichnet.<br />
Tragen Sie die Buchstaben in der richtigen<br />
Reihenfolge in die nummerierten<br />
Felder ein.<br />
1. Preis: ein Reisegutschein im Wert von<br />
1.000 Euro<br />
2. bis 4. Preis: je ein<br />
Exemplar des Ratgebers:<br />
„Yoga für Anfänger“.<br />
aus dem Gräfe und Unzer<br />
Verlag<br />
Lösungen aus dem Dezember-Heft<br />
Lösung:<br />
Und so können Sie gewinnen<br />
Haben Sie das richtige Lösungswort? Dann schreiben<br />
Sie es auf eine Postkarte, und schicken Sie<br />
diese an: MEDICOM-Redaktion, Stichwort „Preisrätsel“,<br />
Sedemünder 2, Altenhagen I, 31832 Springe.<br />
Einsendeschluss ist der 31.07.2005 (Datum des<br />
Poststempels). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<br />
Mitarbeiter der <strong>Medicom</strong> Pharma AG und deren<br />
Angehörige dürfen nicht teilnehmen.<br />
S C H O N G E W U S S T ?<br />
Wovon die Körpergröße abhängt<br />
Fakt ist: In Deutschland herrscht ein<br />
Aufwärtstrend – die junge Generation<br />
wächst den Eltern über den Kopf. Woran<br />
liegt das? Forscher sind sich sicher,<br />
dass ein Zusammenhang zwischen Körpergröße<br />
und Lebensstandard besteht:<br />
Ausreichende Ernährung, medizinische<br />
Versorgung und gute hygienische<br />
Bedingungen fördern einen hohen<br />
Wuchs. Armut, Hunger und Krankheiten<br />
können dagegen die körperliche Entwicklung<br />
beeinträchtigen.<br />
FOTO: PHOTODISC<br />
Noch ist der Vater größer<br />
als der Sohn. Das wird sich<br />
aber wohl noch ändern.<br />
Aller statistischen<br />
Wahrscheinlichkeit nach<br />
wird der Sohn den Papa<br />
später überragen.
MEDICOM – immer an Ihrer Seite<br />
„Ihre Gesundheit ist unsere Aufgabe“ – das ist unser Motto. Die MEDICOM steht<br />
Ihnen mit sinnvollen Produkten in Ihrem Alltag zur Seite. Wir wollen, dass Sie Ihren<br />
Tag mit der Gewissheit erleben, Ihre Gesundheit aktiv zu unterstützen.<br />
Mit den Produkten von MEDICOM können Sie Ihre Gesundheit<br />
sinnvoll unterstützen. Haben Sie Fragen zum Thema „Gesundheit und<br />
Vitalstoffe“? Die Mitarbeiter unserer wissenschaftlichen Abteilung<br />
werden Ihnen gern all Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch<br />
am Telefon beantworten. Auch unser Kundendienst gibt Ihnen gern<br />
Auskunft zu unseren Produkten. Sie erreichen beide unter unserer<br />
gebührenfreien Telefonnummer. Ihre Zufriedenheit und Ihre Gesundheit<br />
stehen bei der <strong>Medicom</strong> Pharma AG an erster Stelle. Unser Bestreben<br />
ist es, Ihrem Vertrauen, das Sie uns als Kunde entgegenbringen,<br />
in jeder Form gerecht zu werden – sowohl mit unseren hochwertigen<br />
Produkten als auch mit sinnvollen Serviceleistungen. Bei der Herstellung<br />
unserer Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Rohstoffe. Die Herstellung<br />
erfolgt nach dem strengen GMP-Standard. Wenn Sie ein Produkt der<br />
MEDICOM erwerben, dann entscheiden Sie sich für Qualität. Bei der<br />
MEDICOM endet die Beziehung zum Kunden nicht mit der bezahlten<br />
Rechnung. Mit unseren Serviceleistungen – die weit über das Übliche<br />
hinausgehen – wollen wir Ihr Partner in Sachen Gesundheit sein: Sie<br />
bekommen als Kunde 5-mal im Jahr das Kundenmagazin MEDICOM.<br />
Sie erhalten auf all unsere Produkte eine Geld-zurück-Garantie. Sie<br />
erhalten Ihre Produkte innerhalb von 48 Stunden frei Haus gegen<br />
Rechnung. Sie können unsere Produkte per Post, per Fax, am Telefon<br />
und im Internet anfordern. Und als Sammelbesteller erhalten Sie<br />
einen interessanten Preisnachlass. Wir wollen alle Ihre Bedürfnisse in<br />
Sachen Gesundheit befriedigen und Ihnen in Ihrem täglichen Leben<br />
zur Seite stehen. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr Partner in Sachen Gesundheit.<br />
Im Internet: www.medicom.de • Kostenlose Ernährungsberatung: 0800-7377730<br />
FOTO: TAXI, DPNY