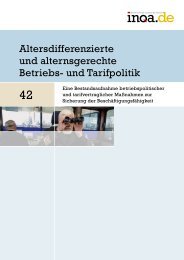download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
download als PDF - SOFI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Constanze Kurz / Harald Wolf 4<br />
epistemische, ökonomische, institutionelle und organisatorische Dimensionen der sozialen<br />
Einbettung wissenschaftlichen Handelns. Wichtig sind zunächst die grundlegenden<br />
thematischen und stofflichen Charakteristika biowissenschaftlicher Arbeit, sozusagen ihr<br />
nicht hintergehbarer sachlicher Kern. Ihn gilt es so weit freizulegen, dass diejenigen Aspekte<br />
deutlich werden, die die Besonderheiten des biowissenschaftlichen Wissensangebots, auf das<br />
reflektiert wird, ausmachen. Beschränkt haben wir uns auf einen thematischen Ausschnitt<br />
dieses Angebots, der <strong>als</strong> besonders relevant für biotechnologisch-medizinische Anwendungen<br />
(Therapeutika, Diagnostika, Impfstoffe etc.), <strong>als</strong>o die sog. rote Biotechnologie, gilt.<br />
Ökonomische, institutionelle und forschungsorganisatorische Dimensionen betreffen dagegen<br />
eher die Seite der Wissensnachfrage. Hier beleuchten wir, in welche Richtung (von welchen<br />
Akteuren mit welchen Intentionen „nachgefragt“), mit welchen (förderpolitischen,<br />
institutionellen, organisatorischen) Maßnahmen und Mechanismen befördert und in welchen<br />
Formen der Wissenstransfer abläuft. Zu rekonstruieren sind die industrielle Nachfragekonstellation<br />
(Interessenlagen der Pharma- und Biotechnologieunternehmen) sowie die<br />
staatlichen Initiativen zur Anregung, Förderung und Steuerung biowissenschaftlicher<br />
Forschung in der Perspektive der Transfersteigerung. Ein wichtiges Ergebnis ist die<br />
Bestimmung der für die akademischen Biowissenschaften wichtigsten „Transferkanäle“. Im<br />
vorliegenden Papier werden unsere Befunde zu den genannten Untersuchungsdimensionen<br />
nur so weit skizziert, <strong>als</strong> es für das Verständnis der subjektiven Wahrnehmungs- und<br />
Verarbeitungsweisen von BiowissenschaftlerInnen nötig erscheint. Auf ihnen liegt in diesem<br />
Papier der Fokus. Die ausführliche Analyse der institutionellen Entwicklungen bleibt dagegen<br />
einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.<br />
Den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsweisen des Wandels kann man sich indes nur nähern,<br />
wenn man genauer bestimmt hat, wodurch das Arbeitshandeln der WissenschaftlerInnen<br />
geprägt ist: wie ihr Aufgabenprofil aussieht, welchen Stellenwert darin die Forschung<br />
(gegenüber der Lehre) hat, welche Ansprüche an die Freiheit der Betätigung in der Forschung,<br />
an Selbstverwirklichung, Sinnerfüllung und Anerkennung damit korrespondieren.<br />
Dabei geht es sowohl darum, die intrinsische Seite ihres Arbeitsverständnisses und ihrer<br />
Arbeitsidentität <strong>als</strong> auch die konkreten Anforderungen und Bedingungen, die sich mit der<br />
Organisation und Durchführung ihrer Forschungstätigkeit verbinden, zu erkunden. In dieser<br />
Perspektive ist zu konkretisieren, ob die Universitäten mit den skizzierten institutionellen<br />
Veränderungen und „unternehmerischen“ Ansprüchen, die an die Biowissenschaftler gestellt<br />
werden, „landen“ bzw. neue Rahmensetzungen vor Ort erreichen können. Von Interesse sind<br />
in diesem Zusammenhang nicht nur der Stoff und das Ausmaß der konkreten<br />
Transferaktivitäten. Vielmehr ist mit Blick auf die Handlungsmotive und das Handlungsrepertoire<br />
von BiowissenschaftlerInnen offen zu legen, ob sich Anknüpfungspunkte für ein<br />
verändertes, post-akademisches Selbstverständnis identifizieren lassen, das mit dem akademischen<br />
Ethos möglicherweise konfligiert.<br />
Die Arbeitssituation der BiowissenschaftlerInnen interpretieren wir vor dem Hintergrund der<br />
berufsbiographischen Schilderungen der Befragten. Das heißt, wir betrachten die aktuelle<br />
Tätigkeit zugleich aus berufsbiographischer Perspektive, im Zusammenspiel mit Laufbahnund<br />
Karriereinteressen, in einem Feld, das durch das Streben der Wissenschaftler nach<br />
Anerkennung und durch Konkurrenz mitgeprägt ist (vgl. Gross/Jungbauer-Gans 2007). Die<br />
aktuelle berufliche Position der BiowissenschaftlerInnen begründet einen spezifischen Status<br />
in der sozialen Hierarchie des Feldes, die eine wichtige Bestimmungsgröße sowohl im<br />
Hinblick auf Unterschiede der beruflichen Wahrnehmungsweisen und Aspirationsniveaus <strong>als</strong><br />
auch im Hinblick auf die Transferaktivitäten und Transferorientierungen der BiowissenschaftlerInnen<br />
darstellt. Zu untersuchen ist <strong>als</strong>o, inwieweit die Verwirklichung der beruflichen<br />
Leitvorstellungen, die in unterschiedlichem Maß an wissenschaftlichen Normen, an<br />
Selbstentfaltung, an der Gestaltung des Umfelds und an Karriereambitionen ausgerichtet sind